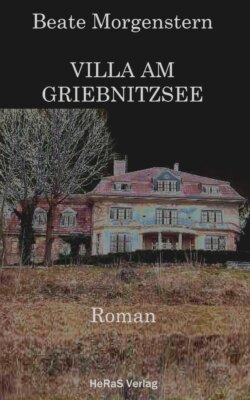Читать книгу Villa am Griebnitzsee - Beate Morgenstern - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеSchritte die Treppe hinauf. Jemand, der sich darauf eingerichtet hatte, nirgendwo anzuhalten, bis zur Dachwohnung hinaufzusteigen. Susanne immer das Ohr am Hausflur. Die Liege an der Wand zum Flur. Da verbrachte sie viel Zeit am Tag. Susanne richtete sich auf, langsam, ließ die Beine zu Boden gleiten. Ging zur Tür. Zimmer- und Flurtür dicht nebeneinander.
Sie erwartete ihren Besuch meist in der offenen Tür. Überraschend für die Besucher, wenn sie um die Hauswandecke bogen und Susanne sahen. Das nächste Mal wird Georg kommen, hatte Marco gesagt. Ingo, Ulf, Marco ... Nun Georg. Hinter der Hauswand tauchte er nun auf: Nicht groß, schwarze Jeans, knöchelhohe Lederschuhe. Trotz seines jungenhaft vollwangigen Gesichts schneidig, wie man früher gesagt hätte. Die mittel blonden Haare kurzgeschnitten, hochstehend. Er sah aus wie die jungen Burschen, die vor fünfzig Jahren in den Krieg gezogen waren mit eben diesen kurzgeschnittenen Haaren. Manche hatten runde Brillen getragen wie er. Nie würden junge Männer wieder so aussehen, hatte sie gedacht, so deutsch, so schneidig. Nun war es wieder Mode geworden, sich die Haare bis über die Ohren abzurasieren. Auch Deutsch war wieder in Mode gekommen. Susanne konstatierte emotionslos. Er sah aus wie einer, der wusste, was er wollte. Sah jedenfalls so aus. Sie sind also der Georg!, sagte Susanne, reichte ihm die Hand. Susanne ging ihm voran in die Wohnung, zeigte ihm, wo er alles fände.
Ein E-Piano!, sagte Georg verwundert, als er das Zimmer betrat, in dem sie sich am meisten aufhielt. Neben breiter Liege, kleinem alten Sofa, Sesseln, zugehörigem ovalen Tisch und Glasschränkchen hatte am Fenster gerade noch ein E-Piano Platz gefunden.
Ich hab's gegen mein Klavier eingetauscht, antwortete Susanne, schaute Georg an, um sich an sein Aussehen zu gewöhnen. Keiner der Jungen bisher hatte sich für ihr kleines Piano interessiert. Am liebsten suche ich mir nach Gehör Filmmusiken zusammen, sagte sie.
Man hat mir schon erzählt, dass Sie was mit Film zu tun hatten.
Susanne lächelte. Sie hatte sich gedacht, dass die Jungen von ihr sprachen. Deren Alltag sicher eintönig, Susanne fiel aus dem Kreis von Menschen heraus, die die Jungen sonst betreuten. Ich schneide Tag und Nacht Filme mit, erklärte sie. Vor allem Komödien. Und Filmklassiker. Als ich nach der Wende Geld geschenkt bekam, habe ich mir als Erstes einen Videorecorder angeschafft. Stummfilme kommen natürlich kaum im Fernsehen. Auch selten die sowjetischen Filme. "Iwan Grosny" fehlt mir zum Beispiel und Tschuchrais "Klarer Himmel".
Tschistoje nebo, sagte Georg mit unbeweglichem Gesicht.
Ulf hatte Susanne gefallen, Marco ebenfalls, selbst Ingo. Zu jedem hatte sie eine Beziehung aufgebaut. Ganz gewiss würde sie sich auch gut mit Georg verstehen. Sie gehören noch der Generation an, die etwas Russisch können, sagte sie.
Mehr als etwas. Georg griente hinter seiner runden Goldrandbrille. Sein Jungengesicht nun noch voller. Wir haben in der SU gelebt. Und dann war ich hier auf der Russisch-Spezialschule.
Ihre Familie war in der Sowjetunion?
Meine Eltern haben dort gearbeitet. Mein Vater als Kernphysiker, meine Mutter als Informatikerin.
Ich war nie in der SU. Ich habe russische, sowjetische Literatur gelesen, herrliche Filme gesehen. Aber ich war nie dort.
Da war doch jeder, sagte Georg.
Wie gesagt, ich kenne das Land nur durch Bücher und Filme. Herrliche Filme. Dowshenko "Die Erde", "Die Ballade vom Soldaten", "Die Kraniche ziehen". Habe ich neulich im ORB mitgeschnitten. In Susanne begann das Lied, das sie seit Wochen hörte:
"Die Kraniche hoch droben ziehn am Himmel ihre Bahn. Schau einmal hin, schau zweimal hin und schau mich wieder an." Veronika tanzt und singt, während sich Boris auf einem Stuhl weiter bemüht, eine Verdunklung am Fenster anzubringen. "Sehr inhaltsreich" bemerkt er. Veronika zieht ihn vom Fenster hinunter auf den Boden, setzt den Fuß auf ihn. "Du hast mich besiegt", sagt er. "Du bist besiegt, du bist besiegt. "Veronika springt durch das Zimmer, sieht dann aus dem Fenster. "Sag mal, können sie dich nicht einberufen?", fragt sie. - "Natürlich!" - Aber freiwillig gehst du nicht. " Wenn's sein muss, gehe ich."
Langes Sitzen strengte Susanne an. Sie legte sich hin, schob sich ein Kissen unter den Kopf, bat Georg, auf einem Sessel in ihrem Blickfeld Platz zu nehmen. Immer versuchte sie, mit den jungen Männern zu reden, wenn sich nur irgendein Ansatzpunkt ergab.
Veronika schleicht sich durch die elterliche Wohnung. Die Mutter dreht sich im Bett, wendet sich an den Vater: "Er hat ihr den Kopf verdreht." - "Und sie ihm", entgegnet der Vater. "Liebe, meine Teure, ist ein gegenseitiges Kopfverdrehen."
Susanne begann von dem Film zu erzählen, dessen Musik ihr nicht aus dem Kopf ging und infolgedessen auch die Bilder nicht. Es war der Erste, verstehen Sie, der allererste, in dem der große Bruder nicht von Helden berichtete, sondern von dem Elend, das der Krieg über die einfachen Menschen brachte. Ein Ereignis, als er Ende der 50er Jahre in den Kinos lief. Eine Liebesgeschichte. Dann kommt der Krieg. Eine Geschichte auch von Verrat. Bisweilen gibt es sarkastische Momente.
Boris hat seinen Einberufungsbefehl erhalten. Der Junge, sein Vater, die Schwester, die Großmutter sitzen um einen Tisch und warten auf Veronika. Zwei Komsomolzinnen platzen in die Abschiedsrunde, um patriotische Grüße von der Komsomolorganisation auszurichten. Boris' Vater, Arzt, rundes, doch nicht volles Gesicht, Brille, Schnurrbart, hohe Wangenknochen. Vor Gram um seinen jüngsten Sohn außer sich, fällt er in die Rede der beiden Mädchen ein: "Halten Sie durch bis zum letzten Blutstropfen, sollen Sie sagen." Fast schreit der Vater. "Schlagen Sie die verdammten Faschisten, während wir hier weit hinten die Pläne erfüllen und übererfüllen werden!" Die Mädchen lassen sich von ihrem Geplapper nicht abhalten. Bei einem ist gerade Abschied vom Bruder gefeiert worden. "Mutter hat so geweint", berichtet das Mädchen stolz. "Und Sie?", fragt der Vater grimmig. "Ich auch." - "Im Auftrag der Betriebsgewerkschaftsleitung oder von sich aus?"
Ein pazifistischer Film, sagte Susanne. Selbst vor der Darstellung einer Vergewaltigung schreckte man nicht zurück. In Bildern, Symbolen: Stiefelschritte, die auf Glasscherben gehen. Wenn man die Sprache des Stummfilms kennt, ganz eindeutig. An unserer Schule hat man's jedoch geleugnet.
An Ihrer Schule?, fragte Georg.
An der Filmhochschule. Nach dem Vorbild der WGIK geschaffen, der berühmten Hochschule in Moskau.
In Babelsberg, ich weiß, sagte Georg.
Er weiß, wie schön. Natürlich weiß er, dachte Susanne, versuchte mit einer Gegenfrage von dem Gesprächsthema abzukommen, das ihr immer das liebste von allen war. Und darf man fragen, was Sie nach dem Jahr als Zivi vorhaben?
Ich werde Geiger, sagte Georg schlicht.
Geiger? Violinist?
Ich habe eine Zusage von der Weimarer Hochschule.
Also darum die Frage nach meinem E-Piano!
Vielleicht werde ich auch Tonmeister, schwächte Georg ab.
Kunst oder Kommerz! Susanne riss ihren Mund weit zu einem Lachen auf, was sie sich leisten konnte. Obwohl Mitte 50, hatte sie ihr vollständiges Gebiss, starke regelmäßige Zähne. Auch ihr braun-schwarzes Haar zeigte kaum Graufäden. Wie zum Hohn hatte ihr die Natur äußerlich ewige Jugend gegeben. Von kräftiger Gestalt, sah sie immer blühend aus, wie das bei Hochdruck-Kranken überwiegend der Fall ist.
Das erste Gespräch mit Georg war geführt. Susanne hätte sich auf jeden jungen Mann eingerichtet. Doch bei Georg handelte es sich wohl um einen Glücksfall. Musiker war er!
Die Zivildienstleistenden hatten leichte Arbeit bei ihr. Sie holten ein, trugen Mülleimer hinunter, kehrten und wischten die Treppe, blieb Zeit genug, unterhielt sie sich mit den Jungen. Vor allem brauchte sie jemanden, mit dem sie reden konnte.
Susanne verabschiedete Georg für diesen Tag.
Die Familie von Boris am Frühstückstisch. Ein leerer Stuhl "Unglaublich!" - "Er arbeitet so viel", entschuldigt die Großmutter. "Diese Arbeit wird mit einer Hochzeit enden", spottet die Schwester. ... Man hört eine Meldung im Radio: "Hier sind alle Sender der Sowjetunion und Radio Moskau. Achtung." Blick auf den schlafenden Boris. Der Bruder Mark kommt herein. "Boris, es ist Krieg." - "Lasst mich schlafen."
Jeden Dienstag, jeden Donnerstag erschien Georg. Einmal war er länger krank. Ein anderer kam. Susanne wartete, dass Georg wieder gesund würde. Anfangs brachte er bei jedem Besuch etwas mit. Als Erstes eine Schallplatte, die Aufnahme von einem Konzert des ehemaligen Musikschulorchesters der DDR, nunmehr von Gesamtdeutschland, zur Einweihung des neuen Parlamentsgebäudes in Bonn im November 92. Georg hatte im Orchester mitgespielt.
Georg erzählte von der Musik, die er mit einer Band machte, Geige, Mandoline, Banjo, Bass, E-Gitarre. An den Wochenenden zogen die jungen Männer über die Dörfer. Dann brachte er eine Tonbandkassette seiner Musik mit. Das ist Blue Grass, sagte er.
Blaues Gras?
Ja, nach dem Gras benannt, das in Kentucky wächst.
Susanne fiel die blaue Blume der Romantik ein. Blau die Farbe der Treue, aber auch der Sehnsucht. Georg hatte einen Traum. Auch sie hatte geträumt. Sie träumte immer noch. Ihr Leben kannte keine Zukunft mehr. Doch die Welt der Illusion, des Films, war ihr geblieben.
Susanne legte die Kassette ein. Die Musik rhythmisch, sehr melodiös, virtuos, die Geige fiedelte, unglaublich das Tempo, schon in den Jazz gehend. Es war genau die Art Musik, die Susanne mochte. Nun verstand sie, dass Georg Pullis mit aufgedruckten indianischen Mustern trug. Es geschah aus Verehrung zu diesem Land, in dem das "blaue Gras" wuchs, zu seiner Geschichte. Gefällt mir, Georg, gefällt mir sehr, sagte sie.
Ihren Ursprung hat die Musik bei den Schotten, den ersten Einwanderern, erklärte Georg. Übrigens haben Sie eine gute HiFi-Anlage.
Ich hab sie mir Stück um Stück gekauft. Ich bin schon immer für gute Tontechnik zu haben gewesen. Und wenn ich deshalb nur trocken Brot essen müsste. Sie lachte.
Georg verzog leicht den Mund, woran Susanne sah, ihr einfacher Scherz hatte Erfolg. Ihr war es immer darum zu tun, die Menschen um sie zum Lachen, zu guter Laune zu bringen.
Na ja, Frau Burkard, was ich für Sie einkaufe, ist schon dürftig!
Ich muss mein Gewicht halten. Fleisch darf ich wegen meiner Diät sowieso kaum essen. Also leiste ich mir CDs, einen guten Fernseher, eine HiFi-Anlage.
Dieses Mal hatte Georg eine Kassette bei sich gehabt. Ein anderes Mal war es ein großer Apfel. Er bestand darauf, ihn in der Mitte durchzuschneiden und ihr die Hälfte zu geben.
Immer mehr bezog Susanne Georg in ihre Gedanken ein. Die Nähe war leicht herstellbar. Georgs Großmutter lebte im selben Ort wie Susanne, ein Teil noch zu Berlin gehörig, er wohnte mit seiner Familie im Nachbarort, noch im S-Bahnbereich. Das Haus seiner Eltern offenbar von Rückübertragungsansprüchen nicht betroffen wie Häuser sehr vieler anderer hier. Raffe, raffe, Häusle klaue, nannte man im Volksmund den Entscheid Rückgabe vor Entschädigung. Man war in Deutschland angekommen. Und dieses Deutschland war kalt. Aber es gab diese jungen Männer, Ersatz für die Hauswirtschaftspfleger in DDR-Zeiten, damals Aussteiger zumeist, die Alten und Bedürftigen geholfen hatten.
Georg hatte seinen Professor in Weimar besucht. Der Professor war mit ihm zufrieden gewesen. Georgs kindlich-schneidiges Gesicht nun nur noch kindlich, als er davon sprach. Dann wieder war er müde von den Auftritten seiner Band am Wochenende. Geld spielte eine große Rolle. Die Band brauchte Technik, Verstärker, Mikros. Die Jungen sparten. Blieb bei den Besuchen Zeit zum Reden, erzählte Susanne Georg von Filmen und Geschichten, die sie gehört oder selbst erlebt hatte.
Manchmal ertappte sie sich dabei, wie sie laut mit Georg sprach, obwohl er nicht da war.
Ich komme aus kleinen Verhältnissen, erklärte sie dem abwesenden Georg. Ich hab wohl das Klavier zu Hause traktiert, unheilbar verstimmt seit der Überschwemmung der Euba in den zwanziger Jahren, aber mehr war für mich nicht drin. Eines Tages hätte ich den Laden meiner Mutter übernehmen sollen.
Von frühmorgens bis spätabends und oft noch am Wochenende das Läuten der Klingel. Die Mutter läuft in den Laden: Gudn Tach, Frau Sowieso, gudn Tach, Herr Sowieso, was darf'sn sein? Um Pfennige, um das Geld, Geschäft dreht sich alles. Schon als Vierjährige rennt Susanne ins Kino, hat bei Kino-Marquardt ihren Platz. Für eineinhalb Stunden schaut sie in eine andere Welt, in der Mut etwas gilt, und Ehrlichkeit und Gerechtigkeit sich durchsetzen. Oder die einfach schön ist, leicht, heiter:
"Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, ein Freund bleibt immer Freund, selbst wenn die ganze Welt zusammenfällt ... "
Von nichts kommt nichts. Immer gibt es irgendeinen Anstoß, der den Stein ins Rollen bringt. Sonst liegt er da, rührt sich nicht. Es kann nicht sein, denkt der Mensch. Wie kann etwas sein, was nie war! Die Mauksch-Irmgard verdirbt dich!, barmt die Mutter. Sie setzt dir Flausen in den Kopf! Mitten in der Verwandtschaft von Händlern und Gastwirten Mauksch-Irmgard, eine Sängerin! Die bringt Susanne darauf, dass es beim bloßen Wünschen, Sehnen nicht bleiben muss. Mauksch-Irmgard nimmt Susanne in eine Premiere nach Dresden mit. Der Vorhang geht auf. Die Welt, die sie dort sieht, hat nichts mit der gemein, in der sie lebt. Von da an wird Susanne von Kino, Film, Theater nicht mehr lassen. Und wenn sie Platzanweiserin würde, wie Susannes leibliche Mutter, die sie wenige Jahre später kennenlernt.
Mauksch-Irmgard verschwindet zu einem westdeutschen Industriellen nach Bayern. Susanne marschiert zum Chefdramaturgen des Theaters von Karl-Marx-Stadt, vormals Chemnitz, nachmals Chemnitz oder Karl-Chemnitz, wie ein ehemaliger Studienfreund zu sagen beliebt. Mauksch-Irmgard hat sie noch bekannt gemacht. Susanne kann sogar ein Anliegen vorbringen. Für den Schulfunk kommt sie. Auch ein Chefdramaturg kann oder will vielleicht nicht Nein sagen, wenn ein Kulturobmann der FDJ in quasi gesellschaftlichem Auftrag zu ihm kommt. Und erst recht nicht, wenn er Susanne heißt. So ein Typ fällt auf, draufgängerisch, kräftige Gestalt, dicker, schwarzer Pferdeschwanz, engstehende gelbe Augen, breite Wangenknochen, lange gebogene Nase, kleiner voller Mund wie ein küssendes Herz im Gesicht. Das Gespräch dehnt sich aus. Friedrich Wolf, in der Schule gepriesener Autor von "Professor Mamlock", "Zyankali", wird von dem Chefdramaturgen achselzuckend zur Seite getan. Wir müssen die Stücke spielen, sagt er. Das wirkliche Leben, die wirkliche Kunst ist was anderes. Und Pavel Kohout?, fragt Susanne. Nee, sagt der Chefdramaturg. Schauen Sie sich Goldoni an, das ist Theater, die Commedia dell'Arte. Molière.
Susanne erhält Maßstäbe, wird sich von Gerede nicht mehr irremachen lassen.
Der untergeordnete Dramaturg Susannes nächster Ansprechpartner. Ich interessiere mich für Theater, sagt sie. - Und was interessiert Sie am Theater? - Warum die Leute auf das eine Stück so gut reagieren, auf ein anderes weniger. - Na, was meinen Sie denn, warum? Was macht Kunst aus? Wie wirkt Kunst? Warum sind bei bestimmten Stellen die Leute ergriffen? Ein Plan steckt dahinter, ein Gefüge, erkennt Susanne.
Der Chefdramaturg bietet Susanne an, in eine Generalprobe zu kommen. "Wallenstein". Mitten im Text unterbricht der Regisseur, ruft etwas nach oben. Der Schauspieler zieht den Degen. Wirft ihn auf den Boden. Ist ja Mist!, ruft er. Wenn Sie noch einmal so mit mir sprechen, lass ich mir das nicht gefallen. Was ist das für eine Art! Er spricht volltönend, mit "Röhre" - Sie haben gefälligst meine Konzeption umzusetzen!, donnert der Regisseur. Und wenn Sie das nicht bringen, dann fällt meinetwegen heute Abend die Premiere aus!
"Wenn ich irgendeinen Witz anfange, stiehlst du die Pointe, wenn ich Diät esse, nimmst du ab. Wenn ich mich erkälte, du hustest. Und wenn wir jemals ein Kind bekommen sollten, dann bist du wahrscheinlich die Mutter." Die gefeierte Schauspielerin Maria Tura hat einen ihrer spontanen Auftritte hinter der Bühne. "Wenn ich der Vater bin, bin ich zufrieden", entgegnet Joseph Tura trocken.
Da haben wir's ja mal wieder, schreit der Schauspieler, dann fällt die Premiere aus!
Der Assistent redet auf den Regisseur ein. Die Schauspieler oben auf der Bühne schauen beiseite oder lachen. Dann sagt der Regisseur: Ich habe es so und so gemeint und möchte Sie bitten. - Hmhm. Der Schauspieler hebt den Bühnendegen wieder auf. Sagt: Na ja, das muss ja sein. Wenn es bei der Generalprobe keinen Krach gibt, geht die Premiere schief! Steckt den Degen in die Scheide. Gelächter.
"Sein oder Nichtsein", flüstert die Souffleuse. "Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage": sagt Joseph Tura mit bebender Stimme. Und wieder verlässt wie auf Stichwort der polnische Offizier Sobinski in der dritten Reihe den Zuschauerraum.
Mit den Generalproben bekommt Susanne nur ein Endergebnis vorgeführt. Sie will nun an den Proben teilnehmen, in denen alles entsteht. Endlich wird es ihr gestattet. Der Dramaturg kann den Schauspielern erklären: Das Fräulein Burkard bewirbt sich an der Filmhochschule. Susanne saust unter dem Vorwand, den Schulfunk aufzubauen, ins Theater, besucht alle Opern, Schauspiele. Karten liegen für sie bereit. Bis das dicke Ende kommt: das Abitur. Die Klasse war durch Schulen gewandert, an unfähige, überforderte Lehrer geraten. Viele Schüler gaben vorher auf. Der Rest paukt, versucht nachzuholen. Acht fallen durch. In Mathematik war Susanne einmal gut. Sie schafft eine knappe Vier, ein "Mangelhaft" vor dem völligen Ungenügen, der Fünf. Bei der mündlichen Prüfung eine unerklärliche Gedankenleere. Selbst die binomischen Formeln sind ihr entfallen. Wenn man sie doch nach einem Film, einem Theaterstück fragen würde!
"Wer sind Sie? Wie kommen Sie hierher?" Joseph Tura zu dem polnischen Offizier Sobinski, den er in seinem Schlafzimmer vorfindet. - "Bin abgesprungen mit einem Fallschirm." - "Ach, mitten in mein Bett?" In das Gespräch zwischen Joseph Tura und Offizier Sobinski, der aus England zurückkehrte, um den Spion Siletsky unschädlich zu machen, kommt Maria Tura. Es sei keine Zeit zu verlieren, erklärt sie. Sie müsse mit Siletsky essen gehen und ihn umbringen. Joseph versteht kein Wort, weist auf alle Fälle Sobinski in die Schranken: "Ich entscheide, mit wem meine Frau essen geht und wen sie umbringen soll." - "Haben Sie denn gar keinen Patriotismus?", entgegnet Sobinski. - Joseph Tura erbittert: "Jetzt hören Sie mal genau zu. Erst stehlen Sie sich aus meinem Monolog. Und dann stehlen Sie sich in meine Pantoffeln, und dann bezweifeln Sie meinen Patriotismus. Ich bin ein guter Pole. Ich liebe mein Vaterland, aber auch meine Pantoffeln! ... Ich bestelle Herrn Siletsky einfach ins Gestapo-Hauptquartier, und wenn ich ihn umgebracht habe, dann seid ihr vielleicht so liebenswürdig und sagt mir, warum.
Georg brachte die Einkäufe nach oben. Zeit zum Reden war nicht geblieben. Auch war er unlustig, schlecht gelaunt. Die Wochenenden unterwegs mit seiner Band überanstrengten ihn offenbar. Er schaute auf seine Uhr, nahm seinen Lederrucksack auf.
Susanne hätte es gern gehabt, wenn Georg gefragt hätte. Sie hätte gefragt, sie war immer neugierig auf Menschen gewesen. Frau Burkard, waren Sie auch in der Partei?, hätte Georg fragen können. Die Frage stellte sich jetzt immer. War man Mitläufer, gar engagiert gewesen? Vielleicht waren Georgs Eltern in der Partei gewesen, hatten ihre Ideale gehabt, möglicherweise sogar bis zum Ende an die Reformierbarkeit des Sozialismus, an den Sozialismus mit menschlichem Antlitz geglaubt. Im Alter von Georgs Eltern ging man freiwillig in die Sowjetunion, wurde man nicht wie nach dem Krieg als Spezialist gezwungen. Ich war Junger Pionier, hätte Susanne geantwortet. Gegen den Widerstand meiner Mutter und meiner alten Verwandten. Ich beschimpfte sie Schmarotzer, Parasiten. Sie nannten mich Verräter, denn mein Vater war als angeblicher Nazi im Lager umgekommen. In der FDJ war ich zunächst glühendes Mitglied, bis ich merkte, da funktionierte nichts außer den Fahnenappellen. Und Resolutionen wurden verfasst. Ich war in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, weil wir die Lehrerin mochten und uns ehrlich mit dem Volk aussöhnen wollten, dem wir soviel Unrecht angetan hatten. Ich war mit dem russischen Volk und seinen edlen Zielen einverstanden. Den kleinen Leuten sollte es gut gehen. Die sollten nicht auf der Straße rumstehen, nicht wissend, wohin vor Langeweile. Im Kulturbund war ich, weil ich wollte, dass wir in der Schule Zirkel gründeten. Und in der GST, der Gesellschaft für Sport und Technik. Da allerdings nicht freiwillig. Wir wussten, es war eine paramilitärische Organisation. Wir vom Jahrgang 38 waren ja alle Kinder, die den Krieg, Nachkrieg miterlebt hatten, kannten die Folgen vom Krieg, waren mit Flüchtlingskindern aufgewachsen, die ihre Heimat verloren hatten. Schon als die Polizei gegründet wurde, war uns nicht wohl. In der Bevölkerung war sie verachtet. Wir wollten die Gesetzlosigkeit nach dem Krieg natürlich auch nicht. Doch dass die Polizei in unseren Augen weniger gegen Kriminelle vorging als gegen Politische, missfiel uns allen. Im Sinne Makarenkos wollte man Menschen helfen, die gestrauchelt waren. Sie sollten wieder nützliche Glieder der Gemeinschaft werden. So weit richtig. Doch man maß mit zweierlei Maß. In die GST wollten wir auf keinen Fall. Doch da gab es diesen Mathelehrer. Er verachtete uns, brachte sein Pensum ohne Rücksicht, ob wir mitkamen oder nicht, so dass wir zu den wenigen Schülern gingen, die zu Hause gearbeitet hatten, uns von denen erklären ließen. Und er machte sich unsere Angst zunutze. Eines Tages kam er in die Klasse, sagte: Meine Damen, hier! Wir waren eine reine Mädchenklasse. Er hatte einen Stoß Anträge für die GST in der Hand. Wir: Nö, was sollen wir dort? Er: Wer interessiert sich? Zwei Fingerlein meldeten sich. So, ich lege die Zettel hier vorn hin, sagte er. Ich komme in 'ner viertel Stunde zurück. Entweder sind die Zettel ausgefüllt, oder wir schreiben eine Mathematikarbeit, bei der keine von euch mehr haben wird als eine Vier, die meisten eine Fünf. Er ging raus. Wir sahen uns an, griffen uns die Zettel. Als er reinkam, schaute er sich den Stapel an, lächelte. Warum nicht gleich so, meine Damen! So war ich Mitglied in der FDJ, der DSF, im Kulturbund und in der GST. Und wurde dann auch Mitglied einer Partei. Aber nicht der. Ein Mädchen aus der Klasse schrieb Lokalspitzen. Das kannst du doch auch, sagte sie. Das Mädchen war bei der "Volksstimme". Da konnte ich also nicht hin. So ging ich zum Blatt der NDPD, der Nationalen. Na ja, sagte der Redakteur, das ginge schon. Aber Sie müssten erst Mitglied unserer Partei werden. - Geben Sie mir ein Aufnahmeformular, sagte ich. Er tat es. In fünf Minuten war ich Mitglied einer Blockpartei. Es war lächerlich, und so nahm ich es auch. Unter dem Motto: Wenn die's so wollen, wenn die so blöd sind! Ihre Generation hat es denen ja nicht mehr so leicht gemacht. Georg hätte gegenreden können oder nicht. Aber Georg war nicht mehr da.
Hässlich ist Nanne. Nanne, das hässliche Mädchen. Die Mutter hackt auf Nanne herum. Nanne muss es glauben. Sie zieht Hosen an, um ihre Beine nicht zu zeigen, wird das Hosenmädchen genannt. Die Mutter schleppt Nanne zur Schneiderin, macht Vorschläge. Die Schneiderin nimmt Nanne zur Seite: Hör bloß nicht auf deine Mutter, sagt sie. Du hast doch Geschmack! Susanne kauft sich in Westberlin eine James-Dean-Weste, die dreißig Westmark kostet beim Kurs 1:5, eine Strickjacke mit Samteinsatz vorn und einen Wintermantel für umgerechnet 300 Ostmark. Im Sommer zwei Kleider. Sie trägt geschneiderte BHs. Bis sie an die Schule kommt. Ein Mädchen aus dem Nachbarzimmer begutachtet ihre eigentümliche Ausrüstung, schleppt sie nach Potsdam, zwingt sie, einen Teil ihres Stipendiums für zwei BHs der neuesten Mode auszugeben, Monroe-Büste mit Körbchen. Der Erfolg umwerfend. Im Seminar übergeht man noch Susannes Vervollkommnung. Aber als Susanne in die Regieklasse tritt, anerkennende Laute, Pfiffe. "Donnerwetter", sagen die Jungs. Die Schauspielmädchen schneiden Susanne die Haare kurz. Die Mädchen schminken sie. Susanne nicht mehr das hässliche Mädchen. Eine List der Mutter war es, die alles tat, um Susanne von den Jungen fernzuhalten. Nicht einmal auf den Tanzboden hatte sie sich gewagt.
Dass ich nicht tanzen ging, ist mir bei meiner zweiten Aufnahmeprüfung an der Schule fast zum Verhängnis geworden. Susanne sprach in Gedanken wieder mit Georg. Gehen Sie tanzen?, fragte der Parteisekretär. Nein, sagte ich. - Ein junges Mädchen, das nicht tanzt?, fragte der Parteisekretär, schüttelte den Kopf. - Ja, ich muss doch immer Klavier spielen, hab ich schnell gesagt. Dann tanzen die anderen. Und als ich es dann mal probiert habe, habe ich gemerkt, ich hab den Takt nur in den Händen, nicht in den Füßen! Lacher in der Runde. Ich hatte gewonnen.
Den Takt hat Susanne nicht nur in den Händen. Aber wie kann sie tanzen gehen, wenn sie sich vor Scham kaum auf die Straße getraut. Sie zieht sich nach Hause zurück. Liest. Und sie kauft Bücher. Verwendet während der Oberschulzeit ihr Essengeld dafür, Friedensware aus dem Lager zu Hause, die ihr die Mutter gibt, Kurvenlineale, Zirkelkästen bessern außerdem ihre Kasse auf Susanne räumt den Bücherschrank zu Hause um. Die Bücher in der hinteren Reihe bringt sie zu den alten Verwandten, den Boehms, stellt ihre hinein, stellt die von hinten langsam nach vorn. In einem entfernteren Raum ihres Hauses existiert ein alter Bücherschrank des Vaters. Vorn Nazischwarten. Verlag Eder "Volk unter dem Hammer". In der zweiten Reihe Bücher ganz anderer Art, Weltliteratur durchweg. Susanne lernt ihren Vater von einer neuen Seite kennen. Und für Biologie, Geologie interessierte er sich. Die Nazischwarten der Alibireihe verschwinden. Weltliteratur gesellt sich zu Weltliteratur.
An meinem Vater hab ich gehangen wie an niemandem sonst, dachte Susanne. War er da, war alles gut.
Banker war der Vater in Chemnitz. Doch die Mutter träumte vom eigenen Laden, von Selbständigkeit. Susannes Großvater war noch mit dem Bauchladen unterwegs gewesen. Die Mutter wollte einen deutlichen Aufstieg, drängte ihren Mann. Still und weich war er, ein Mann, wie ihn sich herrschsüchtige, unleidliche Frauen suchen. Er gab nach.
Er gab auch nach, als der Schwager zum Eintritt in die Partei drängte. Kein Eubener Geschäftsmann, der es wagte, nicht Mitglied dieser Partei zu sein. Und Boehm & Burkard hatten schließlich zwei Geschäfte.
Nur einmal gab er nicht nach. Als es um die Adoption eines Kindes ging. Ausgerechnet Susanne hatte es sein müssen, das Mädchen mit dem jüdischen Namen, das er holte. Warum es so schwierig war, Susanne zu adoptieren, konnte später niemand sagen. Der Vater handelte die Angelegenheit ohne Mitwissen der Verwandten aus, kämpfte Monate. Am Reformationstag 38 war es so weit: Er fuhr mit der Mutter in einem Opel vor dem Heim in Dresden-Radebeul vor, um Susanne mitzunehmen. Ein Jahr später war Krieg. Obwohl 38 Jahre, Inhaber von zwei Geschäften, wurde er als einer der Ersten einberufen. Nie zeichnete er sich aus, bekam keinen Sonderurlaub wie andere. Doch er kehrte gesund aus dem Krieg heim. Ganze glückliche 14 Tage waren Vater, Tochter und Mutter zusammen. Dann holten die Russen und zwei Deutsche den Vater als Nazi ab, steckten ihn in einen Sammeltransport. Noch waren die Männer, die man abgeholt hatte, im Rathaus eingesperrt. Boehm-Otto, der Schwager, drängte die Mutter. Susanne verstand nicht, worum es ging. Nur dass die Mutter Angst um Susanne hatte. Erst später wurde Susanne klar, die Mutter hatte es nicht gewagt, die Umstände der Adoption auf dem Rathaus zur Sprache zu bringen. Sie hatte die Furcht, nach dem Mann auch noch das Kind zu verlieren an die Mutter, die es auch gab und die mit Susannes Großmutter jeden Sommer, jedes Weihnachten sich im Dorf herumtrieb. Als einige Tage später eine Abordnung geachteter, unbelasteter Männer aus dem Ort im Rathaus vorsprach, war der Burkard-Walter schon nicht mehr aufzufinden.
Was hatte er sich zuschulden kommen lassen? War Schreibstubenhengst gewesen, trotz Abitur, das ihm eine militärische Laufbahn beinahe garantierte. Mitglied der NSDAP, und seit 38 Zellenleiter, vielleicht, um die Adoption des Kindes Susanne zu beschleunigen, das ihm das Fräulein v. Brück vom Ermel-Haus ans Herz gelegt hatte. Aber was war das schon für eine Funktion.
Der Krieg, ausgelöst vom great dictator, war noch lange nicht zu Ende gewesen. Selbst 50 Jahre später sah es noch einmal nach Siegern und Besiegten aus.
"Dictator of the world?" Wie aufgezogen klettert Chaplin-Hynkel einen langen Vorhang hinauf, als er von den Überlegungen seines Beraters Garbitsch erfährt. "Believe me, I want to be alone", lässt er sich vom Vorhang herab vernehmen. Helles süßes wagnerianisches Signal. Hynkel gleitet den Vorhang hinunter, beginnt mit einem großen leuchtenden Weltballon zu spielen, lacht, dreht ihn auf der Hand, stößt ihn mit dem Kopf, legt sich auf den Schreibtisch, stößt ihn mit dem Hintern. Über dem großen Emblem - zwei Kreuze, weißes Oval, Strahlen, vom Emblem ausgehend - schwebt der Weltballon. Der Diktator bewegt sich in höchster tänzerischer Eleganz, gibt dem Ballon mit dem rechten, mit dem linken Handrücken Schwung. Der leuchtende Weltball schwebt, springt vom Boden auf den Schreibtisch. Hynkel komponiert Bewegungen, die Welt und Hynkel in einer Sinfonie. Da platzt der Ballon. Ein hässlicher Gummilappen klebt an der Hand des Diktators.
17 ist Susanne, noch Oberschülerin, als sie die erste Aufnahmeprüfung an der Filmhochschule macht. Berühmtheiten sitzen am U-förmigen Tisch. Für das Fach Regie hat sich Susanne gemeldet. In feinem Sächsisch antwortet Susanne standhaft auf die Fragen. Männchen oder Menschen?, fragt der den Vorsitz führende Professor, gibt seiner Lachlust nach. Den Unterschied wird Susannes sächsische Zunge nie herausbringen. Auf der freien Seite des Tisches liegen Reproduktionen von Gemälden. Eines von Repin. "Die Heimkehr des Verbannten". Mithilfe zweier Winkel soll Susanne die Szene in fünf Einstellungen zerlegen. Susanne begreift nicht. Der Professor nimmt ihr das Bild aus der Hand. Was machen wir mit ihr? Sie ist ja noch sehr jung, gibt er zu bedenken. Jemand sagt: Ich würde schon meinen, man sollte sie nehmen. Alle fangen an zu lachen. Warum? Susanne schaut auf jemanden in der Runde, bekommt den Blick nicht mehr los, als könnte der helfen: ein schwarzer Lockenkopf, das Gesicht kastenförmig, etwas eingedrückt, Narbe an der Oberlippe, noch trägt er nicht den Bart. Konny Wolf, Sohn des Friedrich Wolf, des Stuttgarter Arztes und Autors von "Zyankali". Konny Wolf lächelt. Na, den kennen Sie wohl?, fragt der Professor. Ja, antwortet Susanne. Aber ich kenne auch andere. Sie nennt viele beim Namen. Warum haben Sie gerade auf Konrad Wolf geschaut?, fragt der Professor. - Na, ich hab grad seinen Film gesehen. - Und wie finden Sie ihn? - Herr Professor Hellberg, soll ich ihn vielleicht gut finden?, erkundigt sich Susanne. Gelächter. Susanne kann gehen, braucht zu den anderen Prüfungen nicht zu erscheinen. Noch sind Sie zu jung, sagte der Professor. Aber ich glaube, für den Kinderfilm wären Sie geeignet.
Sie geht hinaus auf die Diele der Stalin-Villa, wo die Prüflinge stehen, unschlüssig, was sie mit dem Rest des Tages anfangen sollen. Kommt, Kinder, wir gehen zur "Kurbel", sagt einer der Mitbewerber. Die "Kurbel", ein Panorama-Kino, interessiert Susanne nicht. Drei Gruppen bilden sich. Die einen wollen aus Prinzip nicht nach Westberlin, die anderen gehen zur "Kurbel". Die Dritten zum Potsdamer Platz. Als Susanne mit der Kellerbahn fährt, überkommt sie eine starke Erinnerung an Krieg. Elf Jahre zuvor ertranken die Menschen in den unter Wasser stehenden U-Bahn-Schächten. Die Treppe hinauf, dann hat man es geschafft, erklärt der Junge, der die Gruppe führt, gibt Anweisungen für die Kontrolle. Schauer rinnen Susanne den Rücken entlang, bis sie oben ist.
Chaplin-Hynkel, Hände auf dem Rücken, kratzt sich den Hintern, spricht zu seinem toumainischen Volk: Das-wiener-schnitzel-mitdielagewerden-und-die sauerkraut - eh - die flutensack-da-fletten- Tomainia-sein-und-schtraff-und-schtraff. Hynkel fängt an zu husten, hustet seine Rede weiter. Dem-traps-mit-dieselben-sack ... schtraffein ... schtraffein ... schtraff.
Der Potsdamer Platz eine Trümmerlandschaft, freie Fläche. Weniges stehen geblieben. In den Häuserruinen unten einige Geschäfte, vollgestopft die Schaufenster mit Schmuck, Zigaretten. Jauchzet, frohlocket! Im Hof eines großen Hauses zwei Kinos. Wild gemalte Kinotafeln locken. An das Haus schließt sich ein Markt an, die Stände überdacht. Ein Markt für Ostler. Billige Pullover, Flanellhosen, James-Dean-Jacken, Blockschokolade, Pfirsiche, Apfelsinen, Bananen, Weintrauben. Einen Pfirsich will Susanne, eine Schachtel Zigaretten. Der Anführer geht mit den Prüflingen in die Wechselstube der Commerzbank, zurück auf den Markt und dann ins Kino. 25 Pfennige für Ostler. Zwei Filme spielen die zwei Kinos an einem Tag. Vier Filme könnte man sich ansehen! Eine Dame öffnet die Türen. Ein Gestank wie im Zoo. Menschen strömen beglückt heraus. Eine Einlassdame eilt durch den Saal mit einem Zerstäuber, versprüht Duft, süß, chemisch, ein Meer von Blumen, aus Westpaketen bekannt. Damen gehen mit Bauchläden wie in Ufa-Filmen durch die Reihen, bieten Bonbons, Knabberzeug und Eis an. Susanne ist vom Wunderland betrunken, ehe der Film anfängt. Mit dem Film haben sie einen guten Griff getan. "Rififi", ein harter Krimi. Vor Glück schwankend, folgt Susanne den anderen zum Ausgang. Für 25 Pfennige kann ich so was sehen!, denkt sie. Mensch, ich trau mich!, sagt einer. Ich kauf ne Zeitung. Er kauft sich eine Filmzeitschrift. Die nun vier Mark. Westmark. Susanne kann sich nicht beherrschen, tut es ihm nach. Sie probieren, wie sie die Zeitschrift durch die Kontrolle bringen. Susanne steckt sie zwischen Achsel und Hosenbund.
Eine Polizistin kommt auf sie zu. Was haben Sie hier getan? Im Kino waren wir, will Susanne sagen, wird angestoßen. Der Anführer antwortet. Wir haben uns mal umgeschaut. - Und nichts gekauft?! - Der Junge macht seine Lederoltasche auf, Papierchen, Zettel für die Aufnahmeprüfung. Das interessiert mich doch alles!, sagt der Junge. Ich will doch wissen, wie die hier leben. Die Polizistin schaut böse. Er lenkt ein. Ich komm doch von so nem Kuhkaff. Ich muss doch meinen Leuten erzählen, was das für ein Zeug ist. Doch dann geht der Junge zu weit. Dauernd sind sie in den Schulen auf Exkursionen, besichtigen dieses und jenes, werden wissenschaftlich gebildet. Wir sind nämlich auf ner Exkursion, sagt er. - Die anderen auch? - Ja, von der Schule aus. Wieso?! Von welcher Schule? Eine Schieberin lenkt die Polizistin ab. Der Trupp rast die Treppe hinunter. Im vollen Berufsverkehr sind sie sicher. Susanne steigt Ostbahnhof in ihren Zug, hat eine Fahrt von sechs Stunden nach Karl-Marx-Stadt und weiter nach Euba vor sich. Sitzt auf einer harten Holzbank, will schon die Zeitung herausnehmen, da stößt sie ein Mann an: bloß nicht! Es kommen gleich noch mal Kontrollen. - Jaja, sagt eine Frau gegenüber. Und noch mal in Schönefeld. Die Trapo, die Transportpolizei, macht nur Stichproben, in ihrem Abteil nicht. In Schönefeld steigen viele Menschen zu. Noch mal Kontrollen. Susanne will zur Toilette, um die Zeitschrift in der Tasche zu verstauen. Lange Schlangen vor der Toilette. Und die dann voller Kot, eine Schweinerei, was sie sonst nicht kennt. Sie glättet die Zeitschrift, die kostbare, sieht im fürchterlichen Gestank das Antlitz von Ruth Leuwerick, der Lollo, von Kirk Douglas. Monty Clift, ganzseitig abgebildet.
Auf einer Landstraße von Nevada steht Monty, telefoniert: Hallo, Mutter. .. es war ein prima Rodeo ... Eigentlich wollte ich dir was Hübsches zum Geburtstag kaufen, aber ich bin aus meinen Stiefeln raus gewachsen ... Nein, nein, Mutter, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war ich nicht im Krankenhaus. Ich hab mir ein paar Stiefel gekauft ... Stell dir vor, außer dem Geldpreis hab ich noch ne hübsche Schnalle gewonnen ... ein bockendes Pferd ist drauf und mein voller Name ist darunter silbern eingraviert ... Nein, nein, mein Gesicht ist wieder in Ordnung, alles ist abgeheilt. Es ist so gut wie neu ... Ach Mutter, du bist mit dem Mann verheiratet, nicht ich ... Hör zu, hör zu, vielleicht ruf ich dich am Weihnachtsabend an. Okay. Hallo, Hallo ... Gott schütze dich auch!
In der Nacht kommt Susanne in Euba an. Am Morgen nimmt sie kurz vor sechs den Zug wieder nach Karl-Marx-Stadt. Wenn bloß Abend ist, denkt sie den ganzen Tag. Dann ist es Abend, sie geht ins Bett, schaut und ist von nun an mit Hollywood und der ganzen Filmwelt verbunden. Denn Autogrammadressen sind vermerkt von Marlon Brando, Marlene Dietrich, Grete Weiser, Horst Buchholz.
Ende August bekommt Susanne eine Absage von der Filmhochschule. Der Professor hat ihr eine Bemerkung an den Rand einer Seite geschrieben: Bewerben Sie sich in einigen Jahren noch einmal, wenn Sie älter geworden sind! Daran hält sich Susanne, während sie in der wissenschaftlichen Bibliothek der Technischen Hochschule von Karl-Marx-Stadt festsitzt. Der Staub lagert sich auf den Büchern ab, sie mutmaßt, auf Dauer von Jahrzenten auch im Gehirn. Zwei gleichförmige Jahre. Susanne im Lesesaal zur Ausleihe oder an der Schreibmaschine, um Karteikarten anzulegen. Für jedes neue Buch soundso viel Karten. Frauen gehen ächzend mit ihren Bücherkarren, die sie von hier nach da schieben. Und nichts geschieht, rein gar nichts. Das Schlimmste, was Susanne im Leben passieren kann. Immerhin macht sie sich die Dienste der Bibliothek zunutze, bestellt über Fernleihe aus den USA Bücher über den Film. Die Bibliothek wundert sich über hohe Portokosten. Susanne bestellt sich das "International Film Annual" von einem englischen Verlag. Es wird ihr geschickt. Sie behält das Buch. Die Rechnung, zwei Pfund, kann sie nicht bezahlen, wie auch! Abends kann sie blättern, sich aus ihrer kleinen Welt entfernen in die große.
Einmal begibt sich in der Bibliothek ein mittleres Ereignis. Die Mitarbeiter erhalten eine Einladung zu einer Veranstaltung in der alten Mensa. Studenten, die sonst stumm hinter den Büchern hocken, ganz der Wissenschaft hingegeben, sind plötzlich ganz anders, nämlich normal. Ein Lachen, ein Reden. Und dann: Was will der uns erzählen! Gemeint ist Kurt Hager, vom Politbüro des ZK für Kultur zuständig, im Jahre 58 und bis zum Jahre 89, wo er immerhin schneller als andere seiner Alters- und Politbürogenossen die Wende begreift.
Zum Tanz aufgefordert von der Königstochter von Tahiti, ruckt, zuckt der Kapitän der "Bounty", der hagere, ehrgeizige Mann, wie ein Hampelmann zappelt er mit Armen und Beinen, immer schnel ler, zackiger. Da erscheint sein Gärtner. Die Brotfrucht, deretwegen die "Bounty" nach Tahiti entsendet wurde, ist eingegangen. Christian Fletcher-Brando, Offizier der Bounty, unendlich gelangweilt, dekadent, betrachtet die Pflanze. "Sie sieht ein bisschen deprimiert aus!", meint er. "Sie haben das Menschenmögliche getan, nur bedrückt mich, dass die Admiralität sich meiner Auffassung nicht anschließen wird"
Herr Hager referiert. Die Studenten machen deutliche Handbewegungen, gähnen sich an. Das Referat endet. Stille. Keine Hand regt sich. Dann steht doch jemand auf, spricht dem Mitglied des Politbüros für die wichtigen und wegweisenden Worte seinen Dank aus. Die Studenten murren.
In der Oberschulzeit war Susanne noch die sowjetische Wissenschaft bahnbrechend, maßgebend erschienen. Nicht so an der Hochschule. Die Bibliothek bestellt wenig sowjetische Literatur, nur zu spezifischen Fragen. Alle andere Fachliteratur beziehen sie aus dem Westen. Sämtliche Standardwerke, diverse Handbücher. Die junge technische Intelligenz lässt Herrn Hager ungestärkt von der Basis heimfahren in die Hauptstadt. Als die Studenten die Mensa verlassen, witzeln sie, lachen. Die Verwandlung der stummen Bibliotheksbenutzer ist Susanne noch einmal geradezu wunderbar.
Susanne schreibt für die "Sächsischen Neuesten Nachrichten", kauft weiter Bücher in einem kleinen Laden im Hotel "Chemnitzer Hof". In den Jahren 56 bis 58 bekommen Buchhandlungen teils noch ein Kontingent von Westbüchern, die man 1: 1 kaufen kann. Die Buchhändlerin, hingerissen von Susannes Wunsch, sich auf den Weg zur Kunst aufzumachen, gibt ihr bis zu 20 Taschenbücher von rororo, Fischer, Ullstein. Steinbecks "Früchte des Zorns" erscheint. Susanne setzt ihrer Verehrerin aus der Buchhandlung als Dank Autogramme unter ihre in der Zeitung erschienenen Artikel. In der wissenschaftlichen Bibliothek gibt es noch Überreste von schöner Literatur um 1900, so dass sie sich über andere Nationalliteraturen der Zeit informiert, "Multatuli" von Max Havelaar wird ihr ein Begriff. Der Erwerb von Büchern fällt ihr leicht. Sie verdient durch Lokalspitzen zu ihrem Gehalt, isst billiges Mensa-Essen. Die Monatsfahrkarte kostet zehn Mark. Und von ihrem Geld muss sie zu Hause nichts abgeben. Susanne geht ins Theater, die Karten bekommt sie weiter umsonst. Auch in die Museen geht sie, oft zum "Steinernen Wald", in der Gegend ausgegrabene versteinerte Holzstämme, manchmal schaut sie sich die Schmidt-Rottluff-Bilder an, die der Maler zurücklassen musste, als er seine Heimatstadt verließ und nach Westberlin ging. Rottluff ein Dorf, inzwischen ein Vorort von Chemnitz. Aller vier Monate fährt Susanne nach Westberlin. Erst für einen Tag, später für zwei, in Ausnahmefällen für drei. Sie informiert sich über das Angebot an der Litfaßsäule, weiß durch Knaurs Lexikon und regelmäßig gekaufte Filmzeitschriften zu unterscheiden, errät oft nur die deutschen Titel, stellt sich ihr Programm zusammen, rast zum Potsdamer Platz in die zwei Kinos, ein drittes in der Ruine des Hotels "Esplanade", Vorschauen verpasst sie, hat es eilig, nach den Filmen hinauszukommen. Einlassdamen schauen wütend auf das rasende Mädchen. Sie fährt mit dem Bus vom Potsdamer Platz über das Reichspietsch-Ufer zum Wittenbergplatz und Ku'damm. Zehn bis zwölf Uhr die erste Vorstellung, die zweite bis halb drei, die dritte bis 17 Uhr, die vierte bis 20 Uhr, die fünfte bis 22 Uhr, vielleicht noch eine sechste. Am nächsten Tag die Tour von vorn. Manchmal folgt ein dritter Tag. "Das Atelier am Zoo", "Filmbühne Wien", "Gloria-Palast", "MGM", "Filmbühne am Steinplatz" das Revier, das sie abgrast. Sie isst fast nichts, hat später mit Salami belegte Brote dabei. Salami fast unverderblich. Doch Susanne mag die Wurst nicht. Die erste Nacht flieht Susanne aus einem ehemaligen Puff, findet keine Unterkunft. Ihrem Chef in der Bibliothek erzählt sie etwas von einer Westberliner Verwandten, die sie manchmal zu besuchen hätte. Ihr Chef rät zum Hotel "Minerva" an der Friedrichstraße. Einen Gruß von ihm solle sie dort ausrichten. Sie bekommt ein Zimmer, bestellt von da an telefonisch vor, sinkt todmüde spätnachts ins schlechte Bett. Ein Besuch alle vier Monate reicht aus, um auf dem Laufenden zu sein. Auch der Progress-Filmverleih bringt in Karl-Marx-Stadt gute italienische, französische Filme. Nicht alle, die es wert sind.
"... Man überlistete den Feind mit Grazie. Man schlitzte ihm den Bauch mit Schönheit auf. Alles lief am Schnürchen wie im Ballett ... Die Soldaten des Königs fanden den Krieg so unterhaltsam und amüsant, dass sie ihn ganze sieben Jahre dauern ließen. Als die Zahl der Toten allmählich die Zahl der Lebendigen überstieg, schloss man daraus, dass sich die Truppenstärke verringert haben müsse. Alsbald machten die Rekrutenwerber die schönen Straßen Frankreichs unsicher. "
Wenn der Laden geschlossen hatte, hörte das ewige Bimmeln auf. Aber was tauschte man dagegen ein: tödliche Sonntagsstille, die Erwachsene als schöne Ruhe nehmen und die junge Menschen in den Wahnsinn treibt. Susanne begann wieder, mit Georg zu sprechen. Der wusste sicher nichts von Langeweile. Sein Weg war einfach gewesen. Von klein auf spielte er Geige, hatte nur zu entscheiden, ob er aus der Musik einen Beruf machen wollte und welchen. Anders Susanne. Nichts war vorgegeben. Nur, dass ein Stachel in ihr sitzt, dass sie etwas tun, sich bewegen muss. Schon immer musste sie beweisen, sie ist wer. Ä, de Burkard-Nanne!, hat es immer geheißen. Was sie auch tat, nichts galt. Dass die Mutter nicht zugab, sie ist nur ein angenommenes Kind, machte es noch schlimmer. Denn sie konnte den Eubenern nicht bestimmt entgegentreten und sagen: Na und? Die Sonntagnachmittage hasste sie, solange sie zurückdenken kann. Schon am Sonntagmorgen weiß sie: Dieser Nachmittag wird kommen, und es wird sein wie an jedem Sonntag, sie mit der Mutter eingesperrt in der guten Stube. Der ganze Ort wie ausgestorben. Die Mutter sitzt und döst. Und dann der Augenblick, in dem Susanne denkt, eigentlich ist sie tot. Die Mutter auch. Und alles, was sie sieht, existiert nur in ihrer Einbildung.
Um der jeden Sonntagnachmittag einsetzenden Erstarrung zu entgehen, verfällt sie auf die Idee zu filmen. Sie legt sich eine "Admira" zu, eine Schmalfilmkamera und ein Tonbandgerät. Ein Vorführgerät ist noch von Verwandten da. Sie stiftet drei Jungen und ein Mädchen an. Der Dachboden das Atelier. Auf zwei Stativen Nitrafotlampen. Eine Rolle Schrankpapier über dem Stock, die langsam abgedreht wird, das Roll-Epi. Sie machen einen ordentlichen Vorspann.
Der Hauptmann, sehr gepflegt, sehr elegant, hält mit leicht näselnder hoher Stimme an die Neulinge eine Ansprache: "Ich wünsche mir, frohe Gesichter um mich zu haben, die auf manierliche Art zu leben verstehen. Und zu sterben natürlich auch. "Beim Anblick Fanfans zeigt der Hauptmann sich zu einem Gespräch über das Abenteuer geneigt, in dem Fanfan die Pompadour und die Königstochter vor Räubern rettete. "Und sie hat Ihnen erlaubt, sie zu küssen?", erkundigt er sich. "Das ist doch kein Wunder, sie wird doch meine Frau", entgegnet Fanjan. "Eine Prophezeiung von Adeline", erklärt der Rekrutenwerber. "Ach, ich verstehe", seufzt der Hauptmann. "Wie rührend, sehr amüsant. Tja, Leichtgläubigkeit ist der Grundpfeiler der Armee. "
Ernstel, Tänzer bei der Staatsoper, dreht vor der Kamera Pirouetten, springt. Susanne denkt sich kleine Geschichten aus. Susanne geht auch zu Bekannten, in die Gärtnerei, um zu filmen. Wenn Susanne die Filme zurückbekommt, sie geschnitten, geklebt hat, sitzt das junge Eubener Volk rauchend im kleinen Wohnzimmer der Burkards neben- und übereinander. Die Mutter schaut kurz ins Wohnzimmer, vermutlich zufrieden, dass Susanne etwas gefunden hat, womit sie sich beschäftigt. Die Boehms, die alten Verwandten, staunen. Schon lange haben sie nicht mehr das Sagen.