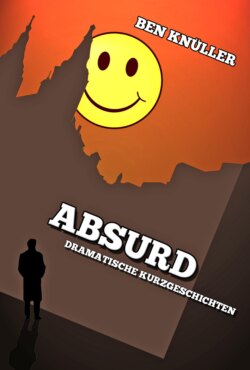Читать книгу Absurd - Ben Knüller - Страница 5
Toro
ОглавлениеDann fahr ich halt mal schwarz.
Eine spontane Entscheidung, die Robert Hoffmann an diesem milden Sommerabend in die Tat umsetzt, als er eilig in die Bahn springt, die nur alle halbe Stunde fährt. Er würde sich nicht als mutwilligen Schwarzfahrer bezeichnen. Er war das Opfer von falscher Zeiteinschätzung und hatte beim besten Willen nicht den Moment übrig, um sein Kleingeld in den Automaten zu werfen. Meine Güte, er bekam schon Panik, als er sah, wie die dickliche Bahnansagerin gerade alle möglichen Idioten bat, zurückzubleiben.
Was soll’s? Es sind eh nur drei Stationen. Sein Mitbewohner Kevin wollte heute Fisch und ein wenig Gurkensalat machen, als ihm unter Grausen auffiel, dass keine Gurke mehr im Haus war. "Kein Problem", meinte Robert ruhig und besonnen. „Ich wollte mir eh noch Zigaretten kaufen.“
Natürlich hatten die kleinen Märkte in direkter Nähe keine Gurken mehr um sieben Uhr am Abend. Offensichtlich brauchten mehrere Haushalte – ausgerechnet heute, versteht sich – das längliche, grüne Gemüse. Seufzend zog Robert sich also eine Fahrkarte und fuhr mit der S-Bahn zum nächstgelegenen Einkaufscenter. Nach der Gurke kamen die Zigaretten dran. Das Arschloch von Händler gab ihm röhrend zu verstehen, dass Roberts Zigarettenmarke um dreißig Cent teurer geworden war. So viel Kleingeld hatte er nicht mehr, also reichte er dem verschwitzten Mann an der Theke seinen letzten Schein. Und dann rannte er auch schon zu seiner S-Bahn.
Die ist relativ leer. Handwerkliche Arbeiter sitzen in ihrer teils dreckigen Dienstklamotten am Fenster, ein Feierabendbier in der Hand, und verfolgen mit leerem Blick die graue Umgebung. Zwei Mädchen mit vollen Einkaufstaschen kichern und gackern, und ein alter Mann sitzt mit seinem Schäferhund im mittleren Gang und schläft mit offenem Mund.
An der nächsten Station steigen ein Mann und eine Frau ein. Sie scheinen weder ein Paar noch besonders gute Freunde zu sein, wechseln aber schnell und leise ein paar Worte. Die Frau nickt und geht an Robert vorbei, bis ans andere Ende des Waggons. Sie ist etwas drall, hat ein Piercing an der Lippe und schwarzes, zu einem Dutt gestecktes Haar. Der Mann bleibt stehen und schaut aus dem Fenster. Er misst gefühlte zwei Meter, hat einen Bürstenschnitt und grimmige, lustlose Augen. Gerade, als die Bahn ihre Pforten schließt, zückt er ein Scangerät und posaunt in die müde Menge: „Schönen guten Tag, die Fahrkarten bitte.“
Durch Robert fährt ein intensiver Schrecken, ein Herzinfarkt ohne Schmerzen. Seine Atmung setzt für mehrere Sekunden aus. Rein instinktiv tastet er seine Taschen ab, hofft tief in seinem Innersten, dass sich dort vielleicht eine Fahrkarte materialisiert hat. Aber bis auf das klimpernde Kleingeld ist sie leer. Er erwacht aus einer Lethargie, als sich Bürstenschnitt vor ihm aufbaut.
„Die Fahrkarte bitte!“
Robert ist zu nicht viel mehr in der Lage, als nur vorsichtig mit dem Kopf zu schütteln. Er versucht es noch einmal mit der Hosentasche, als hätte sich wie magisch doch noch etwas getan, die Fahrkarte zwischen bunten Kaugummis, Zuckerwatte und anderen Wundern suchend. Aber natürlich ist da nichts. Das bemerkt auch Bürstenschnitt. Er rümpft angewidert die Nase.
„Na schön“, sagt er und tippt etwas auf sein Scangerät. „Sprechen Sie deutsch?“
Robert hält die Frage für einen Witz. Laut sagt er: „Ähm...“
„Okay. Dann kommen Sie mal bitte mit.“
Er folgt dem Kontrolleur missmutig bis zur Tür. Die Roboterstimme verkündet bereits die nächste Station. Bürstenschnitts weibliches Pendant gesellt sich zu ihnen und betrachtet Robert wie ein abgelaufenes Produkt im Kühlschrank. „Was ist mit dem?“, fragt sie.
Bürstenschnitt zeigt mit dem Daumen auf Robert. „Unser Freund hat natürlich keine Fahrkarte.“ Sie wechseln ein Augenrollen, und Robert kommt sich wie ein Schwerverbrecher vor.
In der Bahn ist es inzwischen vollkommen still geworden. Die jungen Mädchen haben ihr Kichern eingestellt und durch ein neugieriges Glotzen ersetzt, die Arbeiter schauen müde auf. Der alte Mann, mittlerweile wieder wach, tätschelt seinen Hund und schüttelt mit dem Kopf.
„Denise hat sich von Flo getrennt“, plaudert Dutt daher, als gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt. „Dose hat schon gesagt, dass sie was mit seinem Bruder angefangen hat. Unglaublich, oder?“
Bürstenschnitt brummt zustimmend.
Als die S-Bahn in die Station einfährt, wird Robert am Arm gepackt. Bürstenschnitt will anscheinend ganz sicher gehen, dass ihm dieser Fisch nicht davonschwimmt. Sie steigen aus und stehen eine Weile auf dem Bahnsteig, während Dutt auf ihrem Gerät irgendwas eintippt. Robert fragt sich, was da über ihn geschrieben wird. Es würde ihn auch nicht wundern, wenn sie sich irgendwie auf Facebook eingeloggt hat, um diese witzige Situation zu teilen.
Die wenigen Passanten, die an ihnen derweil vorbeigehen, starren Robert eindringlich an. Kein Mitleid, oh nein, eher abartige Schadenfreude. Aber was will man schon dagegen sagen, er würde als Zuschauer wahrscheinlich ähnlich reagieren.
„Ja, hier Zehn-Neunzehn“, sagt Dutt. Sie hat ihr Funkgerät zur Hand genommen. „Wir haben einen Zwölf-Drei an, ähm… Adi, wo sind wir?“
Bürstenschnitt Adi seufzt, als würde er das öfters gefragt werden. „Sieben-Fünf-Fünf.“
„Sieben-Fünf-Fünf“, echot Dutt und wartete auf eine Antwort ihres Funkgeräts. Die kommt in Form einer bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Männerstimme. Robert erinnert sie vage an Darth Vader, vorausgesetzt, der spricht durch ein Megafon.
„So, Kumpel“, sagt Adi und verstärkt seinen Griff. „Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug.“
„Wie bitte? Was meinen sie damit?“ Er bekommt keine Antwort.
Robert gefällt das gar nicht. Er hat schon oft solche Situationen miterlebt um zu wissen, dass die Kontrolleure eine Fliege in ihrem Netz nach Personalien befragen, einen Zettel mitgeben und dann auch wieder in die Freiheit entlassen. Und was macht er stattdessen? Einen Ausflug. Kevin wird sich freuen, denkt er und schaut auf die weiße Tüte in der Hand, deren Arm nicht von einem Muskelprotz mit Namen Adi gehalten wird.
Auf dem Bahnsteig befindet sich – etwas weiter hinten – eine kleine Unterkunft für die Bahnsteigaufsicht. Ein längliches, kleines Gebäude, das man fast schon als Bungalow bezeichnen kann. An einem der zwei süßen Fenster hängt sogar ein Blumenkasten. Die Tür steht offen, und ein Mitarbeiter mit blauem Jackett und roter Mütze verlässt gerade das Etablissement, um die nächste Bahn abzupassen. Er hat einen kurzen, weißen Bart, und sein Lächeln, als er die drei Leute auf sich zukommen sieht, wirkt tatsächlich ehrlich.
„Na, habt ihr wieder einen erwischt?“, fragt er.
Bürstenschnitt nickt. „Wir sollen ihn hierher bringen. Ich hab mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert.“
„Ach, der Meister hält es mal wieder an der Zeit. Ihr wisst ja, manchmal sieht man ihn wochenlang gar nicht, und dann kriegt er plötzlich wieder Lust.“ Der ältere Herr zwinkert Robert zu. „Viel Spaß, Kleiner. Hättest du dir mal eine Fahrkarte besorgt.“
Robert ist kurz davor, sich in die Hose zu nässen.
Im Inneren des Häuschens sieht es aus wie in einer futuristischen Küche. Zwei Damen sitzen an Computern und trinken aus Kaffeetassen. Die eine ist pummelig und schielt durch ihre dicken Gläser von Brille, die andere ist ungefähr Vierzig und trägt eine blonde Dauerwelle. Gerade unterhalten sie sich noch über ihre Männer, den Garten und den kleinen Daniel, der bald sein Seepferdchen im Schwimmunterricht kriegt, gackern und frohlocken. Als die beiden Kontrolleure samt Robert das Gebäude betreten, verstummen die Damen. Die Pummelige schlürft von ihrem Kaffee. Es ist das einzige Geräusch in der Stille.
„Was soll denn das?“, fragt die blonde Dauerwelle. Robert kommt sich vor wie ein Fleck auf einer weißen Bluse.
„Der Junge hat seine Hausaufgaben nicht gemacht“, sagt Bürstenschnitt und zuckt desinteressiert die Schultern. „Der Meister will ihn sehen.“
„Der Meister?“, fragen Dauerwelle und Pummelchen gleichzeitig.
Dutt mischt sich in das Gespräch ein. „Komm schon, Adi. Du musst nicht jedem sagen, was den Kleinen erwartet. Außerdem wird der Meister bestimmt langsam ungeduldig.“
„Wer ist denn das?“, hört sich Robert fragen. „Ist das ihr Chef, oder was?“
„Oh, er ist mehr als das“, antwortet Pummelchen ehrfürchtig. Dauerwelle stößt sie in die Seite, als hätten sie schon viel zu viel gesagt.
Ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, wird Robert nach vorne gedrückt, durch den Arbeitsraum der Bahnangestellten, vorbei an einem Waschbecken und einer Toilettentür. Sie halten vor einer mit mehreren Schlössern versehenen Tür. Dutt zieht eine Karte durch einen Schlitz an der Seite, und die Schlösser klicken wie von Zauberhand. Die Tür öffnet sich mit einem schrillen Piepton. Der Raum dahinter ist vor lauter Dunkelheit nicht zu sehen. Robert wird nach vorne geschubst, schreit kurz auf und landet auf dem Boden.
„Warte bitte kurz“, sagte Bürstenschnitt und schließt die Tür. Nun sieht Robert gar nichts mehr. Er steht zitternd auf, befühlt seine Umgebung und findet einen Stuhl. So sitzt er eine Weile da, mit den Gedanken zwischen Ungläubigkeit und wachsender Wut. Er geht die einzig mögliche Variante durch, nämlich, dass er bei der Versteckten Kamera gelandet ist. Er malt sich bereits aus, wie er bei der Auflösung reagieren wird, und zwar mit einem deftigen Fausthieb in das Gesicht des Moderators, als er ein Geräusch hört. Ein Kratzen, irgendwo im Raum. Wahrscheinlich eine Ratte, denkt er, und wenn das wirklich der Fall ist, folgt auf den Faustschlag eine Klage vom Gesundheitsamt.
„Ganz schön dunkel hier, was?“
Robert schreckt zusammen. Die Stimme war keinen Meter entfernt. Mit Unbehagen stellte er fest, dass er nicht allein in diesem Raum in. Robert spüre eine unangenehme Anwesenheit. Als das Licht angeht, so schwach es auch ist, quiekt er erschrocken. Vor ihm, an der Decke baumelnd, sieht er eine flackernde Energiespar-Glühbirne. Ein Schatten huscht an ihr vorbei. Robert hält gespannt den Atem an und denke instinktiv an eine sprechende, übergroße Ratte.
„Guten Tag.“, sagt eine dunkle Stimme. Sie scheint im ganzen Raum verteilt zu sein. Robert dreht sich unsicher um, dreht sich wieder zurück und schreit. Ein großer, erschreckend dünner Mann steht vor ihm. Er sieht alt aus, fast wie siebzig. Hinter seiner Brille starrt er Robert an, mit dunklen Augen, eingekreist von noch dunkleren Augenringen. Bis auf ein paar graue Haare über den Ohren ist der Mann kahlköpfig. Sein schwarzer Anzug gibt ihm das Aussehen eines Bestatters. „Entschuldigen Sie mein plötzliches Auftreten“, sagt der Mann. „Ich mag es etwas theatralisch, wissen Sie?“
Robert hat die Nase voll von diesem Humbug. Er wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt, herumgeschubst und im Unklaren gelassen. Langsam ist er sich ziemlich sicher, dass die Menge von Gesetzesvergehen inzwischen eher auf der Seite der Bahnangestellten ist. Er stellt sich gerade auf und klopft sein Hemd ab. „Hören Sie, wie viel kostet so was? Dreißig, Vierzig Euro? Ich bezahle es und dann beenden wir bitte diese…“
„Halt den Mund!“
Der Schrei ist markdurchdringend und nicht von dieser Welt. Wie umgeschubst fällt Robert zurück auf seinen Stuhl und klammert sich mit den Händen am Sitz fest. „Mein Gott!“, plärrt er. „Was wollen Sie denn bloß von mir? Ich werde wie ein Kriegsverbrecher behandelt!“
Ein verächtliches Lachen. „Damit haben sie gar nicht mal so Unrecht, Herr Hoffmann.“
„Was? Wie? Woher kennen Sie meinen Namen?“
„Bitte, Herr Hoffmann. Sie befinden sich nicht in der Position, um Fragen zu stellen.“
Robert sieht sich um. Bis auf ein paar Stühle und Tische, die wahllos verteilt sind, ist der Raum leer. Die Fenster sind von innen mit Brettern vernagelt. Ein staubiger, muffiger Geruch liegt in der Luft, und an der tiefen Decke hängen mindestens zehn Zitterspinnen.
„Ich bin Herr Zifer“, sagt der dünne Mann und versucht sich an einem Grinsen. „Und Sie sind Herr Hoffmann. So, jetzt kennen wir uns. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Sie wissen hoffentlich, was Sie getan haben?“
Robert schnauft erbost. „Na, hören Sie mal, wissen sie überhaupt, was Sie hier gerade tun?“
Zifer zieht seine dünnen, schwarzen Augenbrauen herunter. „Sie müssen nicht schreien. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Vielleicht kommen wir ja zu einer Lösung?“
„Wenn Sie mich nicht sofort gehen lassen, hau ich Ihnen in die Fresse!“
Zifer legt den Kopf schief und lacht. Das Lachen klingt so widerlich wie nasser Schlamm an den Füßen. „Nur zu. Vermöbeln Sie mich! Ein paar Jahre wegen Körperverletzung machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett!“ Schon wieder dieses Lachen.
Robert verzieht entnervt die Mundwinkel. Er dreht sich um und begutachtet die vernagelten Fenster, sucht nach einer Schwachstelle. Er reißt daran, er zerrt, aber die Bretter sitzen einfach zu fest. Er schlägt auf einen herausstehenden Nagel und heult laut auf.
„Völlig sinnlos“, sagt Zifer. Seine Brille spiegelt sich im Licht der Glühbirne. „Ich benutze diesen Raum seit mehreren Jahren, und bisher ist es niemandem gelungen, hier rauszukommen.“
Robert wirbelt herum, Tränen des Schmerzes und der Wut in seinen Augen. „Was, verdammt nochmal, wollen Sie? Ich hatte keine Fahrkarte dabei, na schön, gut, ich gebe es zu! Aber was Sie hier machen, ist einfach nur lächerlich!“
„Oh, ist es das?“, fragt Zifer und nährt sich bedrohlich. Seine Schuhe machen kein einziges Geräusch auf dem Boden. „Sie meinten eben, Sie werden hier wie ein Kriegsverbrecher behandelt. Das ist, wie gesagt, gar nicht mal so falsch. Wir führen einen Krieg gegen Leute wie Sie!“ Er schlägt mit der Faust auf den Tisch, der Raum verdunkelt sich kurz und wird wieder hell. „Menschen, die ohne Fahrausweis ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen und sich dann über die Konsequenzen wundern, wenn sie ertappt werden! Sind Ihnen Fahrkarten vielleicht nicht gut genug, Herr Hoffmann? Sagen Sie mir ihre Meinung, na los!“
„Es waren doch nur drei Stationen“, wimmert Robert. „Ich hatte es eilig!“
„Eilig!“ Zifer steigerte sich hinein. „Warum benutzen die Menschen für ihre Fehler immer die Ausrede, dass sie es gerade eilig hatten? Ist Eile eine Eigenschaft, die alle persönlichen Fehler ausgrenzt? Denken Sie das?“
„Warum machen Sie denn bloß so ein Theater deswegen? Ich bin einmal in meinem Leben schwarzgefahren, und das war ausgerechnet heute, na und?“
Zifer beruhigt sich. Er lacht sein ekliges Lachen und holt einen einzelnen Schlüssel aus seiner Hosentasche. „Erzählen Sie das nicht mir. Erzählen Sie es Toro.“
Robert wirft die Hände über den Kopf. „Wer oder was ist Toro?“
„Einer unserer besten Mitarbeiter“, erwidert Ziffer und fliegt durch den Raum. Mit einer wegwischenden Handbewegung lässt er ein paar Stühle nach links und rechts schieben. Dahinter kommt eine etwa einen Meter große Tür zum Vorschein. Sie ist aus altem Holz, ein merkwürdiges Zeichen, mit Kreide gemalt, ziert ihr Antlitz. Zifer dreht den Schlüssel und klopft dreimal gegen die Tür. Der Klang ist dumpf und bedrohlich. Irgendwo hinter dem alten Holz hört man ein tiefes Grunzen, das Robert an ein Hängebauchschwein erinnert, dass er mal im Zoo gesehen hat.
Die kleine Tür geht nach außen auf, langsam und knarrend. Aus der Dunkelheit blinzeln zwei gelbe Augen hervor. Dem folgt eine dickliche, behaarte Hand, die den Boden um die Tür herum abtastet. Es sieht so aus, als würde eine hässliche Maus nach einer Mausefalle suchen. Dann schickt sich die Kreatur an, vollständig aus ihrem Nest zu kriechen. Roberts Kinnlade fällt zu Boden.
Toro ist ein Mann von ungefähr hundertfünfzig Zentimetern; bebrillt und mit anfangender Halbglatze. Er trägt das völlig verwitterte und fast farblose Outfit eines normalen Bahnangestellten, dazu passend eine kleine Schaffner-Mütze. Nähte zwischen der Mütze und der Stirn lassen erahnen, dass die Mütze angenäht wurde. An seiner Brust hängt ein kaputtes Namensschild mit fehlenden Buchstaben: etlef Ko wal ky steht dort.
Robert ist außer sich. „Sagen Sie bloß, der lebt da drin! Das ist doch gegen alle Menschenrechte dieser Welt!“
„Ja, dieser Welt!“, sagt Zifer mit erhobenem Zeigefinger. „Außerdem interessieren wir Bahnangestellten uns nicht sonderlich für die Menschenrechte. Oder was sagst du dazu, Toro?“
„Chaos!“, schreit der kleine Mann und spuckt dabei einen gefühlten Liter Wasser auf den Boden.
Zifer tätschelt Toros Schulter. „Sie sehen, Toro ist ein gewissenhafter Angestellter. Wenn wir mal Probleme mit Leuten wie Ihnen haben, oder anderen Subjekten, die die Faszination Bahn nicht begreifen wollen, dann schicken wir Toro und alles wird wieder gut. Nicht wahr, Toro?“
„Chaos!“
Robert ist inzwischen zu einem Häufchen Elend geworden, das zusammengekauert auf seinem Stuhl hockt. Seine Nackenhaare stehen zu Berge, und es fehlt nicht mehr viel, bis er sich in die Hose machen würde. Ob groß oder klein, das hängt ganz allein von Toro ab. „W-W…“, stottert er. „W-Warum nennen Sie ihn denn bloß Toro?“
Zifer lächelt wie ein Mann, der an eine schöne Begebenheit aus seiner Vergangenheit erinnert wird. „Nun, Toro hat eine ganz spezielle Art, seine natürlichen Feinde – Sie, unter anderem – zu bekämpfen. Er drängt sie in eine Ecke, dann nimmt er Anlauf und stürmt mit seinem Kopf voran. Mich erinnert das an einen Stier, und Toro gefällt dieser Name auch, oder?“
„Chaos!“, schreit Toro und fängt an, gefährlich mit seinen kurzen, dicken Armen hin und her zu schaukeln. Er sieht aus wie ein Buchhalter, der sich die Tollwut eingefangen hat.
„Du hast Hunger, oder Toro? Na los, geh spielen. Herr Hoffmann wartet schon.“
„Was!?“, schreit Robert und klammert sich an seinem Stuhl fest. „Das kann doch unmöglich Ihr Ernst sein, ich… Oh mein Gott, was macht er denn da?“
Toro hat sich kerzengerade aufgestellt. Aus seiner Brusttasche holt er eine kleine Trillerpfeife hervor und bläst ordnungsgemäß hinein. Es ist ein kurzer, intensiver Ton. Toro geht in gekrümmte Haltung und beginnt, die Geräusche einer startenden Lokomotive nachzuahmen. Das klingt unheimlich routiniert. Toro ist wirklich ein gewissenhafter Mitarbeiter.
Robert springt auf. Mit zitternden Händen nimmt er den Stuhl und hält ihn hoch. Dabei sieht er aus wie ein Löwenbändiger in der Ausbildung. Toro scheint sich indes nichts aus dieser Abwehrhaltung zu machen. Er unterbricht sein Schnaufen und Pusten und springt aus dem Stand nach vorn. Robert schreit. Toro packt eines der Stuhlbeine und zieht. Die nervösen Finger von Robert sind machtlos. Der Stuhl fliegt durch die Gegend und zerschellt an der Wand in dutzende Einzelteile.
„Lass mich in Ruhe, du Scheißding!“, schreit Robert mit bebender Stimme. In seiner unfassbaren Verzweiflung greift er in seine Hosentasche und bewirft Toro mit seinem Kleingeld. Das Zwei-Eurostück prallt an Toros Brillenglas ab, Toro stößt ein wütendes Röhren aus. Robert läuft rückwärts und stößt mit dem Rücken gegen die kalte Wand. Er ist gefangen. In die Ecke gedrängt.
„So läuft das immer ab.“, sagt Zifer. Seine Stimme geht unter dem aggressiven Schnauben von Toro fast unter. „Aber ich muss zugeben, die Idee mit dem Kleingeld ist neu. Wie dem auch sei, ich hoffe, Sie haben endlich die Intensität ihres Fehlers begriffen, Herr Hoffmann! Sie sind nicht der erste und werden auch nicht der letzte sein, also nehmen sie es nicht allzu tragisch!“
Toro krümmt sich wieder, den Kopf auf Robert gerichtet. Seine Halbglatze glänzt im Schein der Glühbirne. Er sieht einen Stier tatsächlich nicht unähnlich.
„Nein!“, schreit Robert. Er kratzt an der Wand und bearbeitet sie mit Faustschlägen. Zifer wirft den Kopf in den Nacken und lacht hysterisch. Sein kleiner Schützling senkt den Kopf noch weiter, dann stürmt er los. Robert schreit und wirft sich zur Seite. Es gibt einen dumpfen, lauten Knall, als Toro seinen Kopf in der harten Steinwand vergräbt. Er steckt fest, seine Beine zappeln hin und her. Der Brustkorb hebt sich, als würden drei Herzen in diesem Körper schlagen. Ohne einen Gedanken zu verschwenden, greift Robert nach einem nahen Stuhl und zerschmettert ihn an Toros Rücken. Der gibt einen keifenden Schmerzlaut von sich und zappelt noch kräftiger.
„Sie Ungeheuer!“, kreischt Zifer. „Was fällt Ihnen ein!“
Robert wirft sich mit ausgestreckter Faust nach vorne. Er trifft Zifers linke Wange. Nur fühlt es sich nicht so an, als würde er einen Menschen schlagen. Und tatsächlich, der Kopf wird vom Rumpf gerissen, fliegt durch den halben Raum und trifft die Wand. Beim Aufprall ertönt ein zischender Laut, als würde man eine geschüttelte Dose öffnen. Dann löst sich der Kopf in schwarzem Rauch auf. Der restliche Körper Zifers fällt in sich zusammen.
„Chaos!“, schreit Toro in die Wand hinein, wütender denn je. Der Putz bröckelt, man hört nach und nach Risse aufplatzen, dann löst sich ein Stück der Wand einfach auf. Toro fällt nach hinten, überschlägt sich und bleibt benommen liegen. Jetzt oder nie, denkt Robert. Er sieht hereinfallendes Licht und sputet zum kleinen Loch in der Wand. Mit der Faust vergrößert er es, dabei sind ihm die Schmerzen völlig egal. Er tritt hinaus und bemerkt einen Obdachlosen, der sich das Schauspiel stirnrunzelnd von seiner Bank aus ansieht. Der Obdachlose formt mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis. Robert nickt und läuft davon.
Nach einer Stunde Fußmarsch, die er nicht durch die Bahn abkürzen wollte, erreicht Robert sein Haus. Kevin fragt ihn tausend Fragen, aber Robert winkt lustlos ab. Er geht unter die Dusche, seift sich immer und immer wieder ein, bis er glaubt, all der Dreck und das Unbehagen sind von seinem Körper verschwunden. Als er aus dem Bad kommt, stellt Kevin seine Fragen nochmal. Wo warst du? Wo ist die Gurke? Willst du denn gar nicht mit mir sprechen?
Egal. Mit ein paar Worten, die er aus sich herausquetschen muss, erklärt er seinem Mitbewohner, dass er – Robert – morgen vielleicht darüber reden wird. Er muss jetzt ins Bett. Sein Kopf arbeitet ohne Pause, aber sein Körper signalisiert alarmierende Schwäche. Er schließt die Tür seines kleinen Zimmers und stöhnt auf, als sein Rücken das Bett berührt. So liegt er da und betrachtet die Decke, will weinen, kann es aber nicht. Sein einziger, zusammenhängender Gedanke ist der, dass er sich in naher Zukunft ein Fahrrad kaufen wird. Die öffentlichen Verkehrsmittel hat er satt.
Das Fenster ist offen. Robert glaubt, das abwechselnde Pusten und Schnaufen einer Lokomotive zu hören. Natürlich fährt in dieser Gegend keine Lokomotive mehr. Es wird eine schlaflose Nacht.