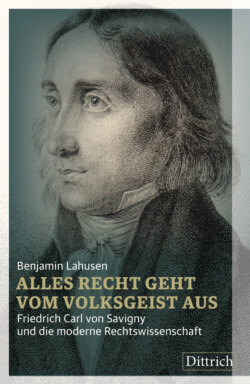Читать книгу Alles Recht geht vom Volksgeist aus - Benjamin Lahusen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеJuristen sind flüchtige Wesen. Sie leben von dem, was ihnen von fremder Hand gereicht wird, und müssen weiterziehen, sobald ihnen ihr Gönner die Gunst entzieht. Den Befehlen der Gesetze unterworfen, verliert ihr Handwerk Sinn und Ziel, wenn die politische Opportunität nach neuen Gesetzen verlangt. Das Wankelmütige, Pragmatische, Zufällige, das das politische Tagesgeschäft kennzeichnet, verdammt auch die Rechtsarbeiter zu einer unsicheren Existenz. Sie kleben an Ort und Zeit, an der zerklüfteten, kurzlebigen Welt, die heute so und morgen anders ist. Überzeitliches, Wahrhaftiges, Notwendiges muss man im Juristenwerk deshalb nicht suchen. Juristische Denkleistungen finden in der Gegenwart Anfang und Ende zugleich; ihr Wert zerfällt, sobald die Gegenwart zur Geschichte wird.
Das war nicht immer so. Es gab einmal eine Epoche, in der die Juristen davon träumen durften, ihre Arbeit über die Zeit zu retten, in der sie nicht bloß den Dienstweg an sein Ende verfolgen mussten, sondern selbst verbindliche, autonome, freie Rechtsgestaltung betreiben durften. Der Traum vom selbständigen Dasein des Rechts. Generationen von Juristen haben sich davon beseelen lassen. Aber keiner hat ihn mit solcher Inbrunst gelebt wie Friedrich Carl von Savigny. Unter seiner Führung begann ein Kampf um die Unabhängigkeit des Rechts, in dem sich die Juristen über ein gutes Jahrhundert hinweg die Vorrangstellung vor sämtlichen normativen Gegenkräften erarbeiteten. Das alte Naturrecht mit seiner tiefen Verwurzelung in einer materialen Ordnungsphilosophie wurde endgültig beseitigt. Die aufgeklärten Entwürfe des neueren Vernunftrechts, bis dahin getragen von einem unerschütterlichen Vertrauen in die Regelungsweisheit der menschlichen Ratio, versanken neben dem neuen Juristenrecht in ein düsteres Zwielicht. Der Drang zu politischer Veränderung, der seit der Französischen Revolution immer ungestümer auch auf Preußen übergegriffen hatte, lief in Savignys Reich ins Leere, weil ihm die Zuständigkeit in Rechtsfragen kurzerhand entzogen wurde. Die sich jeder Neuerung verweigernde altständische Gesellschaft erhielt schließlich ein behutsames Modernisierungsprogramm, das den Gesellschaftsaufbau im Wesentlichen unangetastet ließ, gleichwohl die Voraussetzungen für den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus schuf. Auf all diesen Gebieten, im Kampf gegen Philosophie, Moral, Vernunft, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, eroberte Savigny dem Recht die grundsätzliche Selbständigkeit gegenüber konkurrierenden Ordnungsvorstellungen.
Dies gelang, weil Savigny dem Rechtsstoff eine eigene, historisch begründete Rationalität implantierte. Das Recht konnte nur aus sich selbst heraus begriffen werden, weil es, so Savigny, über Jahrtausende in allmählichem Wachstum herangereift war und in diesem organischen Werden nicht einfach durch fremde Anmaßungen gestört werden durfte – eine Rückbesinnung auf die Rechtsgeschichte, die in ihrem tiefsten Innern vom Begriff des Volksgeistes zusammengehalten wird: Die Zeitalter, denen Savigny die größte Bewunderung entgegenbringt, sind die, in denen das Recht sich unterschwellig, selbstbestimmt, wie Sprache, Sitte und Gebräuche entwickeln und dadurch eine besonders enge Verbindung zu Charakter und Wesen eines Volkes halten konnte. In der ganzen Menschheitsgeschichte findet sich freilich nur eine einzige glückliche Epoche, die sich einer solch hochstehenden Jurisprudenz rühmen darf: die Zeit des römischen Prinzipats zwischen dem 1. und dem 3. nachchristlichen Jahrhundert.
Die Besinnung auf das geschichtliche Reifen des Rechts dient deshalb vor allem einer Revitalisierung des römischen Rechts. Savignys wissenschaftliches Lebenswerk kreist um den groß angelegten Versuch, das Fortdauern einer Traditionslinie zu beweisen, die das römische Recht ohne Unterbrechung vom römischen Reich bis in die Gegenwart transportiert habe und daher noch immer eine tragfähige Grundlage für ein modernes Rechtssystem abgebe. Antikes Recht für eine neue Zeit. Gesetzgeberische Eingriffe verträgt dieses Vorhaben nur in ganz geringem Umfang. Was Savigny als historische Schule der Rechtswissenschaft zusammenführt, ist deshalb sehr viel mehr als nur ein akademisches Programm. Der Volksgeist verlangt eine Wiederbelebung und erneute Durchdringung des römischen Rechtsstoffes und muss aus diesem Grund alle anderslautenden Zukunftsvisionen als unwissenschaftlich zurückweisen – seien sie nun feudaler, demokratischer, liberaler oder gar revolutionärer Art. Das Recht kehrt zurück zu den eigenen Wurzeln. Die Begründungsdiskurse, warum juristische Entscheidungen so und nicht anders ausgefallen sind, benötigen immer weniger Anregungen von außen. Aus der eigenen Systemarbeit ergibt sich eine solche Fülle von Gedanken, dass auch ohne fremde Unterstützung jede Gefahr einer Argumentationsnot gebannt ist.
Damit aber befreien sich die Juristen von ihrem lange so kläglich akzessorischen Dasein. Das subalterne Befehlsempfängertum gehört der Vergangenheit an. Rechtsarbeit ist nicht länger bloßes Anhängsel übergeordneter Mächte, sie tritt selbstbewusst mit eigenen Gestaltungsansprüchen hervor. Eine Verschiebung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse muss diese Jurisprudenz genauso wenig fürchten wie eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. Weil Recht nur aus der Rechtsgeschichte verstanden werden kann und weil diese Rechtsgeschichte seit Jahrtausenden von Juristen betrieben wird, erschließen sich die Rechtsprobleme der Gegenwart nur denjenigen, die mit der Genese des Juristen-Rechts vertraut sind. Juristen-Recht ist Juristen-Sache. Der Bürger wird zum Laien, der Souverän zum Störer; unter der Ägide des Volksgeistes verabschiedet sich das Recht vom Volk.
Seit dieser Zeit heißt die Jurisprudenz Rechtswissenschaft. Der Rechtsstoff selbst trägt in sich die kondensierte Rationalität ganzer Juristengenerationen; sein historisches Wachstum birgt für eine innere Wahrheit, die mit kundigen Griffen zu einem eigenständigen Rechtssystem ausgebaut werden kann. Das Beispiel macht Schule. Ausgehend von Savignys Vorarbeiten übernimmt die deutsche Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert eine Vorbildfunktion auf dem ganzen Kontinent. Auf den dogmatischen Entdeckungen, die dabei zutage gefördert werden, ruhen alle späteren Errungenschaften. Recht wird gesammelt, gesichtet und sortiert, bis daraus ein widerspruchsfreies, lückenloses System geformt ist, genauso freischwebend und selbstreguliert wie die großartige römische Jurisprudenz mehr als eineinhalb Jahrtausende zuvor. Am Ende des Jahrhunderts ist es so weit. Das heutige römische Recht, das Savigny der Welt angedient hat, wird in generationsübergreifender Kommissionsarbeit in Gesetzesform gegossen. Aus der Vergangenheit des Rechts geschöpft, steht nun ein Gesetzbuch da, das kommenden Zeitaltern den Gang in die Geschichte auf ewig abschneiden wird: das Bürgerliche Gesetzbuch. Am 1. Januar 1900 tritt das neue Werk in Kraft und bringt damit Savignys Jahrhundert, das Jahrhundert der Jurisprudenz, zu einem glanzvollen Abschluss: eine eindrucksvolle Summe deutscher Rechtsgelehrsamkeit, die weltweit Bewunderer und Nachahmer findet.
In der Heimat dagegen löst das juristische Meisterstück merkwürdig kühle Reaktionen aus. Seine technische Finesse, seine unbestechliche Präzision, seine strenge Abstraktion finden die lobende Anerkennung des kundigen Publikums, aber nicht die Zuneigung der breiten Massen. Zu kalt sind die Insignien der Wissenschaft, die das BGB trägt. Dem bürgerlichen Recht fehlt das staatsbürgerliche Pathos. Dem gewöhnlichen Bürger muss es wie eine sture Aneinanderreihung technischer Details erscheinen, in der, wer berufsmäßig nicht dazu gezwungen ist, weder lesen kann noch überhaupt nur soll. Aber auch die Juristen entwickeln keine rechte Leidenschaft für ihr neues Arbeitsinstrument. Im Lichte des BGB finden sie sich alsbald in ein langwährendes Prekariat versetzt. Die freie Rechtswissenschaft, die das 19. Jahrhundert ausgezeichnet hat, weicht nun einer Alltagsroutine, in der Juristen ihre Gesetze nicht mehr offen selbst produzieren können, sondern ihrer Freiheit im Rahmen des Gesetzesauslegung ein rhetorisch unauffälligeres Korsett anlegen müssen. Die einstigen Herrscher werden zu Schattenmännern.
Juristen sind flüchtige Wesen, als Menschen noch mehr denn als Rechtsarbeiter. Ein Leben, dessen Werk im Dienste der Vergänglichkeit steht, interessiert noch weniger als seine ephemeren Hinterlassenschaften. Wieder ist es Savignys Erscheinung, die als Ausnahme heraussticht. Seit seinen ersten Tagen als Rechtslehrer übt er auf seine Umwelt eine Anziehungskraft aus, die ihn weit über Juristenkreise hinaus zum bewunderten Intellektuellen werden lässt. Zu seinen Schülern gehören Jacob und Wilhelm Grimm, eine enge Freundschaft verbindet ihn mit Bettina von Arnim und Clemens Brentano, er steht in Austausch mit Johann Wolfgang von Goethe und Wilhelm von Humboldt. Die Gedankenwelt der Romantik hat nicht nur zufällige Spuren in seinem Werk hinterlassen. Aber bestimmend für sein Schaffen bleiben andere Einflüsse. Die Herkunft aus aristokratischem, wohlhabendem, staatstragenden Elternhaus erweist sich als zu prägend, um die Vorboten eines neuen Zeitalters, die sich nach den Befreiungskriegen auch in Preußen zeigen, mit einer liberalen, demokratischen Rechtslehre zu unterstützen. Savigny zieht sich auf die wissenschaftlichen Gefilde der Rechtsgeschichte zurück, um der Politik der Reformkräfte seine eigene Politik entgegensetzen zu können – ein Aristokrat an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert, der die Forderungen der Neuzeit mit den scheinbar neutralen Mitteln der Wissenschaft bekämpft.
In Savignys privilegiertem, elitären Leben ist viel von dem angelegt, was die Verwaltung der Gerechtigkeit bis heute zu einer privilegierten und elitären Angelegenheit macht. Niemand hat die Art und Weise, wie in Deutschland über das Recht gedacht und geschrieben wird, so beeinflusst wie er. Sein Name steht für die Anfänge einer Selbstbegründung des Rechts, die zum Signum der modernen Rechtswissenschaft schlechthin werden sollte. Aber die Bedingungen, unter denen Savigny am Beginn des 19. Jahrhunderts eine eigenständige Wissenschaft vom Recht etabliert hat, können nun, gut zweihundert Jahre später, kaum mehr dieselben sein. Sein Leben und sein Werk geben deshalb Anlass, den Weg des Rechts von einem untergeordneten Dienstleistungsbetrieb hin zu einer autonomen Disziplin erneut abzuschreiten. Nicht alle Richtungsentscheidungen, die Savigny getroffen hat, führen in die Moderne, auch sein Schaffen enthält flüchtiges Beiwerk. Aber wer sich in Savignys Erbe auf die Suche nach dem Bleibenden neben dem Vergänglichen macht, darf sich eine nachhaltige Vergewisserung über den Zustand des gegenwärtigen Rechtsbetriebs versprechen. Dem dienen die folgenden Kapitel.