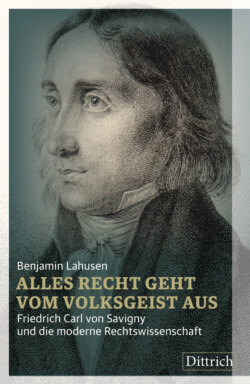Читать книгу Alles Recht geht vom Volksgeist aus - Benjamin Lahusen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wanderer
ОглавлениеAuf einer der ersten Stationen der Reise, Gut Lengfeld im Odenwald, trifft Savigny auf Karoline von Günderrode. Sie ist ein Jahr jünger als er, gleichfalls früh verwaist und hat wie Savigny einzelgängerische Neigungen, die sie jedoch auf andere Weise als er verarbeitet: Sie schreibt, leidenschaftliche, träumerische Gedichte. Savigny hinterlässt einen tiefen Eindruck bei ihr, liebevoll beschreibt sie seine »zauberischen« Augen, seinen »wunderbaren Kopf« und »den sanften Schmerz, den sein ganzes Wesen ausdrückt«.6 Die beiden tauschen einen flüchtigen Kuss, aber als es Zeit wäre, sich zu erklären, schweigt Savigny lange und fragt dann verlegen nach dem Wohlergehen von Karolines Bruder. Auch wenn Savigny sich nach seiner Abreise sogar bei Freunden über die »häuslichen Verhältnisse, Kindererziehung pp.« der Familie Günderrode erkundigt,7 bleibt er zu Karoline letztlich auf sicherer Distanz. Sein Innenleben hält er lieber verschlossen. Diese Zurückhaltung in persönlichen Dingen zeichnet sein ganzes Naturell aus; die Freunde bewundern Savignys »scharfsinnige, besonnene, gewandte, erfindsame […] Hermesnatur«, aber sie vermissen an seinem Wesen das »italienische Colorit«, jene »begeisterte und begeisternde Seligkeit, welche, das Leben verschönernd, dennoch den Tod liebt«.8 Leidenschaften, Abenteuer, Unwägbarkeiten sind seine Sache nicht.
Der verliebten Günderrode empfiehlt Savigny abschließend mit altväterlicher Verbindlichkeit, sie solle »das rechte Verhältnis der Selbständigkeit zur Hingebung« suchen.9 Was immer das heißen mag: Mit den Abgründen der jungen Dichterin will er nichts zu tun haben. Diese fühlt deutlich, »wie weit ich von dem Ideal entfernt bin, daß sich ein S. erträumen kann«;10 was von ihm in ihrem Leben bleibt, ist nicht mehr als »der Schatten eines Traumes«.11 Ein Gedicht der Günderrode erinnert an die schmerzliche Episode: »Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht, / Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten, / Komm, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten, / Daß neue Wonne meine Lippe saugt.« Der Tag bringe ihr keine Freuden, erst in den nächtlichen Träumen finde sie »süßen Balsam«. »Drum birg’ dich Aug’ dem Glanze irdscher Sonnen! / Tauch Dich in Nacht, sie stillet Dein Verlangen / Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluthen«, schließt die verzweifelte Dichterin, nicht ohne dem Angebeteten das Gedicht mit dem Zusatz zu übersenden: »Solche Dinge träumt das Günderrödchen, und von wem? Von jemand, der sehr lieb ist und immer geliebt wird.«12
Aber Savigny liebt nicht zurück. Vom Treffen im Odenwald zieht er weiter und reist ein gutes Jahr durch Deutschland; er kommt nach Fulda, Wartburg, Gotha, trifft Jean Paul in Eisenach, besucht Christoph Martin Wieland in Oßmannstedt, wo auch dessen Jugendfreundin Sophie von La Roche zugegen ist, über die Savigny kurz darauf mit deren Enkeln Clemens und Christian Brentano zusammenkommt – »eine der schicksalhaften Begegnungen des Zeitalters der Romantik«,13 die zu einer engen Freundschaft zwischen Savigny und Clemens führt. Zwischendurch arbeitet Savigny sich durch die Bibliotheken von Weimar, Leipzig, Jena und Halle, sichtet alte Drucke, sammelt Handschriften, begutachtet den Stand seiner Wissenschaft. Als er im August 1800 nach Marburg zurückkehrt, hat er bereits den Stoff für eine Dissertation im Gepäck, die er in wenigen Monaten fertigstellt. Und irgendwo auf dieser Reise muss der Entschluss zur endgültigen Reife gelangt sein, auf die höchsten Staatsämter, die Herkunft und Begabung in Aussicht gestellt hatten, einstweilen zu verzichten und stattdessen – gegen den dringenden Rat der Freunde – die Wissenschaft zum Beruf zu machen. Damit ehrt Savigny den Professorenstand auf bis dahin unbekannte Weise. In den Staatsämtern des Ancien Régime hatte sich der Adel in der Regel wohler gefühlt als an der Akademie. »Ein Wunder« nennt es Goethes Wilhelm Meister 1796, »wenn ein Mann von Geburt sich den Wissenschaften widmete«.14 Aber Savigny will mehr als nur ein Wunder vollbringen. »Ein Reformator der Jurisprudenz, ein Kant in der Rechtsgelehrsamkeit zu werden«, das sei sein Plan, so schildern Freunde seine begeisterte Ankündigung.15
Und er macht sich gleich an sein grundstürzendes Werk. In Marburg beginnt er eine Lehrtätigkeit, die seine Zuhörer schon wegen ihrer intellektuellen Brillanz unweigerlich fesselt, dazu kommt seine imposante, großgewachsene Erscheinung und das schulterlange Haar. Zu seinen ersten Studenten gehören Jacob und Wilhelm Grimm, die bald eine grenzenlose Verehrung für Savigny entwickeln. »Dieses lehrenden Mannes freundliche Zurede, handbietende Hülfe, feinen Anstand, heiteren Scherz, freie, ungehinderte Persönlichkeit kann ich nie vergessen«, schwärmt Jacob von dem kaum älteren Lehrer,16 dem er brieflich offen bekennt: »Ich werde Sie immerfort lieb haben.«17 Die Deutsche Grammatik, die Jacob 1819 erstmals vorlegt, widmet er dem bewunderten Meister. Und Wilhelm notiert: »Ich würde ohne Bedenken mein ganzes Leben in seine Hände legen. […] Sein Muster muntert mich auf, es macht aber auch mutlos, weil man es nicht erreichen kann.«18 Diese letzte Einschätzung ist durchaus zutreffend – bis heute unerreicht geblieben ist das erste Werk, das der Dozent Savigny 1803 vorlegt: Das Recht des Besitzes, das den 24-Jährigen an die Spitze der deutschen Privatrechtswissenschaft setzt und ihn zudem zum außerordentlichen Professor in Marburg macht.