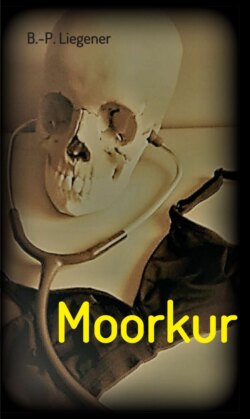Читать книгу Moorkur - Bernd-Peter Liegener - Страница 8
Оглавление2. Kapitel
Die Stationsschwester
Station vier. Fabert hatte ihnen den Weg zur Station beschrieben und die diensthabende Schwester über das Haustelefon von ihrem Kommen unterrichtet. Eine bis zur Decke reichende Glasscheibe ließ das Schwesternzimmer wie eine überdimensionierte Pförtnerloge erscheinen. Saß jemand am Schreibtisch, konnte er oder sie jeden kommen und gehen sehen, denn es lag gleich als erster Raum ganz am Anfang des Stationsflures. Jetzt saß Schwester Annegret dort und bewachte ihre Patienten wie ein Drache seinen Goldschatz. Sie nickte ihnen mit ernstem Gesicht zu. Genau genommen wirkte das Gesicht so, als sei es immer ernst. Sogar die aschblonden Haare waren streng nach hinten gekämmt und am Hinterkopf zu einem Dutt zusammengebunden. »Kommen Sie herein«, begrüßte sie sie, nachdem sie aufgestanden war und ihnen die Tür geöffnet hatte. »Dort im Aufenthaltsraum können wir ungestört reden.« Sie griff sich eine Akte aus dem Hängeregister eines hüfthohen Rollwagens und folgte ihnen durch die zweite Tür in ein Zimmerchen, das gerade genügend Platz bot für einen Tisch mit sechs Stühlen, einen Kühlschrank, eine schmale Spüle und eine Ablage mit der in jedem Aufenthaltsraum unvermeidlichen Kaffeemaschine. Sie holte drei Kaffeebecher aus einem Hängeschrank, wobei sie sich mächtig recken musste, denn ihre Körpergröße unterschritt deutlich das Standardmaß für nach Kaffeebechern greifende Stationsschwestern einer Rehaklinik.
»Für mich keinen Kaffee, bitte«, lehnte König etwas zu spät ab. Martina hatte nichts anderes erwartet, da sie die Abneigung ihres Chefs gegen Kaffee kannte.
»Tee, Wasser, Orangensaft?« Schwester Annegret klang wie die Stewardess eines voll besetzten Flugzeugs in der Touristenklasse.
»Wasser, bitte! Wenn es geht, mit Sprudel, danke!« Ein abermaliges Recken der zu kurz geratenen Flugbegleiterin. »Und Sie? Milch, Zucker?«
»Schwarz, danke!« Einen Moment lang schauten sie alle drei einander ins Gesicht, während sie den ersten Schluck nahmen. Dann nahm die Stationsschwester die Akte zur Hand, lehnte sich zurück und öffnete sie auf ihren übereinander geschlagenen Beinen. Sportlichen Beinen für eine sicher sechzigjährige Frau, fand Martina, mit unbequem eleganten Schuhen. Schlecht für jemanden, der den halben Tag auf den Beinen sein musste.
»Elisabeth Salach, 34 Jahre. Alleinstehend, das heißt ledig und, soweit wir wissen, keine Kinder. Einen nächsten Angehörigen hat sie nicht angegeben. Sie kam aus Salzgitter, Beruf Sachbearbeiterin. Über ihre gesundheitliche Situation darf ich Ihnen wegen der Schweigepflicht keine Auskunft geben. Zumindest weiß ich das nicht genau. Deshalb würde ich Sie bitten, sich mit Doktor Deinberg in Verbindung zu setzen, wenn das interessant für Sie ist. Er ist der Stationsarzt.«
Der Kommissar nahm noch einen Schluck Selterswasser. Für Martina war das ein Zeichen, dass sie die Befragung durchführen sollte. »Und so als Mensch, ganz unmedizinisch? Wie war Frau Salach als Mensch?«
Annegret verschränkte ihre Arme über der Akte. »Sie fragen mich also nicht als Schwester, sondern als Privatperson. Was ich dann antworte, wird aber sehr subjektiv sein.« Sie fasste den Kommissar in den Blick, der unauffällig sein Notizbüchlein geöffnet hatte. »Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie es nicht mitschreiben würden.« Das Büchlein klappte zu, eine Polizistenhand hob sich abwehrend und entschuldigend wie zum Schwur, dass nichts von dem Gesagten jemals woanders wiedergegeben werden würde. Die Schwester war zufrieden. Zum Glück ahnte sie nichts von dem kleinen Aufnahmegerät, dass die sie befragende Beamtin in ihrer Jackentasche trug. Über dieses nicht ganz korrekte Vorgehen hatte Martina sich schon einmal mit Karl auseinandergesetzt. Genau genommen mit Kommissar König, denn damals duzten sie sich noch nicht. Und verboten hatte er es ihr nicht.
»Danke! Als Privatperson bin ich in erster Linie eine Frau. Von einem Mann würden Sie vielleicht etwas völlig anderes erzählt bekommen. Aber als Frau mag man solche anderen Frauen nicht. Frau Salach war sehr attraktiv und wusste das auch. Ich weiß gar nicht einmal, ob ich sie hübsch nennen würde, aber auf Männer wirkte sie wie ein Magnet, der ihre Herzen mit unwiderstehlicher Kraft anzog. Nun ja, vielleicht auch andere Körperteile. Nicht, dass ich ihr ihre Liebschaften nicht gegönnt hätte, aber es war einfach kränkend, dass man in ihrer Gegenwart von Männern gar nicht mehr wahrgenommen wurde. Jedenfalls nicht als Frau.«
»Frau Salach hatte auch hier in der Klinik Liebschaften? Könnten Sie uns sagen, mit wem sie zusammen gewesen ist?«
»Das ist natürlich schwierig. Wir sehen unsere Patientinnen ja fast nur auf der Station. Mal auf dem Flur, mal im Aufenthaltsraum da hinten. Man trifft sich mal in der Kantine oder wenn man eine rauchen geht. Oder auf dem Weg zum Feierabend. Natürlich hört man etwas von Kolleginnen und Kollegen, aber das sind nur Gerüchte.«
»Wir interessieren uns in Mordfällen sehr für Gerüchte. Das Körnchen Wahrheit, das manchmal in ihnen steckt, kann sich zu einem von vielen Mosaiksteinchen entwickeln, die schließlich ein vollständiges Bild ergeben, selbst wenn es etwas unscharf ist.« Sie fand ihre Metapher nicht wirklich stimmig, aber die Botschaft war angekommen.
»Einverstanden, dann kosten Sie einmal ein wenig von dem Süppchen, das die Gerüchteküche da gekocht hat. Ich kann Ihnen drei Löffel anbieten: Als erstes war da Herr Torwege von unserer Station. Vielleicht ein bisschen zu alt für sie, aber ein sehr charmanter Mann. Elegant, gebildet und vermutlich auch noch reich. Sie wissen, dass das einen Mann attraktiv machen soll, oder? Ich mochte ihn gern, den Herrn Torwege. Er war immer nett, höflich und zuvorkommend. Ich weiß zwar nicht, ob und wie die beiden sich getroffen haben, aber diesen Löffel würde ich bedenkenlos schlucken. Er ist aber schon vor zwei Wochen abgereist, und dann kam der nächste Kandidat: Andi Hufner. Das ist einer unserer Physiotherapeuten. Der ist nun wieder eigentlich zu jung für sie, aber er ist ein wirklich schmuckes Kerlchen und steht im Ruf, nicht nein zu sagen, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit ergibt. Als letztes wäre dann noch Doktor Göllner zu erwähnen, unser Oberarzt. Der hat einen ähnlichen Ruf wie Andi und würde auch vom Alter gut zu ihr passen, aber er ist verheiratet und außerdem eben Oberarzt. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich nichts über ihn gesagt haben will.«
»Keine Sorge, das bleibt natürlich unter uns. Kann es sein, dass sie sich mit einem von Ihnen gestritten hat?«
»Da bin ich nun wirklich überfragt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass irgendwann einmal jemand ein böses Wort zu ihr gesagt hat.«
»Außer den Frauen, nehme ich an.«
»Nein, niemand. Sie sind sicher zu jung und hübsch, um das je erfahren zu haben, aber wenn sich eine Frau von einer anderen herabgesetzt fühlt, spricht sie nicht mit ihr, sondern über sie. Das sind die Gerüchte, von denen wir gerade geredet haben. Mit einer Mitpatientin hat sie sich übrigens richtig gut verstanden. Frau Barsdorff. Monika Barsdorff. Auch hier von der Station. Die beiden habe ich oft zusammen gesehen. Sie passten auch gut zueinander. Der gleiche Typ, wissen Sie? Blond, schick, männermordend.«
»Na, ob mordend der passende Begriff für eine Ermordete ist, scheint mir doch eher zweifelhaft.« Sie schaute zu Karl, weil sie seine Vorliebe für Wortspiele kannte.
»Wer zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um. Wäre doch schon passend«, nahm er die Stationsschwester in Schutz.
»Oh! Müsste sie dann nicht mit Moor um sich geschmissen haben?«
»Nein, wenn ich Sie richtig verstanden habe«, er wandte sich Schwester Annegret zu, »wäre die Dame sich für eine Schlammschlacht zu fein gewesen, oder?«
»Das haben Sie gut getroffen. Sie trug ihre Nase immer ein Stückchen höher als alle anderen. So wenig, dass man es nicht sehen, sondern nur fühlen konnte. Das gleiche gilt übrigens auch für ihre Freundin, Frau Barsdorff.« Sie zögerte einen Moment. »Ich fürchte, ich bin jetzt ein wenig zu sehr Privatperson gewesen, aber ich hoffe, ich habe Ihnen damit weitergeholfen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder Stationsschwester zu werden. Was ich jetzt noch tun kann, ist, Doktor Deinberg hinterherzutelefonieren, um zu sehen, wann er mit Ihnen sprechen kann.« Sie konnte doch lächeln!