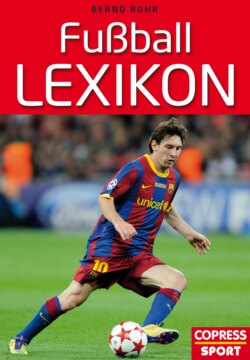Читать книгу Fußball-Lexikon - Bernd Rohr - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеA
Aachen, Dtl. (Stadt in Nordrhein-Westfalen); Alemannia Aachen, eigtl. „Aachener TSV Alemannia“ (Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900), gegr. am 16. Dezember 1900 als FC Alemannia Aachen, 1919 Fusion mit Aachener TV 1847 zu TSV Alemannia Aachen, seit 1924 Aachener TSV Alemannia; Bundesliga 1967-70; Bundesliga 2006/07; Zweite Bundesliga 1981–90, 1999–2006, 2007–12; Spielkleidung: Gelb-Schwarz/Schwarz/Gelb-Schwarz; Spielort: Sportpark Soers; Stadion: Tivoli, 32 960 Plätze. – INTERNET: www.alemannia-aachen.de
Spieler (Auswahl): T. Achenbach – D. Adlung – R. Albarus – S. Allagui – H. Altenkamp – T. Arslan – B. Auer – H. Balke – C. Bashi – D. Baumanns – V. Beara – K.-H. Bechmann – W. Bergstein – W. Bertrams – S. Blank – A. Bluhm – A. Brandts – C. und F.-J. Breuer – F. Bruns – L. Bunk – J. Burjan – N. Buschlinger – M. Casper – R. Claessen – H. Clute-Simon – H. Coenen – J. Daniel – M. Daun – J. Derwall – M. Dörmann – W. Dramsch – D. Dziekanowski – M. Ebbers – M. Feinbier – D. Ferl – C. Fiél – F. Frenken – T. Frings – A. Glenski – W. Goffart – D. Grabotin – T. Gries – I. Grlić – H. Gronen – J. Gruber – E. Gummer – R. Gunesch – W. Habich – E. Hach – K. Härtel – H. Heeren – W. Heinrichs – T. Hengen – E. Hermandung – P. Hermann – V. Herr – N. Herzig – E. Hoffmann – M. Höger – D. Hohs – L. Holtby – V. Ibišević – F. Jansen – K.-H. und M. Jensen – J. Kapellmann – J. Kau – H.-J. Kehr – M. Kienle – A. Klitzpera – H.-G. Klostermann – R. Köhnen – H.-J. Koitka – W. Kölling – W. Krämer – K. Kratz – W. Kraus – H. Krisp – R. Kucharski – P. Lagerblom – S. Lämmermann – W. Landgraf – T. Laumann – M. Lehmann – A. Lenz – J. Löring – J. Martinelli – E. Meijer – H. Metzen – K. Michalke – P. Milchraum – K.-H. Mödrath – J. Montanes – C. Moritz – L. Müller – R. Münzenberg – J. Nelles – S. Németh – F. Neußl – W. Nievelstein – P. Notthoff – D. Odonkor – S. Olajengbesi – B. Olck – R. Pawellek – M. Pfeiffer – K. Pflipsen – S. Pinto – R. Plaßhenrich – J. Polenz – G. Prokop – S. Radjabali-Fardi – S. Radu – B. Rauw – L.-A. Reghecampf – W. Reuter – G. Richter – S. Rolfes – S. Rösler – M. Roßbach – H. Schiffer – J. Schlaudraff – C., F., G., H. und J. Schmidt – W. Scholz – H. Schulz – B. Schütt – J. Seitz – K.-H. Sell – B. Sibum – M. Sichone – K.-D. Sieloff – D. Simmes – T. Stehle – H. Stephan – Z. Stieber – S. Straub – T. Stuckmann – G. Šukalo – J. Thelen – W. Thiede – B. Trares – H. Troche – E. Vanderbroeck – M. von Ahlen – H. Vukovic – C. Walter – J. Wesché – J. Wicke – H. Willms – R. Yabo – T. Zdebel – B. Zebec – M. Zimmermann – K. Zolper – J. Zschau. – Trainer (Auswahl): E. Ahmann – G. Baumann – J. Berger – G. Buchwald – H. Buhtz – S. Cendic – M. Denizli – S. Emmerling – F. Engel – D. Ferner – M. Frontzeck – W. Fuchs – F. Funkel – R. Grünther – E. Hach – W. Hannes – J. Hartmann – D. Hecking – T. Hengen – H. Hoffmann – P. Hyballa – G. Knöpfle – E. Krautzun – W. Kronhardt – H. Kronsbein – M. Krüger – H. Lindemann – P. Neururer – O. Pfau – M. Pfeiffer – G. Prokop – B. Sarosi – J. Seeberger – G. Stollenwerk – B. Thomas – G. vom Bruch – W. Weth – L. Wieder – H. Witzler.
| Alemannia Aachen: Erfolge (Auswahl) (West-)Regionalligameister 1964, 1967 (West/Südwest-)Regionalligameister 1999 Mittelrheinmeister 1989*, 2004 Mittelrheinpokal 1997, 1999, 2002*, 2006* * Amateure bzw. II. Mannschaft |
Aalborg (auch Ålborg), Dänemark (Stadt in Nordjütland); Aalborg BK, eigtl. „AaB“ (Aalborg Boldspilklub A/S), gegr. am 13. Mai 1885 als Aalborg Cricketclub, seit 1899 AaB; Spielkleidung: Rot/Weiß/Rot; Spielort: Ebeltoft Idrætscenter; Stadion: Energi Nord Arena, 13 800 Plätze. – INTERNET. www.aabsport.dk
Spieler (Auswahl): E. Andersen – T. Augustinussen – M. Beauchamp – B. Berisha – K. Bøgelund – Cacá – J. Curth – J. Grønkjær – C. Jacobsen – H. Jensen – M. Lindström – P. Möller – J. Nielsen – S. Nomvethe – A. Olesen – A. Oper – R. Prica – B. Priske – M. Rasmussen – M. Saganowski – S. Solbakken – F. Winsnes – R. Würtz – I. Zelinski. – Trainer (Auswahl): P. Andreasen – H. Backe – E. Hamrén – A. Kuhn – S. Piontek – B. Rioch – P. Rudbæk – L. Søndergaard.
| Aalborg BK: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1995, 1999, 2008 Landespokal 1966, 1970 |
Aalen, Dtl. (Stadt in Württemberg); VfR Aalen (Verein für Rasenspiele Aalen), gegr. am 8. März 1921; Dritte Liga 2008/09, 2010–12; Spielkleidung: Weiß-Blau/Weiß/Weiß; Spielort: Rohrwang; Stadion: Scholz-Arena, 11 169 Plätze. – INTERNET: www.vfraalen.de
Spieler (Auswahl): C. Alder – K. Andersen – B. Barg – D. Bernhardt – M. Bochtler – S. Cescutti – M. Christ – C. da Silva – A. Fink – D. Hillebrand – D. Hoeneß – A. Hofmann – M. Hohn – C. Holzer – D. Kempe – S. Kohn – Leandro – R. Lechleiter – T. Linse – B. Maier – M. Marić – A. Mayer – M. Metzelder – M. Oelkuch – B. Okic – R. Okle – M. Sailer – T. Scheuring – M. Schiele – J. Schmiedel – M. Sichone – M. Steegmann – M. Stickel – A. Sulu – T. Traub – S. Traut – M. Welm. – Trainer (Auswahl): H. Dietterle – W. Entenmann – R. Hasenhüttl – J. Kohler – W. Modick – P. Sander – R. Scharinger – E. Schmitt – F. Wormuth – P. Zeidler.
| VfR Aalen: Erfolge (Auswahl) (Süd-)Regionalligameister 2010 Baden-Württemberg-Meister 1999 Württembergischer Meister 1980, 1983 Württembergischer Pokal 1972, 1979, 1986, 2001, 2002, 2004, 2010 |
Aalesunds FK, Norwegen: → Ålesund.
Aarau, Schweiz (Hauptstadt des Kantons Aargau); FC Aarau (Fußballclub Aarau), gegr. am 26. Mai 1902; Spielkleidung: Schwarz-Rot/Weiß/Schwarz-Rot; Spielort: Suhr; Stadion: Brügglifeld, 14 000 Plätze. – INTERNET: www.fcaarauag.ch
Spieler (Auswahl): H. Bäni – A. Bilibani – R. Böckli – E. Brabec – O. Brändli – M. Braun – A. Bühler – F. Burgmeier – S. Burki – S. Christ – S. Ćirić – M. Colomba – D. Degen – P. de Napoli – R. di Matteo – M. Eggimann – K. Elsener – O. Fehlmann – P. Fischbach – E. Flückiger – W. Frank – D. Gygax – M. Heldmann – C. Herberth – H. Hermann – A. Hilfiker – E. Hochstrasser – E. und O. Hürzeler – O. und W. Imhof – G. Inler – K. Jörg – M. Kavelashvili – O. Kiehm – B. Kilian – F. Kioyo – A. Knup – R. Komornicki – U. Kühni – L. Lunde – A. Maier – K. und O. Märki – C. Matthey – A. Mitreski – H. und W. Müller – M. Mutsch – C. Okpala – W. Olk – D. Opango – S. Opoku N’ti – R. Osterwalder – E. Pogatetz – R. Ponte – Ratinho – J. Roomberg – A. und E. Rubli – W. Rufer – H. Schär – G. Sermeter – C. Sforza – E. Sigg – A. Stiel – M. Stoll – R. Sutter – T. Tschuppert – R. van der Gijp – H. von Arx – M. Walker – R. Wehrli – G. Wernli – A. Wydler – C., D. und T. Wyss – D. Zdrilic – P. Zuberbühler. – Trainer (Auswahl): M. Andermatt – A. und C. Beck – E. Bürgler – S. und Z. Čebinac – H. Czischek – J. Dries – A. Egli – P. Fischli – W. Frank – R. Fringer – A. Geiger – G. Gress – F. Heine – O. Hitzfeld – O. Imhof – M. Isler – F. Kerr – R. Kis – R. Komornicki – F. Konja – H. Kostka – R. Longin – E. Ludwig – W. Macho – W. Olk – W. Presch – M. Rueda – W. Schär – H. Schauer – A. Scheurer – H. Schneeberger – U. Schönenberger – K. Schrenk – H. Schultz – F. und G. Sobotka – P. Stehrenberger – J. Stocker – W. Suter – A. Sutter – R. Tschui – B. Volentik – R. Wehrli.
| FC Aarau: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1912, 1914, 1993 Landespokal 1985 Uhrencup 1995 |
Aarhus GF, Dänemark: → Århus.
A-Auswahl, svw. → Nationalmannschaft.
Aba, Nigeria (Stadt des gleichnamigen Staates); FC Enyimba, eigtl. „Enyimba International FC“ (Enyimba International Football Club), gegr. 1976; Spielkleidung: Blau/Schwarz/Schwarz; Stadion: Enyimba International Stadium, 25 500 Plätze. – INTERNET: www.enyimbafc.net
Spieler (Auswahl): M. Adegoke – V. Amadi – S. David – V. Enyeama – J. T. Frimpong – P. Ojigwe – O. Okoronkwo – – A. Sakibu. – Trainer (Auswahl): D. Amokachi – D. Ekweronu.
| FC Enyimba: Internationale Erfolge (Auswahl) African Champions League 2003, 2004 CAF Super Cup 2004, 2005 |
Abbé, Caroline, schweizer. Abwehrspielerin, * 13. Januar 1988; 1996–2003 FC Meyrin, 2003–06 CS Chênois (Genf), 2006/07 Yverdon-Sport, 2007–11 Yverdon Féminin; 58 Länderspiele (seit 2006; sechs Tore).
„Abbrechen“ → Fußballerjargon.
Abdellaoue, Mohammed („Moa“), norweg. Angriffsspieler marokkan. Herkunft (Eltern), * 23. Oktober 1985 Oslo; bis 2000 Hasle/Løren IL (Oslo), 2001–07 Skeid Oslo, 2008–10 Valerenga IF (Oslo), 2010/11 Hannover 96; zwölf Länderspiele für Norwegen (seit 2008; zwei Tore); in Norwegen Fußballer des Jahres 2010.
Abdessadki, Yacine, marokkan. Mittelfeldspieler (auch frz. Staatsbürgerschaft), * 1. Januar 1981 Nizza; bis 1998 Sporting Club de Toulon, 1998–2002 RC Straßburg, 2003 Grenoble Foot, 2003–05 RC Straßburg, 2005 FC Toulouse, 2006–08 Racing Straßburg, 2008–11 SC Freiburg; 44 Bundesligaspiele (seit 2009; zwei Tore); acht Länderspiele für Marokko (2004–08; ein Tor).
Abd-Rabou, Hosni, eigtl. „Hosni Abd Rabou Abdel Moteleb“, ägypt. Mittelfeldspieler, * 1. November 1984 Ismailia; 2003–05 SC Ismaily (Ägypten), 2005/06 RC Straßburg, 2006–10 SC Ismaily, 2010/11 Al-Ahli (Dubai); 72 Länderspiele (seit 2004; 14 Tore); U-20-WM-Endrunde 2003; Afrikameister 2008, 2010.
Abdullah, Majed, eigtl. „Majed Ahmad Abdullah Mohammed“, saudi-arab. Angriffsspieler, * 11. Oktober 1959 Djidda; 1977–98 Al-Nasr (Riad); 139 Länderspiele (1978–94; 67 Tore); WM-Endrunde 1994; olymp. Fußballturnier 1984; Asiens Fußballer des Jahres 1984, 1985, 1986.
Abegglen, 1) André („Trello“), schweizer. Angriffsspieler, * 7. März 1909, † 8. November 1944; Bruder von [2]; 1924–26 Cantonal Neuchâtel, 1926/27 Grasshopper-Club Zürich, 1927/28 Étoile Carouge FC, 1930–34 Grasshopper-Club Zürich, 1934–38 FC Sochaux (Torschützenkönig 1935 [30]), 1938–42 Servette Genf (Spielertrainer [Landesmeister 1940]), 1942–44 FC La Chaux-de-Fonds (Spielertrainer); 52 Länderspiele (1927–43; 29 Tore); WM-Endrunde 1934, 1938. – 2) Max („Xam“), schweizer. Mittelfeldspieler (Außenläufer), * 11. April 1902, † 25. August 1970; Bruder von [1]; 1918/19 Cantonal Neuchâtel, 1919–23 Lausanne-Sports, 1923–42 Grasshopper-Club Zürich; 68 Länderspiele (1922–38; 34 Tore); olymp. Fußballturnier 1924.
Abel, 1) Hans-Joachim („Jochen“), dt. Angriffsspieler, * 15. Juni 1952 Düsseldorf; 1972–74 Fortuna Düsseldorf, 1974–77 Westfalia Herne, 1977–82 VfL Bochum, 1982–84 FC Schalke 04, 1984–86 FC Vaduz; 183 Bundesligaspiele (1972–83; 70 Tore). – 2) Mathias, dt. Abwehrspieler, * 22. Juni 1981 Kaiserslautern; 1985–90 SV Wiesenthalerhof (Kaiserslautern), 1990–98 1. FC Kaiserslautern, 1998–2000 Eintracht Bad Kreuznach, 2001/02 Borussia Dortmund, 2002–06 1. FSV Mainz 05, 2006/07 FC Schalke 04, 2007 Hamburger SV, 2007/08 FC Schalke 04, 2008–11 1. FC Kaiserslautern; 71 Bundesligaspiele (seit 2004; fünf Tore).
Aberdeen, Schottland (Sitz des gleichnamigen Verwaltungsbezirks); FC Aberdeen, eigtl. „Aberdeen FC“ (Aberdeen Football Club), gegr. am 14. April 1903; Spielkleidung: Rot; Stadion: Pittodrie-Stadion, 22 199 Plätze. – INTERNET: www.afc.co.uk
Spieler (Auswahl): S. Archibald – J. Bett – M. Buchan – P. Buckley – A. Cheyne – R. Clarc – D. Colman – C. Dodds – J. Forrest – B. Grant – S. Gray – J. Harper – M. Heikkinen – J. Hewitt – S. Irvine – A. Jackson – S. Kennedy – A. Kombouaré – G. Leggat – J. Leighton – A. Love – F. Martin – F. McDougall – M. McGhee – S. McKimmie – A. McLeish – P. McStay – W. Miller – W. Mills – G. Mulhall – C. Nicholas – M. Paatelainen – D. Robb – D. Roughvie – D. Smith – T. Snelders – G. Strachan – Z. Varga – P. Weir – B. Yorston – D. Zdrilic. – Trainer (Auswahl): I. Bonthrone – C. Brown – J. Calderwood – A. Ferguson – A. MacLeod – M. McGhee – B. McNeill – S. Paterson – I. Porterfield – J. Scott – E. Skovdahl – A. Smith.
| FC Aberdeen: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1955, 1980, 1984, 1985 Landespokal 1947, 1970, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990 Europapokal der Pokalsieger 1983 Europa-Supercup 1983 |
ABFA, Abk. für Antigua/Barbuda Football Association, den Fußballverband von → Antigua & Barbuda.
Abidal, Éric, eigtl. „Éric-Sylvain Bilal Abidal“, frz. Abwehrspieler (Linksverteidiger), * 11. Juli 1979 Lyon; 1999/2000 Lyon-la-Duchère, 2000–02 AS Monaco, 2002–04 Lille OSC, 2004–07 Olympique Lyon, 2007–11 FC Barcelona; 56 Länderspiele (seit 2004); WM-Endrunde 2006, 2010; EM-Endrunde 2008.
Abidjan, Elfenbeinküste (Hauptort der Region Lagunes); 1) Africa Sports National, gegr. 1948; Spielkleidung: Grün/Rot/Weiß; Stadion: Félix Houphouët-Boigny, 37 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): K. Agassa – K. Ayew – A. Keïta – S. Keshi – J.-J. Tizié – R. Yekini. – Trainer (Auswahl): I. Sunday.
| Africa Sports National: Internationale Erfolge (Auswahl) Afrikapokal der Pokalsieger 1992, 1999 Afrika-Supercup 1993 |
2) ASEC Abidjan (Association Sportive des Employés de Commerce Abidjan), auch „ASEC Mimosas“, gegr. 1948; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Gelb; Stadion: Félix Houphouët-Boigny, 37 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): B. Barry – A. Boka – A. Dindane – S. Doumbia – E. Eboué – Gervinho – B. und S. Kalou – B. Koné – L. Pokou – Romaric – G.-C. Saint Joseph – D. Sié – S. Tiéné – I. und K. Touré – A. Traoré – D. Ya Konan – Yapi – Yaya Touré – D. Yeboah – D. Zokora. – Trainer (Auswahl): J.-M. Guillou – P. Liewig – P. Troussier.
| ASEC Abidjan: Internationale Erfolge (Auswahl) Afrikapokal der Landesmeister 1998 Afrika-Supercup 1998 |
3) Stella Abidjan, eigtl. „Stella Club d’Adjamé“, entstand 1953 durch Fusion von Red Star, Etoile d’Adjamé und US Bella; Spielkleidung: Grün; Stadion: Robert Champroux, 20 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): C. Aifimi – A. Attoukora – Ben Badi – F. Coulibaly – C. Djakpa – A. Diomandé – M. Djedje – G. Gnago – V. Kobenan – R. Yabre. – Trainer (Auswahl): A. Fofana.
Abily, Camille, eigtl. „Camille Anne Françoise Abily“, frz. Mittelfeldspielerin, * 5. Dezember 1984 Rennes, 1992–94 Jeanne d’Arc Bruz (Frankreich), 1994–99 FC Bruz, 1999/2000 SC Le Rheu, 2000/01 Stade Briochin (Saint-Brieuc [Frankreich]), 2001/02 La Roche ESOF (La Roche-sur-Yon [Frankreich]), 2002/03 CNFE Clairefontaine (Frankreich), 2003–06 HSC Montpellier, 2006–09 Olympique Lyon, 2009 Los Angeles Sol, 2009/10 Paris St.-Germain, 2010 FC Gold Pride (Santa Clara), 2010/11 Olympique Lyon; 78 Länderspiele (seit 2001; 20 Tore); U-19-EM-Endrunde 2002; WM-Endrunde 2011; EM-Endrunde 2005, 2009.
Ablösesumme, Lizenzfußball: svw. → Transfersumme.
Abo Treka, Mohamed (auch „Mohamed Aboutreika“), ägypt. Mittelfeldspieler, * 7. November 1978 Giseh; 1995–2004 Al-Tersana (Ägypten), 2004–11 Al-Ahly (Kairo; Torschützenkönig 2006 [18]); 53 Länderspiele (seit 2005; 14 Tore); Afrikameister 2006, 2008.
Abramczik, Rüdiger („Abi“), dt. Trainer, * 18. Februar 1956 Gelsenkirchen; war Angriffsspieler (Rechtsaußen): 1973–80 FC Schalke 04, 1980–83 Borussia Dortmund, 1983/84 1. FC Nürnberg, 1984/85 Galatasaray SK (Istanbul), 1985–87 Rot-Weiß Oberhausen, 1987/88 FC Schalke 04, 1988/89 Wormatia Worms, 1990/91 FC Gütersloh; 316 Bundesligaspiele (1973–84; 77 Tore); 19 Länderspiele (1977-79; zwei Tore); WM-Endrunde 1978. – Später Trainer: 1991–94 1. FC Saarbrücken (bis 1993 Assistent), 1999/2000 Antalyaspor (Türkei), 2002 Levski Sofia, 2002/03 FC Kärnten, 2005/06 HSG Mülheim-Kärlich (Rheinl.-Pf.), 2008–10 Metalurgs Liepajas (Landesmeister 2009). – Sein Bruder Volker Abramczik (* 1964) war ebenfalls Angriffsspieler: 1979–84 FC Schalke 04, 1984/85 MSV Duisburg, 1986–90 Rot-Weiss Essen; drei Bundesligaspiele (1982/83; ein Tor).
Abramovich, Roman (auch „Roman Abramowitsch“), russ. Unternehmer, * 24.10.1966 Saratow; gelangte 2003 in die Schlagzeilen der europ. und bes. der brit. Presse. Auslöser war der Kauf des Fußballvereins FC Chelsea und der folgende Aufkauf von europ. Spitzenspielern (u. a. 2006 von M. → Ballack). Dafür zahlte Abramovich horrende Transfersummen und Gehälter, schuf sich somit einen europ. Spitzenverein.
Abreu, Sebastián („El Loco”), eigtl. „Washington Sebastián Abreu Gallo“, uruguay. Angriffsspieler, * 17. Oktober 1976 Minas; 1994–96 Defensor SC (Montevideo), 1996/97 San Lorenzo de Almagro (Buenos Aires), 1998/99 Deportivo La Coruña, 1999/2000 UAG Tecos (Zapopan [Mexiko]), 2000/01 San Lorenzo de Almagro, 2001 Nacional Montevideo, 2002/03 Cruz Azul (Mexiko-Stadt), 2003 Club América (Mexiko-Stadt), 2004 Nacional Montevideo, 2005/06 Dorados de Sinaloa (Culiacán [Mexiko]; Apertura-Torschützenkönig 2006 [11]), 2006 CF Monterrey, 2007 Club San Luis (San Luis Potosi [Mexiko]; Clausura-Torschützenkönig 2007 [11, mit S. → Cabañas]) und UANL Tigris (Mexiko), 2008 CA River Plate (Buenos Aires), 2009 Real Sociedad (San Sebastián) und Aris Saloniki, 2010/11 Botafogo FR (Rio de Janeiro); 61 Länderspiele (seit 1996; 26 Tore); WM-Endrunde 2002, 2010.
Abruzzen, Italien: Region südl. in der Mitte des Landes; Hauptort: L’Aquila.
| Abruzzen: Vereine (Auswahl) L’Aquila Calcio Pescara Calcio |
Abschlag, Weiterleiten des Balles im laufenden Spielgeschehen aus der Hand des Torhüters (innerhalb des Strafraums); erfolgt meist durch (Volley-)Vollspannstoß Beim Abschlag darf der Torhüter von gegner. Spielern behindert werden; er muss innerhalb des Strafraums den Ball aus der Hand spätestens nach sechs Sekunden freigeben. Beim Abschlag bleibt – im Ggs. zum → Abstoß – die Abseitsregel voll wirksam. Der Abschlag kann wie der Abstoß direkt zum Torerfolg führen.
| Abschlag Goal kick [engl.] Renvoi du gardien de but [frz.] Golpe [span., port.] Colpo [ital.] |
Abseits, Begriff des Regelwerks, verwendet in speziellen Angriffssituationen. Ein Spieler befindet sich im Abseits, wenn er in dem Augenblick, in dem der Ball gespielt wird, der gegner. Torlinie näher ist als der Ball und als der vorletzte Spieler der gegner. Mannschaft. Dabei sind die Position seiner Füße, seines Rumpfes sowie seines Kopfes maßgebend, nicht aber die seiner Arme. – Kein Abseits:
• Der Spieler befindet sich in der eigenen Spielfeldhälfte.
• Der Spieler befindet sich auf gleicher Höhe mit dem vorletzten oder mit den beiden letzten
Spielern der gegner. Mannschaft.
• Der Spieler erhält den Ball direkt nach einem Abstoß, Eckstoß oder Einwurf.
Die Abseitsstellung eines Spielers stellt formal noch keine Regelübertretung dar. Ein Spieler wird nur dann für seine Abseitsstellung bestraft, wenn er nach Ansicht des Schiedsrichters ins Spiel eingreift. Dies bedeutet, dass der Spieler a) den Ball, der zuletzt von einem Mannschaftskollegen berührt oder gespielt wurde, selbst spielt oder berührt; b) einen Gegenspieler daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er eindeutig die Sicht des Gegners versperrt oder Bewegungen oder Gesten macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern, täuschen oder ablenken; c) einen Vorteil aus einer Abseitsstellung erlangt, indem er den Ball spielt, der vom Pfosten oder der Querlatte oder von einem gegner. Spieler zu ihm prallt. Entscheidend für die Bewertung, ob sich ein Spieler in Abseitsstellung befindet, ist stets seine Position im Augenblick der Ballabgabe durch einen Mitspieler, nicht die im Moment der Ballannahme. Die Spielfortsetzung nach Unterbrechung wegen Abseits erfolgt durch indirekten Freistoß für den Gegner. S. a. Spielregeln [Regel 11].
| Abseits Offside [engl.] Hors-jeu [frz.] Fuera de juego [span.] Off-side [port.] Fuorigioco [ital.] |
| Abseits Bei einem im Abseits stehenden Spieler sind die Position seiner Füße, seines Rumpfes sowie seines Kopfes maßgebend, nicht aber die seiner Arme. |
Abseitsfalle, legitimes takt., aber auch riskantes Mittel der Abwehr, um den bzw. die gegner. Angreifer abseits zu stellen. Dabei müssen die Abwehrspieler auf einer Linie stehen und auf Kommando des Abwehrchefs (früher meist der Libero) blitzartig (im „richtigen“ Moment) aus der Abwehr heraustreten. Das Augenmerk der Abwehrreihe gilt dabei sowohl dem Ball und dem den Ball führenden Angreifer („zentraler Blick“) als auch der Bewegung im Umfeld („peripherer Blick“). Durch den (riskanten) Aufbau der Abseitsfalle kurz vor der Mittellinie in der eigenen Spielhälfte wird den Mittelfeld- und Angriffsspielern die Möglichkeit gegeben, den Gegner frühzeitig zu attackieren.
Die Abseitsfalle ist Kräfte sparend, da der Raum verengt wird und die Laufwege sich dadurch verringern; das Geschehen spielt sich weitgehend im Bereich um die Mittellinie ab, d. h. auf etwa 20 bis 25% der gesamten Spielfeldfläche. Problematisch ist das Stellen einer Abseitsfalle nicht zuletzt deshalb, weil sie bedingt, dass der Schiedsrichter und v. a. der zuständige Schiedsrichterassistent die entstandene Abseitsstellung sofort erkennen und sie akustisch (Schiedsrichter) bzw. optisch (Schiedsrichterassistent) anzeigen.
Probate Gegenmittel zum Ausschalten der Abseitsfalle sind: a) Alleingang (Solo) des Ballführenden; b) (Lang-)Diagonalpass über die heraustretende Abwehrreihe hinweg zum steil laufenden Mitspieler; und c) Doppelpass. – Als „Meister“ des Stellens der Abseitsfalle galten früher die Belgier und Niederländer (1974 bei der Weltmeisterschaft erstmals konsequent praktiziert). Die Abseitsfalle wird aber heute von Experten zwiespältig beurteilt, da sie destruktiven Charakter aufweist und unansehnlich für die Zuschauer sein kann. Für Teile des Publikums – oft der Abseitsregel unkundig – ist die Abseitsfalle ohnehin ein „Buch mit sieben Siegeln“.
absichtliches Handspiel → Handspiel.
Abstieg, Wechsel von einer höheren in eine niedrigere Spielklasse. I. d. R. steigen diejenigen Mannschaften ab, die nach Abschluss des Spieljahrs die letzten Tabellenpositionen einnehmen (nat. und regional unterschiedlich). Eine Mannschaft, die von diesem Schicksal ereilt wird, heißt Absteiger.
| Abstieg Descent [engl.] Rélégation [frz.] Bajada [span.] Descida [port.] Discesa [ital.] |
Abstoß, den Ball wieder ins Spiel bringen, nachdem dieser die Torlinie außerhalb des Tores vollständig überschritten hat und von einem gegner. Spieler zuletzt berührt wurde. Der Abstoß erfolgt gegen den ruhenden Ball durch den Torhüter oder Feldspieler von irgendeinem Punkt innerhalb des Torraums. Der Ball muss über die Strafraumgrenze hinweg ins Spiel gebracht werden, ansonsten ist der Abstoß zu wiederholen. Der den Abstoß ausführende Spieler darf den Ball nicht ein zweites Mal spielen, bevor ihn ein anderer Spieler berührt oder gespielt hat. Aus einem Abstoß kann wie beim → Abschlag unmittelbar ein Tor erzielt werden. Die Abseitsregel für den Spieler, der den Ball zuerst annimmt, ist aufgehoben. S. a. Spielregeln [Regel 16].
| Abstoß Goal kick [engl.] Coup d’envoi [frz.] Lanzamiento [span.] Empurrão [port.] Rimessa [ital.] |
Abu Dhabi, Hauptstadt der VAE und des gleichnamigen Emirats; 1) Al-Jazira Club, gegr. am 19. März 1974 durch Fusion von Al Khalidiyah Club und Al Bateen Club; Spielkleidung: Schwarz-weiß/Schwarz/Rot; Stadion: Mohammed Bin Zayed, 42 000 Plätze. – INTERNET: www.jc.ae
Spieler (Auswahl): F. Baiano – E. Becerra – P. Cocu – M. Kader – B. Kalou – B. Ogbeche – R. Sóbis – M. C. Touré – G. Weah. – Trainer (Auswahl): L. Bölöni – A. Braga – R. Israel – J. Pivarnik – F. Vercauteren.
2) Al-Wahda, gegr. 1974; Spielkleidung: Weiß; Stadion: Al-Nahyan, 12 000 Plätze. – INTERNET: www.3nabi.com
Spieler (Auswahl): H. Ali – F. Baiano – A. Bouri Lah – K. Bwalya – Fábio Júnior – F. Massaood – I. Matar – J. Nekounam – Paulo Sérgio. – Trainer (Auswahl): L. Bölöni – J. Bonfrère – R. Fringer – J. Hickersberger – R. Hollmann – R. Israel – H. Köppel – K. Lindenberger – L. Sippel.
Abwehrkette, Formation von drei (→ Dreierkette) oder vier (→ Viererkette) Abwehrspielern als letztes Bollwerk vor dem Torhüter.
| Abwehrkette Defensive chain [engl.] La chaîne de défense [frz.] Cadena defensiva [span.] Cadeia de defensivos [port.] Catena difensiva [ital.] |
Abwehrriegel, Taktik: stat. Verteidigungsform, bei der dem Angreifer stets ein Riegel, eine schräg gestaffelte Abwehr, entgegengestellt wird. – Bekannt war in früheren Jahren der Schweizer Riegel von K. → Rappan.
Abwehrspieler, Bez. für diejenigen Spieler, die die Abwehr einer Mannschaft bilden und deren vorrangige Aufgabe es ist, Gegentreffer zu verhindern. Im modernen Fußball schalten sich, wenn es die Situation erfordert, die Abwehrspieler in den eigenen Angriff ein (offensive Abwehrspieler). Der Torhüter zählt regeltechnisch (beim Abseits) ebenfalls als Abwehrspieler. – Früher bezeichnete man die Abwehrspieler als rechten und linken Verteidiger sowie als Mittelverteidiger. Letzterer wurde auch Stopper genannt.
Accra, Hauptstadt von Ghana; 1) Great Olympics, eigtl. „Great Olympics Accra Football Club“, gegr. 1954; Spielkleidung: Weiß/Blau/Blau; Stadion: Accra Sports, 35 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): I. Ahmed – R. Kingson – L. Kingston – P. Razak. – Trainer (Auswahl): C. Miller.
2) Hearts of Oak, eigtl. “Accra Hearts of Oak Sporting Club“, gegr. 1910; Spielkleidung: Gelb-Blau/Rot/Rot; Stadion: Accra Sports, 35 000 Plätze. – INTERNET: www.accraheartsofoak.com
Spieler (Auswahl): I. Addo – S. Adjei – A. Annan – J. Attuquayefio – A. Duah – J. Fameyeh – L. Kingston – E. Kuffour – P. Lamptey – S. Suppey – P. Tagoe – C. Taylor – T. Thompson. – Trainer (Auswahl): F. Akenten – E. Middendorp.
| Hearts of Oak: Internationale Erfolge (Auswahl) African Champions League 2000 Afrika-Supercup 2001 CAF Confederation Cup 2004 |
Achillessehnenverletzung → Sportmedizin.
Achtelfinale, die viertletzte Runde eines im → K.-o.-System ausgetragenen Turnier- oder Pokalwettbewerbs, an dem noch 16 Mannschaften (acht Spiele) beteiligt sind; die Sieger erreichen das → Viertelfinale.
| Achtelfinale Eighth final [engl.] Huitième de finale [frz.] Octavo de final [span.] Oitavo de final [port.] Ottavo di finale [ital.] |
Achterberg, Eddy („De Keu“), niederländ. Trainer, * 21. Februar 1947 Utrecht; war Mittelfeldspieler: 1962–67 DOS Utrecht, 1967–76 FC Twente (Enschede) (246 Pflichtspiele; 26 Tore), 1976–78 FC Groningen. – Später Trainer: 1988–94 FC Twente (Assistent), 1994–98 Roda JC (Kerkrade; Assistent), 1998–2000 FC Schalke 04 (Assistent), 2000–02 FC Twente (Assistent), 2003–05 FC Schalke 04 (Assistent), 2009–11 RB Salzburg (Assistent).
Aćimović, Jovan, serb. Mittelfeldspieler, * 21. Juni 1948 Belgrad; bis 1965 OFK Belgrad, 1965–76 Roter Stern Belgrad, 1976–78 1. FC Saarbrücken, 1978/79 FK Obilić (Belgrad); 41 Bundesligaspiele (1976–78; ein Tor); 56 Länderspiele für Jugoslawien (1968–76; drei Tore); WM-Endrunde 1974; EM-Endrunde 1968, 1976.
Ačimovič, Milenko, slowen. Mittelfeldspieler, * 15. Februar 1977 Ljubljana; bis 1996 Zelecnicar Maribor, 1996/97 Olimpija Ljubljana, 1997–2002 Roter Stern Belgrad, 2002–04 Tottenham Hotspur, 2004–06 Lille OSC, 2006/07 Al-Ittihad (Djidda), 2007–10 Austria Wien; 74 Länderspiele (1998–2010; 13 Tore); WM-Endrunde 2002; EM-Endrunde 2000.
ACN, Abk. für engl. African Cup of Nations, die → Afrikameisterschaft.
Acuña, Roberto („Stier“), eigtl. „Roberto Miguel Acuña Cabello“, paraguay. Mittelfeldspieler argentin. Herkunft (Mutter), seit 1993 paraguay. (zuvor argentin.) Staatsbürgerschaft, * 25. März 1972 Avellaneda (Argentinien); 1990–93 Club Nacional (Asunción), 1993/94 Argentinos Juniors, 1994/95 CA Boca Juniors, 1995–97 CA Independiente (Avellaneda), 1997–2002 Real Saragossa, 2002/03 Deportivo La Coruña, 2003/04 Elche CF, 2005/06 Deportivo La Coruña, 2006 Al-Ain Club (VAE), 2007 Rosario Central und Olimpia Asunción, 2009–11 Rubio Ñu (Asunción); 100 Länderspiele für Paraguay (1993–2011; fünf Tore); WM-Endrunde 1998, 2002, 2006; in Paraguay Fußballer des Jahres 2001.
Adamec, Jozef, slowak. Trainer, * 26. Februar 1942 Vrbové; war Angriffsspieler: 1959–61 Spartak Trnava, 1961–63 Dukla Prag, 1963/64 Spartak Trnava, 1964/65 Slovan Bratislava, 1966–76 Spartak Trnava (Torschützenkönig 1967 [21], 1968 [18], 1970 [16], 1971 [16]); 44 Länderspiele für die ČSSR (1960–73; 14 Tore); WM-Endrunde 1962, 1970. – Später Trainer: 1977–80 SK Slovan HAC (Wien; Spielertrainer), 1980/81 Slovan Duslo Šala (Slowakei) 1982–84 Dukla Banská Bystrica, 1988/89 Vorwärts Steyr, 1989/90 Inter Bratislava, 1991–93 Dukla Banská Bystrica, 1993/94 Inter Bratislava, 1994/95 SK Zlin, 1998/99 Tatran Prešov, 1999–2001 Slowakei (Nationalmannschaft), 2001–03 Spartak Trnava, 2003/04 Slovnavt Bratislava, 2005/06 Spartak Trvana, 2006/07 Artmedia Petržalka (Bratislava).
Adamov, Roman (auch „Roman Adamow“), russ. Angriffsspieler, * 21. Juni 1982 Belaya Kalitva; 1999/2000 Olimpia Wolgograd, 2000 FK Rostow, 2000/01 Schachtar Donezk, 2001–04 FK Rostow, 2004/05 Terek Grosny, 2006–08 FK Moskau (Torschützenkönig 2007 [14, mit R. → Pavlyuchenko]), 2008/09 Rubin Kasan, 2009 Krylja Sowjetow Samara, 2010/11 FK Rostow; zwei Länderspiele (seit 2008); EM-Endrunde 2008.
Adams, Tony, eigtl. „Tony Alexander Adams“, engl. Trainer, * 10. Oktober 1966 Romford (zu London); war Abwehrspieler: 1980–2002 FC Arsenal; 66 Länderspiele (1987–2005; fünf Tore); WM-Endrunde 1998; EM-Endrunde 1988, 1996, 2000. – Später Trainer: 2003/04 Wycombe Wanderers (England), 2006–09 FC Portsmouth (bis 2008 Assistent), 2010/11 FK Gabala (Aserbaidschan).
Adapazarı, Türkei (Hauptstadt der Provinz Sakarya); Sakaryaspor, eigtl. „Sakaryaspor AŞ“ (Sakaryaspor Anonim Şirketi), gegr. 1965; Spielkleidung: Grün-Schwarz/Schwarz/Schwarz; Stadion: Sakarya-Atatürk-Stadion, 13 216 Plätze. – INTERNET: www.sakaryaspor.com.tr
Spieler (Auswahl): O. Çetin – J. Clayton – M. Erdogan – R. Kingson – A. Kocaman – S. Makasi – L. Martinez – H. Şükür – S. Tekelioglu – Tuncay – S. Usta – A. Yiğit. – Trainer (Auswahl): F. Aldinc – Ş. Güneş – H. Kalpar – N. Sert.
| Sakaryaspor: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1988 |
Addo, Otto, ghanaischer Trainer (auch dt. Staatsbürgerschaft), * 9. Juni 1975 Hamburg; war Mittelfeldspieler: 1981–91 Hummelsbütteler SV (Hamburg), 1991/92 Hamburger SV, 1992/93 Bramfelder SV (Hamburg), 1993–96 VfL 93 Hamburg, 1996–99 Hannover 96, 1999–2005 Borussia Dortmund, 2005–07 1. FSV Mainz 05, 2007/08 Hamburger SV; 98 Bundesligaspiele (1999–2007; elf Tore); 15 Länderspiele für Ghana (1999–2006; zwei Tore); WM-Endrunde 2006. – Später Trainer: 2009–11 Hamburger SV (U 19 [2009/10 Assistent]).
| O. Addo Er erlitt in der Zeitspanne von 2002 bis 2003 drei Kreuzbandrisse. |
Adduktorensyndrom → Sportmedizin.
Adebayor, Emmanuel, eigtl. „Sheyi Emmanuel Adebayor“, togoischer Angriffsspieler nigerian. Herkunft (Eltern), * 26. Februar 1984 Lomé (Togo); 2000–03 FC Metz, 2003–06 AS Monaco, 2006–09 FC Arsenal, 2009–11 Manchester City, 2011 Real Madrid und Tottenham Hotspur; 38 Länderspiele (2000–10; 16 Tore); WM-Endrunde 2006; Afrikas Fußballer des Jahres 2008.
| E. Adebayor Er saß in dem Mannschaftsbus, der auf dem Weg zur Endrunde der Afrikameisterschaft 2010 in Angola kurz nach der Einreise in die Exklave Cabinda von Rebellen überfallen wurde. Im April 2010 gab er wegen des Angriffes das Ende seiner internationalen Karriere bekannt. |
Adelaide, Australien (Hauptstadt des Staates South Australia); 1) Adelaide City, eigtl. „Adelaide City FC“ (Adelaide City Football Club), gegr. 1946 als Adelaide Juventus, seit 1977 Adelaide City FC; Spielkleidung: Schwarz-Weiß/Schwarz/Schwarz; Stadion: Ram-Park, 15 000 Plätze. – INTERNET: www.adelaidecityfc.com.au
Spieler (Auswahl): J. Aloisi – D. Deans – C. Foster – E. Galekovic – M. Ivanović – S. Jamieson – J. Kosmina – S. Melta – B. Moore – D. Mori – A. Osman – P. Pezos – R. Russell – S. Smeltz – A. Tobin – G. Tsonis – Aurelio und Antony Vidmar. – Trainer (Auswahl): D. Mori.
| Adelaide City: Internationale Erfolge (Auswahl) OFC Champions Cup 1987 |
2) Adelaide United, eigtl. „Adelaide United FC“ (Adelaide United Football Club), gegr. 2003; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Schwarz; Stadion: Hindmarsh, 15 500 Plätze. – INTERNET: www.adelaideunited.com.au
Spieler (Auswahl): D. Beltrame – A. Constanzo – E. Galekovic – S. Jamieson – S. Ognenovski – Romário – D. Seal – A. Vidmar. – Trainer (Auswahl): J. Kosmina – Aurelio und Antony Vidmar.
Ademir, eigtl. „Ademir Marques de Menezes“, brasilian. Angriffsspieler (Mittelstürmer), * 8. November 1922 Recife, † 11. Mai 1996 Rio de Janeiro; 1938–41 Sport Recife, 1942–45 Vasco da Gama (Rio de Janeiro), 1946/47 Fluminense FC (Rio de Janeiro), 1948–55 Vasco da Gama; 41 Länderspiele (1945–53; 31 Tore); WM-Endrunde 1950 (Torschützenkönig: 9).
Adler, 1) Jens („Adel“), dt. Trainer, * 25. April 1965 (Halle/Saale); war Torhüter: 1981–95 HFC Chemie bzw. Hallescher FC, 1995/96 BSV Brandenburg, 1996/97 Hertha BSC, 1997–2000 VfL Halle; 87 (DDR- bzw. NOFV-)Oberligaspiele (1987–91); ein Länderspiel (1990). – Später (Torhüter-)Trainer: 2001–11 Hallescher FC. – 2) Nicky, dt. Angriffsspieler, * 23. Mai 1985 Leipzig; bis 1997 Rotation Leipzig 1950, 1997–2003 VfB Leipzig, 2003–07 TSV München 1860, 2007/08 1. FC Nürnberg, 2008–10 MSV Duisburg, 2010/11 VfL Osnabrück, 2011 Wacker Burghausen; 106 Zweitligaspiele (2005–10; 17 Tore). – 3) Oliver, dt. Trainer, * 14. Oktober 1967 Duisburg; war Torhüter: 1984–90 FV Duisburg 08, 1990–92 Schwarz-Weiß Essen, 1992–94 FV Duisburg 08, 1994/95 Preußen Köln, 1995–2005 Rot-Weiß Oberhausen, 2005–08 Hessen Kassel; 224 Zweitligaspiele (1998–2005). – Später Trainer: 2008–11 Rot-Weiß Oberhausen (bis 2011 Assistent, 2011 Interims-Cheftrainer). – 4) René, dt. Torhüter, * 15. Januar 1985 Liebertwolkwitz (seit 1999 zu Leipzig); bis 1991 SV Liebertwolkwitz, 1991–2000 VfB Leipzig, 2000–11 Bayer 04 Leverkusen; 138 Bundesligaspiele (seit 2007); zehn Länderspiele (seit 2008); EM-Endrunde 2008 (nicht eingesetzt).
| J. Adler Er war 1990 mit seinem dreiminütigen Einsatz gegen Belgien (2:0) letzter Nationalspieler der DDR. |
„Adler von Karthago“, Bez. für die tunes. Nationalmannschaft.
Adlung, Daniel, dt. Mittelfeldspieler, * 1. Oktober 1987 Fürth; 1994–96 SV Hiltpoltstein (Oberfranken), 1996–98 1. FC Nürnberg, 1998–2000 SpVgg Greuther Fürth, 2000/01 1. FC Nürnberg, 2001–08 SpVgg Greuther Fürth, 2008/09 VfL Wolfsburg, 2009/10 Alemannia Aachen, 2010 VfL Wolfsburg, 2010/11 Energie Cottbus; 127 Zweitligaspiele (seit 2005; zehn Tore).
AD Plus Ultra, Spanien: Gründungsname von Real Madrid Castilla (→ Madrid [4]).
Adriaanse, Co, eigtl. „Jacobson Adriaanse“, niederländ. Trainer, * 21. Juli 1947 Amsterdam; war Abwehrspieler: 1964–70 FC Amsterdam, 1970–76 FC Utrecht. – Später Trainer: 1979–83 FC Zilvermeeuwen (Niederlande), 1984–88 PEZ Zwolle ’82, 1988–92 FC Den Haag, 1992–97 Ajax Amsterdam (Nachwuchs), 1997–2000 Willem II Tilburg, 2000/01 Ajax Amsterdam, 2002–05 AZ Alkmaar, 2005/06 FC Porto (Landesmeister und -pokal 2006), 2006/07 Metalurg Donezk, 2007/08 Al-Sadd SC (Doha), 2008/09 RB Salzburg (Landesmeister 2009), 2010/11 Katar (Olympiaauswahl), 2011 FC Twente (Enschede); in den Niederlanden Trainer des Jahres 2004; in Portugal Trainer des Jahres 2006.
Adriano, 1) eigtl. “Leite Ribeiro Adriano”, brasilian. Angriffsspieler, * 17. Februar 1982 Rio de Janeiro; 1999–2001 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 2001 Inter Mailand, 2002 AC Florenz, 2002–04 AC Parma, 2004–07 Inter Mailand, 2008 FC São Paulo, 2008/09 Inter Mailand, 2009/10 CR Flamengo (Torschützenkönig 2009 [19, mit D. → Tardelli]), 2010/11 AS Rom, 2011 Corinthians Paulista (São Paulo); 53 Länderspiele (seit 2000; 29 Tore); U-21-Weltmeister 1999; WM-Endrunde 2006. – 2) eigtl. „Adriano Correia Claro“, brasilian. Mittelfeldspieler (auch span. Staatsbürgerschaft), * 26. Oktober 1984 Curitiba; 2002–05 FC Coritiba, 2005–10 FC Sevilla, 2010/11 FC Barcelona; neun Länderspiele (seit 2003).
Adrion, Rainer, dt. bis * 10. Dezember 1953 Stuttgart; war Abwehrspieler: 1973–77 SpVgg Ludwigsburg, 1977–82 VfB Stuttgart, 1982–84 SpVgg Unterhaching, 1984/85 TSV München 1860; 22 Bundesligaspiele (1980–82). – Später Trainer: 1985–88 FV Zuffenhausen (Stuttgart; Spielertrainer), 1988–91 SpVgg Ludwigsburg, 1991–93 SpVgg Unterhaching, 1993/94 SSV Reutlingen, 1994/95 1. FC Pforzheim, 1996–2001 VfB Stuttgart (bis 1999 Assistent, 1999 Cheftrainer, 1999–2001 Amateure), 2001/02 SpVgg Unterhaching, 2003 Stuttgarter Kickers, 2004–09 VfB Stuttgart II, 2009–11 DFB (U 21). – Sein Sohn Benjamin Adrion (* 1981) war Mittelfeldspieler: 2000–03 VfB Stuttgart II, 2003/04 Eintracht Braunschweig, 2004–07 FC St. Pauli; 101 Regionalligaspiele (2000–07; sechs Tore).
Advocaat, Dick, eigtl. „Dirk Nicolaas Advocaat“, niederländ. Trainer, * 27. September 1947 Den Haag; war Abwehrspieler: 1966–73 ADO Den Haag bzw. FC Den Haag-ADO, 1973–77 Roda JC (Kerkrade), 1977–79 VVV Venlo, 1979/80 FC Den Haag (1978–80 jeweils in den Sommermonaten bei Chicago Sting), 1980–82 Sparta Rotterdam, 1982 Berchem Sport (Belgien), 1982–84 FC Utrecht. – Später Trainer: 1985–87 Niederlande (Nationalmannschaft; 1985/86 Assistent von L. → Beenhakker und 1986/87 von R. → Michels), 1987–89 SBV Haarlem, 1989–92 SVV Schiedam (Niederlande), 1992–94 Niederlande (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 1994]), 1995–98 PSV Eindhoven, 1998–2001 Glasgow Rangers, 2002–04 Niederlande (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2002, EM-Endrunde 2004]), 2004/05 Borussia Mönchengladbach, 2005 VAE (Nationalmannschaft), 2005/06 Südkorea (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2006]), 2006–09 Zenit St. Petersburg, 2009/10 Belgien (Nationalmannschaft) und (in → Personalunion) AZ Alkmaar, 2010/11 Russland (Nationalmannschaft).
| D. Advocaat: Erfolgsstationen (Auswahl) | |
| PSV Eindhoven grau Glasgow Rangers grau Zenit St. Petersburg grau u grau | Landespokal 1996 Landesmeister 1997 Landesmeister 1999, 2000 Landespokal 1999, 2000 Landesmeister 2007 UEFA-Pokal 2008 Europa-Supercup 2008 |
AEFCA [Abk. für Alliance of European Football Coaches’ Association], seit 2008 Dachorganisation der europ. Trainerverbände, die am 12. Januar 1980 in Wien (mit dortigem Sitz) als UEFT (Abk. für Union Europ. Fußball-Trainer) gegr. wurde; Präsident (seit 1986): J. → Vengloš; Sitz: Frankfurt am Main. Sie veranstaltet jährlich ein Symposium, wobei die jeweilige Tagesordnung die Aus- und Weiterbildung der Trainer, die Stellung des Trainers in der Gesellschaft und ähnl. Themen enthält. In der AEFCA sind 43 nat. Trainerorganisationen aus 41 Ländern vertreten, darunter BDFL (Deutschland), BÖFL (Österreich) und USFT (Schweiz). – INTERNET: www.aefca.eu
Aerdken, Markus, dt. Angriffsspieler, * 31. Dezember 1971 Dülmen (NRW); 1981–85 SV Brukteria Rorup (Dülmen), 1985–89 TSG Dülmen, 1989/90 FC Schalke 04, 1990/91 Borussia Dortmund, 1991/92 ASC Schöppingen, 1992/93 FC St. Pauli, 1993–95 Wuppertaler SV, 1995–97 VfB Lübeck, 1997/98 Sportfreunde Lotte, 1998–2000 Sachsen Leipzig, 2000/01 Berliner FC Dynamo, 2001/02 Wormatia Worms, 2002/03 Union Solingen, 2003/04 FC Eilenburg, 2004/05 FSV Krostitz (Sa.), 2005/06 Grün-Weiß Piesteritz, 2006 Leipzig Lions (American Football), 2006–08 TSV “Elbe” Aken (Sa.-Anh.); 61 Zweitligaspiele (1992–97; 14 Tore).
AFA, 1) Abk. für Anguilla Football Association, den Fußballverband von → Anguilla. – 2) Abk. für Associación del Fútbol Argentino, den Fußballverband von → Argentinien.
AFC, 1) [Abk. für Asian Football Confederation], Vereinigung der nat. Verbände Asiens, Sitz: Kuala Lumpur (Malaysia), Präsident: M. → Bin Hammam; 1954 während der zweiten Asienspiele in Manila von Afghanistan, Birma, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Pakistan, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Singapur und Südvietnam gegründet. Die AFC (seit der WM-Endrunde 2006 mit Australien [zuvor → OFC]) umfasst 46 Landesverbände. – Sie organisiert für Nationalmannschaften die → Asienmeisterschaft und das Fußballturnier der → Asienspiele, für Klubmannschaften die → AFC Champions League. Außerdem initiiert sie die Wahl zu → Asiens Fußballer des Jahres. – INTERNET: www.footballasia.com – 2) Abk. für Asociación de Fútbol de Cuba, den Fußballverband von → Kuba.
| AFC [1]: Mitgliedsländer | |
| Afghanistan | Macao |
| Australien | Malediven |
| Bahrain | Malaysia |
| Bangladesh | Mongolei |
| Bhutan | Nepal |
| Birma | Nordkorea |
| Brunei | Oman |
| China | Osttimor |
| Guam | Pakistan |
| Hongkong | Palästina |
| Indien | Philippinen |
| Indonesien | Saudi-Arabien |
| Irak | Singapur |
| Iran | Sri Lanka |
| Japan | Südkorea |
| Jemen | Syrien |
| Jordanien | Tadschikistan |
| Kambodscha | Taiwan |
| Katar | Thailand |
| Kirgisistan | Turkmenistan |
| Kuwait | Usbekistan |
| Laos | VAE |
| Libanon | Vietnam |
| AFC [1]: WM-Modus Die Sieger und Zweiten der Qualifikationsendrunde (zwei Gruppen à fünf Teams) sind direkt für die WM-Endrunde qualifiziert. Die beiden Drittplazierten tragen zwei Play-off-Spiele aus, deren Sieger dann in zwei weiteren Play-off-Spielen auf die viertplatzierte Mannschaft aus Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) trifft. |
AFC Asian Cup, offizielle Bez. für → Asienmeisterschaft.
AFC Challenge Cup, seit 2006 alle zwei Jahre von der Asian Football Confederation (→ AFC [1]) ausgetragenes Turnier für Nationalmannschaften aus den asiat. Fußball-“Entwicklungsländern” (Bangladesch, Birma, Indien, Kirgisistan, Nordkorea, Sri Lanka, Tadschikistan, Turkmenistan). 2008 und 2010 diente das Turnier als Qualifikation für die → Asienmeisterschaft des Jahres 2011.
| AFC Challenge Cup: Sieger | |
| 2006 | Tadschikistan |
| 2008 | Indien |
| 2010 | Nordkorea |
AFC Champions League, seit 2002/03 ausgetragener Wettbewerb der Asian Football Confederation (→ AFC [1]), an dem die Vereine der stärksten 15 Länder beteiligt sind. Der Sieger des Wettbewerbs nimmt seit 2005 an der → Klubweltmeisterschaft teil. Weitere Mannschaften spielen in einer „B-Gruppe“ um den → AFC Cup und die Vertretungen der am schwächsten eingestuften Länder um den President’s Cup. Vorgängerwettbewerbe waren der → Asienpokal der Landesmeister und der → Asienpokal der Pokalsieger sowie der daraus resultierende → Asian Super Cup. – INTERNET: www.the-afc.com
| AFC Champions League: Sieger 2003 Al-Ain Club (VAE) 2004 Al-Ittihad (Saudi-Arabien) 2005 Al-Ittihad (Saudi-Arabien) 2006 Jeonbuk Hyundai Motors (Südkorea) 2007 Urawa Red Diamonds (Japan) 2008 Gamba Oasaka (Japan) 2009 Pohang Steelers (Südkorea) 2010 Seongnam Ilhwa Chunma (Südkorea) |
AFC Cup, seit 2003/04 ausgetragener Wettbewerb der Asian Football Confederation (→ AFC [1]), an dem 32 Vereine der „mittelstarken" Länder beteiligt sind („B-Gruppe“). Dies sind Landesmeister und Pokalsieger, die die Voraussetzungen für die → AFC Champions League nicht erfüllen.
| AFC Cup: Sieger 2004 Al-Dschaisch (Syrien)Syria2005 Al-Faisaly (Jordanien)Jordan2006 Al-Faisaly (Jordanien) 2007 Nadi Shabab Al Ordon (Jordanien) Jordan2008 Muharraq Club (Bahrain)Bahrain2009 Al-Kuwait Kaifan (Kuwait)Kuwait2010 Al-Ittihad (Syrien)Syria |
Afellay, Ibrahim, niederländ. Mittelfeldspieler marokkan. Herkunft (auch marokkan. Staatsbürgerschaft), * 2. April 1986 Utrecht; bis 1995 Elinkwijk Utrecht, 1996–2011 PSV Eindhoven, 2011 FC Barcelona; 32 Länderspiele für die Niederlande (seit 2007; drei Tore); WM-Endrunde 2010; EM-Endrunde 2008.
AFF, 1) Abk. für Union of Arab Football Federationes, 1963 gegründete Vereinigung arab. Fußballverbände. Die AFF organisiert den → Arab Cup. – 2) Abk. für Afghanistan Football Federation, den Fußballverband von → Afghanistan. – 3) Abk. für ASEAN Football Federation, am 31. Januar 1984 gegründeter regionaler asiat. Fußballverband (im Unterschied zum Kontinentalverband → AFC) der in der ASEAN (Organisation südostasiat. Staaten) organisierten Staaten. Die AFF trägt seit 1996 die → ASEAN Football Championship aus. – INTERNET: www.aseanfootball.org
| AFF [1]: Mitgliedsländer | |
| Ägypten Algerien Bahrain Irak Jemen Jordanien | Katar Kuwait Libanon Libyen Marokko Sudan |
| AFF [3]: Mitgliedsländer | |
| Birma Brunei Indonesien Kambodscha Laos Malaysia | Osttimor Philippinen Singapur Thailand Vietnam |
AFFA, Abk. für Association of Football Federations of Azerbaijan, den Fußballverband von → Aserbaidschan.
Afghanistan, Staat im NO Vorderasiens, 652 225 km², 25 Mio. Ew.; Verband: Afghanistan Football Federation, Abk. AFF, gegr. 1933, Sitz: Kabul; Mitglied der FIFA seit 1948, der AFC seit 1954; Spielkleidung: Weiß. – INTERNET: www.aff.com.af
Afolabi, Rabiu, nigerian. Abwehrspieler (Innenverteidiger), auch belg. Staatsbürgerschaft, * 18. April 1980 Osogbo; bis 1996 NEPA Lagos, 1997–2000 Standard Lütich, 2000 SSC Neapel, 2001–03 Standard Lüttich, 2003–05 Austria Wien, 2005–09 FC Sochaux, 2009–11 RB Salzburg; 18 Länderspiele (seit 2000; ein Tor); U-20-WM-Endrunde 1999; WM-Endrunde 2002 (nicht eingesetzt), 2010.
Afonso Alves, eigtl. “Afonso Alves Martins Junior“, brasilian. Angriffsspieler, * 30. Januar 1981 Belo Horizonte; 1997–2002 Atlético Mineiro (Belo Horizonte), 2002–04 Örgryte IS (Göteborg), 2004–06 Malmö FF, 2006–08 SC Heerenveen (Torschützenkönig 2007 [34]), 2008/09 FC Middlesbrough, 2009/10 Al-Sadd SC (Doha), 2010/11 Al-Rayyan SC (Katar); acht Länderspiele (seit 2007; ein Tor); in den Niederlanden Fußballer des Jahres 2007.
African Champions League, bedeutendster Klubwettbewerb des afrikan. Kontinents, organisiert und durchgeführt von der Confédération Africaine de Football (→ CAF); ausgetragen zw. Februar und Dezember im → K.-o.-System (mit Hin- und Rückspielen). Bis 1995/96 wurde der Wettbewerb als → Afrikapokal der Landesmeister geführt. Nach vorangehenden Qualifikationsrunden im K.-o.-System wird in zwei Gruppen à vier Mannschaften gespielt („Jeder gegen jeden“, Hin- und Rückspiel); die beiden Ersten jeder Gruppe ermitteln dann im Überkreuzvergleich die Endspielteilnehmer. Das Finale wird ebenfalls mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Sieger spielt dann gegen den Gewinner des → CAF Confederation Cup um den → CAF Super Cup und qualifiziert sich darüber hinaus seit 2005 für die → Klubweltmeisterschaft.
| African Champions League: Sieger 1997 Raja Casablanca (Marokko) 1998 ASEC Abidjan (Elfenbeinküste) 1999 Raja Casablanca (Marokko) 2000 Hearts of Oak (Ghana) 2001 Al-Ahly (Ägypten) 2002 Zamalek SC (Ägypten) 2003 FC Enyimba (Nigeria) 2004 FC Enyimba (Nigeria) 2005 Al-Ahly (Ägypten) 2006 Al-Ahly (Ägypten) 2007 ES Sahel (Tunesien) 2008 Al-Ahly (Ägypten) 2009 TP Mazembe (Demokratische Republik Kongo) 2010 TP Mazembe (Demokratische Republik Kongo) |
Africa Sports National, Elfenbeinküste: → Abidjan [1].
Afrikameisterschaft, Kontinentalmeisterschaft der Mitgliedsländer der Confédération Africaine de Football (→ CAF). Nach Qualifikationsspielen mit Hin- und Rückspiel wird wie bei der Europameisterschaft eine Endrunde (meist im Januar) gespielt: vier Gruppen à vier Mannschaften, es folgen Viertel-, Halbfinale, Finale. Die Afrikameisterschaft wird seit 1968 im Zweijahresrhythmus ausgetragen. – Frauenfußball: Das Turnier findet seit 1998 ebenfalls alle zwei Jahre statt und war bislang ein „nigerian. Turnier“ (1991–2006 Sieger).
| Afrikameisterschaft: Sieger | ||
| Jahr | Männer | Frauen |
| 1957 | Ägypten | – |
| 1959 | Ägypten | – |
| 1962 | Äthiopien | – |
| 1963 | Ghana | – |
| 1965 | Ghana | – |
| 1968 | Demokratische Republik Kongo | – |
| 1970 | Sudan | – |
| 1972 | Republik Kongo | – |
| 1974 | Zaïre | – |
| 1976 | Marokko | – |
| 1978 | Ghana | – |
| 1980 | Nigeria | – |
| 1982 | Ghana | – |
| 1984 | Kamerun | – |
| 1986 | Ägypten | – |
| 1988 | Kamerun | – |
| 1990 | Algerien | – |
| 1991 | – | Nigeria |
| 1992 | Elfenbeinküste | – |
| 1994 | Nigeria | – |
| 1995 | – | Nigeria |
| 1996 | Südafrika | – |
| 1998 | Ägypten | Nigeria |
| 2000 | Kamerun | Nigeria |
| 2002 | Kamerun | Nigeria |
| 2004 | Tunesien | Nigeria |
| 2006 | Ägypten | Nigeria |
| 2008 | Ägypten | Äquatorialguinea |
| 2010 | Ägypten | Nigeria |
Afrika-Nationencup, svw. → Afrikameisterschaft.
Afrikanische Spiele, svw. → Afrikaspiele.
Afrikapokal der Landesmeister, bis 1995/96 bedeutendster Klubwettbewerb des afrikan. Kontinents, organisiert und durchgeführt von der Confédération Africaine de Football (→ CAF). 1993–96 spielte der Gewinner gegen den Sieger des → Afrikapokals der Pokalsieger um den → Afrika-Supercup. Seit 1996/97 wird der Wettbewerb als → African Champions League geführt.
| Afrikapokal der Landesmeister: Sieger |
| 1964 Oryx de Douala (Kamerun) 1966 Stade d’Abidjan (Elfenbeinküste) 1967 TP Mazembe (Demokratische Republik Kongo) 1968 TP Mazembe (Demokratische Republik Kongo) 1969 SC Ismaily (Ägypten) 1970 Asante Kotoko (Ghana) 1971 Canon Yaoundé (Kamerun) 1972 Hafia FC (Guinea) 1973 AS Vita Club (Demokratische Republik Kongo) 1974 CARA Brazzaville (Republik Kongo) 1975 Haifa FC Conakry (Guinea) 1976 MC Algier (Algerien) 1977 Hafia FC (Guinea) 1978 Canon Yaoundé (Kamerun) 1979 Union Douala (Kamerun) 1980 Canon Yaoundé (Kamerun) 1981 JS Kabylie(Algerien) 1982 Al-Ahly (Ägypten) 1983 Asante Kotoko (Ghana) 1984 Zamalek SC (Ägypten) 1985 FAR Rabat (Marokko) 1986 Zamalek SC (Ägypten) 1987 Al-Ahly (Ägypten) 1988 ES Sétif (Algerien) 1989 Raja Casablanca (Marokko) 1990 JS Kabylie (Algerien) 1991 Club Africain (Tunesien) 1992 WAC Casablanca (Marokko) 1993 Zamalek SC (Ägypten) 1994 Espérance Tunis (Tunesien) 1995 Orlando Pirates (Südafrika) 1996 Zamalek SC (Ägypten) |
Afrikapokal der Pokalsieger, von 1975 bis 2003 durchgeführter Wettbewerb für die Pokalsieger der Mitgliedsländer der Confédération Africaine de Football (→ CAF) um den Nelson-Mandela-Cup, ausgetragen im → K.-o.-System (mit Hin- und Rückspiel). 1993–2003 spielte der Gewinner gegen den Sieger des → Afrikapokals der Landesmeister um den → Afrika-Supercup.
| Afrikapokal der Pokalsieger: Sieger 1975 Tonnerre Yaoundé (Kamerun) 1976 Shooting Stars (Nigeria) 1977 Enugu Rangers International (Nigeria) 1978 Horoya AC (Guinea) 1979 Canon Yaoundé (Kamerun) 1980 TP Mazembe (Zaïre) 1981 Union Douala (Kamerun) 1982 Al-Mokaoulun Kairo (Ägypten) 1983 Al-Mokaoulun Kairo (Ägypten) 1984 Al-Ahly (Ägypten) 1985 Al-Ahly (Ägypten) 1986 Al-Ahly (Ägypten) 1987 Gor Mahia Nairobi (Kenia) 1988 CA Bizerte (Tunesien) 1989 Al-Merreikh (Sudan) 1990 BBC Lions Gboko (Nigeria) 1991 Power Dynamos Kitwe (Sambia) 1992 Africa Sports Abidjan (Elfenbeinküste) 1993 Al-Ahly (Ägypten) 1994 DC Motema Pembe (Zaïre) 1995 JS Kabylie (Algerien) 1996 Al-Mokaoulun Kairo (Ägypten) 1997 ES Sahel (Tunesien) 1998 Espérance Tunis (Tunesien) 1999 Africa Sports Abidjan (Elfenbeinküste) 2000 Zamalek SC (Ägypten) 2001 Kaizer Chiefs (Südafrika) 2002 WAC Casablanca (Marokko) 2003 ES Sahel (Tunesien) |
Afrikas Fußballer des Jahres, 1970–93 von der frz. Fachzeitschrift „France Football“ (afrikan. Ausgabe) jährlich durch deren Korrespondenten ermittelt und als „Le Ballon d’Or d’Afrique“ („Goldener Ball von Afrika“) überreicht; seit 1994 vom Kontinentalverband, der Confédération Africaine de Football (→ CAF), durchgeführt.
| Afrikas Fußballer des Jahres 1970 S. Keïta (Mali) 1971 I. Sunday (Ghana) 1972 C. Souleymane (Guinea) 1973 T. Bwanga (Zaïre) 1974 P. Mpukila (Demokratische Republik Kongo) 1975 A. Faras (Marokko) 1976 R. Milla (Kamerun) 1977 T. Dhiab (Tunesien) 1978 A. Razak (Ghana) 1979 T. N’Kono (Kamerun) 1980 J. Manga-Onguene (Kamerun) 1981 L. Belloumi (Algerien) 1982 T. N’Kono (Kamerun) 1983 M. Al-Khatib (Ägypten) 1984 T. Abega (Kamerun) 1985 M. Timoumi (Marokko) 1986 B. Zaki (Marokko) 1987 R. Madjer (Algerien) 1988 K. Bwalya (Sambia) 1989 G. Weah (Liberia) 1990 R. Milla (Kamerun) 1991 A. Pelé (Ghana) 1992 A. Pelé (Ghana) 1993 A. Pelé (Ghana) 1994 E. Amunike (Nigeria) 1995 G. Weah (Liberia) 1996 N. Kanu (Nigeria) 1997 V. Ikpeba (Nigeria) 1998 M. Hadji (Marokko) 1999 N. Kanu (Nigeria) 2000 P. M’Boma (Kamerun) 2001 E.-H. Diouf (Senegal) 2002 E.-H. Diouf (Senegal) 2003 S. Eto’o (Kamerun) 2004 S. Eto’o (Kamerun) 2005 S. Eto’o (Kamerun) 2006 D. Drogba (Elfenbeinküste) 2007 F. Kanouté (Mali) 2008 E. Adebayor (Togo) 2009 D. Drogba (Elfenbeinküste) 2010 S. Eto’o (Kamerun) |
Afrikaspiele, svw. → Panafrikanische Spiele.
Afrika-Supercup, CAF: von 1993 bis 2003 durchgeführter Wettbewerb zw. dem Sieger des → Afrikapokals der Landesmeister und dem des → Afrikapokals der Pokalsieger, ausgetragen in jeweils nur einer Begegnung. 2004 abgelöst vom → CAF Super Cup.
| Afrika-Supercup: Sieger 1993 Africa Sports National (Elfenbeinküste) 1994 Zamalek SC (Ägypten) 1995 Espérance Tunis (Tunesien) 1996 Orlando Pirates (Südafrika) 1997 Zamalek SC (Ägypten) 1998 ES Sahel (Tunesien) 1999 ASEC Abidjan (Elfenbeinküste) 2000 Raja Casablanca (Marokko) 2001 Hearts of Oak (Ghana) 2002 Al-Ahly (Ägypten) 2003 Zamalek SC (Ägypten) |
Agali, Victor, nigerian. Angriffsspieler, * 29. Dezember 1978 Lagos; bis 1995 Pricess Jegede (Nigeria), 1996 FC Nitel Lagos, 1997 Olympique Marseille, 1997/98 Sporting Toulon, 1998–2001 Hansa Rostock, 2001–04 FC Schalke 04, 2004/05 OGC Nizza, 2005/06 Kayseri Erciyesspor (Türkei), 2006/07 MKE Ankaragücü (Ankara), 2007/08 Hansa Rostock, 2008/09 Skoda Xanthi, 2009 Anorthosis Famagusta, 2009/10 PAE Levadiakos (Livadia [Griechenland]); 143 Bundesligaspiele (1998–2004; 32 Tore); elf Länderspiele (2000–04; fünf Tore).
Agayev, Kamran, aserbaidschan. Torhüter, * 9. Februar 1986 Davachi; 2001–04 Shafa Baku, 2004–06 PFK Turan (Tovuz [Aserbaidschan]), 2006–11 Xäzär Länkäran; 16 Länderspiele (seit 2008); in Aserbaidschan Torhüter des Jahres 2009.
Ağdam, Aserbaidschan: seit 1993 von armen. Einheiten besetzte und seitdem „ausgestorbene“ Stadt (Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks), in der bis dahin Qarabaĝ Ağdam (→ Baku [3]) beheimatet war.
Agger, Daniel, eigtl. „Daniel Munthe Agger“, dän. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 12. Dezember 1984 Hvidovre (zu Kopenhagen); bis 1996 Rosenhøj BK (Hvidovre), 1996–2006 Brøndby IF (Kopenhagen), 2006–11 FV Liverpool; 33 Länderspiele (seit 2005; vier Tore); WM-Endrunde 2010.
Agius, Gilbert, maltes. Angriffsspieler, * 21. Februar 1974 Valletta; 1992–2001 FC Valletta, 2001 Pisa Calcio, 2001–11 FC Valletta; 121 Länderspiele (1993–2009; acht Tore); in Malta Fußballer des Jahres 2001, 2007.
Agnolin, Luigi („Gigi“), ital. Schiedsrichter, * 21. März 1943 Bassano del Grappa; seit 1961 FIGC-Schiedsrichter, seit 1979 FIFA-Referee; über 30 Länderspiele; WM-Endrunde 1986, 1990; EC-II-Finale 1987; in Italien siebenmal Schiedsrichter des Jahres.
Agoos, Jeffrey („Jeff“), US-amerikan. Abwehrspieler, * 2. Mai 1968 Genf; 1988–90 University of Virginia (USA), 1991 Maryland Bays (USA), 1991–93 Dallas Sidekicks, 1994/95 SV Wehen, 1996–2001 DC United (Washington), 2001–04 San José Earthquakes (USA), 2005 MetroStars (New York); neun Regionalligaspiele (1994/95); 134 Länderspiele (1988–2003; vier Tore); WM-Endrunde 1998, 2002.
Agostino, Paul, austral. Angriffsspieler, * 9. Juni 1975 Adelaide; 1986–88 Polonia Adelaide, 1988–90 Salisbury United (Australien), 1990/91 Hellas West Adelaide, 1991/92 Yverdon-Sport, 1992–95 Young Boys Bern, 1995–97 Bristol City, 1997–2007 TSV München 1860, 2007–09 Adelaide United; 121 Bundesligaspiele (1997–2004; 30 Tore); 20 Länderspiele (1996–2005; neun Tore); olymp. Fußballturnier 1996.
Aguascalientes, Mexiko (Hauptstadt des gleichnamigen Staates); Necaxa FC (Necaxa Fútbol Club), gegr. am 21. August 1923, 1971−82 Atletico Español, seitdem wieder Necaxa FC; Spielkleidung: Rot-Weiß/Weiß/Weiß; Spielort: Colonia Héroes; Stadion: Estadio Victoria, 25 000 Plätze. − INTERNET: www.clubnecaxa.com
Spieler (Auswahl): Á. Aguinaga – I. Basay – C. Blanco – K. Bwalya – A. Delgado – A. Garcia Aspe – H. Gracilazo – C. Hermosillo – L. Hernández – B. Luna – H. Márquez – H. Medford – N. Navarro – R. Peláez – L. und O. Pérez – A. Rias – V. Ruiz – S. Zaraté. – Trainer (Auswahl): R. Arias – E. López Zarza – H. Sánchez.
| Necaxa FC: Internationale Erfolge (Auswahl) CONCACAF-Pokal der Pokalsieger 1994 CONCACAF-Pokal der Landesmeister 1999 |
Agüero, Sergio („Kun“), eigtl. „Sergio Leonel Agüero“, argentin. Angriffsspieler, * 2. Juni 1988 Buenos Aires; 2003–06 CA Independiente (Avellaneda), 2006–11 Atlético Madrid, 2011 Manchester City; 26 Länderspiele (seit 2006; neun Tore); U-20-Weltmeister 2007; WM-Endrunde 2010; Olympiasieger 2008; in Argentinien Fußballer des Jahres 2009.
Águila, CD, El Salvador: → San Miguel.
Aguinaga, Álex, ecuadorian. Mittelfeldspieler, * 9. Juli 1968 Ibarra; 1984–89 LDU Quito, 1989–2003 Necaxa FC (Aguascalientes), 2003 Cruz Azul (Mexiko-Stadt), 2004/05 LDU Quito; 107 Länderspiele (1987–2004; 23 Tore); WM-Endrunde 2002.
Aguirre, Javier, eigtl. „Javier Aguirre Onaindia“, mexikan. Trainer span. Herkunft (Eltern), * 1. Dezember 1958 Mexiko-Stadt; war Angriffsspieler ´(„El Vasco“): bis 1980 Los Angeles Aztecs (USA), 1980–86 CD Guadalajara, 1986 CF Atlante (Cancún), 1986/87 CA Osasuna; 59 Länderspiele (1980–86;13 Tore); WM-Endrunde 1986. – Später Trainer: 1995/96 CF Atlante, 1998–2001 CF Pachuca, 2001/02 Mexiko (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2002]), 2003–06 CA Osasuna, 2006–09 Atlético Madrid, 2009/10 Mexiko (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2010]), 2010/11 Real Saragossa.
Ägypten, Republik im NO Afrikas, 1,001 Mio. km², 83,083 Mio. Ew.; Verband: Egyptian Football Association, Abk. EFA; gegr. 1921, Sitz: Kairo; Mitglied der FIFA seit 1923, der CAF seit 1957; Spielkleidung: Rot/Weiß/Schwarz. – Höchste Spielklasse: Egyptian League (16 Vereine). – INTERNET: www.efa.com.eg
| Ägypten: Erfolge (Auswahl) Afrikameister 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 |
AH, Abk. für Alte Herren (→ Altersmannschaft).
Ahlen, Dtl. (Stadt in Nordrhein-Westfalen); Rot-Weiss Ahlen, entstand am 1. Juni 1996 durch Fusion von TuS Ahlen (gegr. 1948) und Blau-Weiß Ahlen zu LR (Leichtathletik/Rasensport) Ahlen, seit dem 31. Mai 2006 Rot-Weiss Ahlen; Zweite Bundesliga 2000–06, 2008–10; Dritte Liga 2010–11; Spielkleidung: Rot-Weiß/Weiß/Weiß-Rot; Spielort: Stadtteil Ost; Stadion: Wersestadion, 15 000 Plätze. – INTERNET: www.rot-weiss-ahlen.de
Spieler (Auswahl): J. Acquistapace – C. Alder – M. Arnold – M. Bamba – H. Bonan – N.-O. Book – P. Borel – A. Brinkmann – Chiquinho – D. Chitsulo – M. Coulibaly – R. Daschner – R. Deffke – B. di Gregorio – M. Feinbier – D. Felgenhauer – H. Gaißmayer – V. Gerov – K. Großkreutz – M. Hamann – C. Heithölter – O. Hernandez – S. Hille – M. Höttecke – K. Hutwelker – V. Jugovič – R. Kaluźny – M. Ketelaer – S. Kirschstein – O. Kittner – J. Kraus – D. Kumbela – D. Langerbein – R. Maul – B. Meier – M. Miletic – D. Naki – B. N’Diaye – D. Ndjeng – L. Nottbeck – D. Omerbegovic – D. Omodiagbe – N. Patschinski – M. Piossek – C. Răcănel – M. Reus – M. Sağlık – D. Schuster – J. Schwanke – M. Sejna – H. Spörl – M. Taylor – L. Toborg – R. Vata – S. Völzow – D. Vrzogic – M. Zepek – A. Zimmermann. – Trainer (Auswahl): K. Berge – T. Berndsen – H. Bonan – B. Dietz – S. Emmerling – U. Fuchs – C. Hock – J. Krug – S. Kuntz – D. Langerbein – P. Linz – W. Lorant – P. Neururer – I. Peter – U. Rapolder – W. Sandhowe – F. Straka – F.-J. Tenhagen – D. Thioune – A. van Lent – C. Wück – A. Zimmermann.
| Rot-Weiss Ahlen: Erfolge (Auswahl) (Nord-)Regionalligameister 2008 |
Ahlenfelder, Wolf-Dieter („Ahli“), dt. Schiedsrichter, * 11. Februar 1944 Oberhausen; Verein: Rot-Weiß Oberhausen; Landesverband: Fußballverband Niederrhein (FVN); Zweite Bundesliga 1974–88 (77 Spiele); Bundesliga 1975–88 (106 Spiele). Er wurde 1984 vom Dt. Fußball-Bund (DFB) als bester nat. Schiedsrichter mit der “goldenen Pfeife” geehrt.
| W.-D. Ahlenfelder „Meine Güte, das waren herrliche Abende nach den Spielen. Wir haben gesungen und getanzt, und einmal brach sogar der Tisch unter uns zusammen.“ |
Ahn, Jung-Hwan, südkorean. Angriffsspieler, * 27. Januar 1976 Paju; 1998–2001 Daewoo Royals, 2001/02 AC Perugia, 2002/03 Shimizu S-Pulse, 2004/05 Yokohama Marinos, 2005/06 FC Metz, 2006 MSV Duisburg, 2007 Suwon Bluewings, 2008 Busan I’Park; zwölf Bundesligaspiele (2006; zwei Tore); 59 Länderspiele (1997–2007; 16 Tore); WM-Endrunde 2002, 2006, 2010 (nicht eingesetzt).
Aidoo, Lawrence, ghanaischer Angriffsspieler, * 14. Januar 1982 Accra; bis 1998 King Faisal Babies FC Kumasi, 1998/99 Hasaacas Sekondi-Takoradi (Ghana), 1998/99 King Faisal Klub Kumasi, 1999–2003 Borussia Mönchengladbach, 200405 1. FC Nürnberg, 2005–07 Energie Cottbus, 2008 FSV Frankfurt, 2008/09 Kickers Emden, 2010 FC Wegberg-Beeck; 56 Bundesligaspiele (2001–07; fünf Tore); drei Länderspiele (2003).
AIFF, Abk. für All India Football Federation, den Fußballverband von → Indien.
Aigner, 1) Gerhard, dt. Funktionär, * 1. September 1943 Regensburg; spielte 1957–64 beim VfB Regensburg, 1968/69 beim FC Moutier und 1970–79 beim FC Muri-Gümligen (Muri bei Bern); 1963–66 DFB-Schiedsrichter; 1989–99 UEFA-Generalsekretär (ÜBERSICHT → UEFA). – 2) Nina, österr. Angriffsspielerin, * 20. Juni 1980 Antiesenhofen(OÖ); bis 1998 SV Peterskirchen (OÖ), 1998/99 Union Kleinmünchen (Linz), 1999–2001 USC Landhaus (Torschützenkönigin 2000 [27]), 2001–11 Bayern München; 176 Bundesligaspiele (seit 2001; 107 Tore); 29 Länderspiele (1998–2006; sieben Tore); in Österreich VdF-Fußballerin des Jahres 2009.
Ailton („Anton“), eigtl. „Ailton Gonçalves da Silva“, brasilian. Angriffsspieler, * 19. Juli 1973 Mogeiro; bis 1992 Mogi Mirim (São Paulo), 1993/94 Ipiranga FC (Brasilien), 1994/95 Mogi Mirim, 1995/96 Santa Cruz FC (Recife), 1996/97 Guarani FC (Campinas), 1997/98 UANL Tigres (Mexiko), 1998–2004 Werder Bremen (Torschützenkönig 2004 [28]), 2004/05 FC Schalke 04, 2005/06 Beşiktaş JK (Istanbul), 2006 Hamburger SV, 2006/07 Roter Stern Belgrad, 2007 Grasshopper-Club Zürich, 2007/08 MSV Duisburg, 2008 Metalurg Donezk, 2008/09 SCR Altach, 2009 Clube Campinense (Brasilien) und Chongqing Lifan (China), 2010 KFC Uerdingen 05, 2010/11 FC Oberneuland (Bremen); 219 Bundesligaspiele (1998–2008; 106 Tore); in Deutschland Fußballer des Jahres 2004.
| Ailton „Mit 20 musst du rennen, mit 36 musst du gucken.“ |
Aimar, Pablo, eigtl. „Pablo César Aimar“, argentin. Mittelfeldspieler, * 3. November 1979 Rio Cuarto; 1996–2001 CA River Plate (Buenos Aires), 2001–06 CF Valencia, 2006–08 Real Saragossa, 2008–11 Benfica Lissabon; 52 Länderspiele (seit 1999; acht Tore); WM-Endrunde 2006.
Aindling, Dtl. (Gemeinde in Bayerisch-Schwaben); TSV Aindling (Turn- und Sportverein Aindling), gegr. 1946 als TSV Aindling-Todtenweis, seit 1950 TSV Aindling und 1956 Anschluss von TSV Pichl (Ortsteil des Marktes Aindling); Spielkleidung: Rot/Rot/Weiß; Stadion: Am Schüsselhauser Kreuz, 4 000 Plätze. – INTERNET: www.tsv-aindling.de
Spieler (Auswahl): C. Doll – A. Dürr – T. Gebauer – T. Geisler – F. Hönisch – B. Meier – P. Schulz – T. Reiß – M. Schmidt – T. Völker. – Trainer (Auswahl): M. Paula.
| TSV Aindling: Erfolge (Auswahl) Bayerischer Pokal 2003 |
Ajaccio, Frankreich (Hauptort von Korsika); AC Ajaccio (Athletic Club Ajaccio), gegr. 1909; Spielkleidung: Rot/Weiß/Weiß; Stadion: Stade François Coty, 10 700 Plätze. – INTERNET: www.ac-ajaccio.com
Spieler (Auswahl): D. Baratelli – X. Collin – B. Dioméde – A. Dujeux – N. Dzodic – D. Jabi – P. Loko – C. Medjani – M. Pršo – Rodrigo – F. Roux – E. Sansonetti – T. Sylva – M. Trésor – A. Zarabi. – Trainer (Auswahl): D. Bijotat – R. Courbis – B. Gentili – R. Krol – G. Rohr – E. Stojaspal.
Ajax Cape Town, Südafrika: → Kapstadt.
A-Junioren, ÜBERSICHT → Altersklasse.
Akagündüz, Muhammet („Aka“), eigtl. „Muhammet Hanifi Akagündüz“, österr. Angriffsspieler türk. Herkunft, * 11. Januar 1978 Bingöl (Türkei); seit 1987 in Wien, seit 1990 österr. Staatsbürgerschaft; bis 1996 Breitensee/WAT 16 (Ottakring [Wien]), 1996/97 Austria Wien, 1997/98 SV Gerasdorf (NÖ), 1998/99 SKN St. Pölten, 1999 Admira Wacker Mödling, 2000–03 SV Ried, 2003/04 Malatyaspor (Türkei), 2004/05 Konyaspor (Türkei), 2005/06 Rapid Wien, 2006 Kayserispor (Türkei), 2007 Hellas Verona, 2007/08 SV Ried, 2008/09 Manisaspor (Türkei), 2009/10 Admira Wacker Mödling; zehn Länderspiele für Österreich (2002–07; ein Tor).
Akers, 1) Michelle („Mufasa“), US-amerikan. Angriffsspielerin; * 1. Februar 1966 Santa Clara (Kalifornien); 1984–89 University of Central Florida (Collegeteam), 1990, 1992 und 1994 Tyreso FC (Schweden), 1993 Orlando Calibre Soccer Club (USA), 1994–2000 in verschiedenen US-Soccer-Teams; 153 Länderspiele (1985–2000; 105 Tore); WM-Endrunde 1991 (Weltmeisterin), 1995, 1999 (Weltmeisterin); Olympiasiegerin 1996; in den USA Fußballerin des Jahres 1990, 1991, 1999. – 2) Vic, eigtl. „Victor David Akers“, engl. Trainer, * 24. August 1946 London; war Abwehrspieler (Linksverteidiger): 1969–71 Bexley United 1971–74 Cambridge United (England), 1974/75 FC Watford. – Später Trainer: 1987–2009 LFC Arsenal.
| M. Akers Sie wurde 1998 als erste und bisher einzige Frau für ihre außerordentlichen Verdienste um den internationalen Frauenfußball mit dem FIFA-Verdienstorden „Order of Merit“ ausgezeichnet. |
| V. Akers: Erfolgsstationen (Auswahl) LFC Arsenal Landesmeister 1993, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Landespokal 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 UEFA-Women‘s-Cup 2007 |
Akinfeev, Igor (auch „Igor Akinfejew“), russ. Torhüter, * 8. April 1986 Widnoje; 1993–2011 ZSKA Moskau; 44 Länderspiele (seit 2004); EM-Endrunde 2004, 2008; in Russland Torhüter des Jahres 2004, 2005, 2006, 2008.
Akonnor, Charles („Charly“), ghanaischer Trainer, * 12. März 1974 Accra; war Mittelfeldspieler: bis 1988 Young Hearts (Ghana), 1988–90 Okwahu United (Ghana), 1990–92 Obuasi Goldfields, 1992–98 Fortuna Köln, 1998–2004 VfL Wolfsburg, 2004/05 SpVgg Unterhaching, 2005–07 AC Horsens (Dänemark), 2007/08 AEK Larnaka, 2008/09 SC Langenhagen; 121 Bundesligaspiele (1998–2004; 13 Tore); 48 Länderspiele (1992–98); olymp. Fußballturnier 1996; in Ghana Fußballer des Jahres 1994. – Später Trainer: 2009 Sekondi Eleven Wise (Sekondi-Takoradi [Ghana]).
Akpoborie, Jonathan, eigtl. „Charles Kwablan Akonnor“, nigerian. Angriffsspieler (auch dt. Staatsbürgerschaft), * 20. Oktober 1968 Lagos; 1983–88 Julius Berger FC (Lagos), 1988/89 Brooklyn College (USA), 1990–92 1. FC Saarbrücken, 1992–94 Carl Zeiss Jena, 1994/95 Stuttgarter Kickers (Torschützenkönig 1995 [37]), 1995 Waldhof Mannheim, 1996/97 Hansa Rostock, 1997–99 VfB Stuttgart, 1999–2001 VfL Wolfsburg, 2001/02 1. FC Saarbrücken; 144 Bundesligaspiele (1996–2001; 61 Tore); 14 Länderspiele für Nigeria (1995–2002; vier Tore); U-16-Weltmeister 1985.
Akranes, Island (Stadt in der Region Vesturland); IA Akranes (Ithróttabandalag Akranes), gegr. 1946; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Gelb; Stadion: Akranesvöllur, 5 800 Plätze. – INTERNET: www.ia.is
Spieler (Auswahl): G. Finnbogason – O. Gottskálksson – B. und T. Gudjónsson – B. Gudmundsson – A., B. und K. Gunnlaugsson – E. Hafsteinsson – E. Hallgrimsson – D. Hanesson – P. Haraldsson – H. Hjartason – G., P. und S. Jónsson – B. Larusson – J. Leosson – P. Pétursson – T. Pordarsson – S. Reynisson – P. Stefansson – G. Steinsson – H. Sturlaugsson – A. Sveinsson – S. Teitsson – O. und T. Thórdarson. – Trainer (Auswahl): A. und B. Gunnlaugsson – M. Kristiansson – O. Thórdarson.
| IA Akranes: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001 Landespokal 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2003 |
Akrapović, Bruno, bosnisch-herzegowin. Trainer; * 26. September 1967 Zenica; war Mittelfeldspieler: bis 1988 Celik Zenica, 1988–90 Arminia Hannover, 1990/91 1. SC Göttingen 05, 1991/92 TuS Celle, 1992–94 VfL Wolfsburg, 1994–97 1. FSV Mainz 05, 1997–2000 Tennis Borussia, 2000–02 Energie Cottbus, 2003 Rot-Weiß Erfurt, 2003–05 Kickers Offenbach, 2005 Arminia Hannover, 2006–08 SSV Vorsfelde (Wolfsburg); 67 Bundesligaspiele (2000–02); acht Länderspiele für Bosnien & Herzegowina (2000–03; ein Tor). – Später Trainer: 2008 VfL Wolfsburg (Assistent II. Mannschaft), 2008/09 Saturn Ramenskoje (Assistent), 2009/10 Germania Wolfsburg (Spielertrainer).
Aktjubinsk, Kasachstan: andere Schreibweise für → Aqtöbe.
Akwá, eigtl. „Fabrice Alcebiades Maieco“, angolan. Angriffsspieler, * 30. Mai 1977 Benguela; 1994/95 Benfica Lissabon, 1895–97 FC Alverca (Portugal), 1997/98 Académica Coimbra (Portugal), 1999–2001 Al-Ahli (Djidda), 2001–05 Qatar SC (Doha), 2005/06 Al-Wakrah SC (Katar), 2007–09 Petro Atlético (Luanda); 80 Länderspiele (1996–2006; 37 Tore); WM-Endrunde 2006.
Akyel, Fatih, türk. Abwehrspieler, * 26. Dezember 1977 Istanbul; 1994–97 Konyaspor (Türkei), 1997–2001 Galatasaray SK (Istanbul), 2001 RCD Mallorca, 2002–04 Fenerbahçe SK (Istanbul), 2005 VfL Bochum, 2005/06 PAOK Saloniki, 2006/07 Trabzonspor (Türkei), 2007 Gençlerbirliği Ankara, 2007/08 Kasımpaşa SK (Istanbul), 2009 Kocaelispor (Türkei) und Kasımpaşa SK; ein Bundesligaspiel (2005); 64 Länderspiele (1997–2004); WM-Endrunde 2002; EM-Endrunde 2000.
Alaba, David, eigtl.“ David Olatukunbo Alaba“, österr. Mittelfeldspieler philippin. (Mutter) und nigerian. (Vater) Herkunft, * 24. Juni 1992 Wien; bis 2002 SV Aspern (Wien), 2002–08 Austria Wien, 2008–10 Bayern München, 2011 TSG 1899 Hoffenheim und Bayern München; 22 Bundesligaspiele (seit 2010; zwei Tore); zwölf Länderspiele für Österreich (seit 2009).
| D. Alaba Er war bei seinem Länderspieldebüt am 14. Oktober 2009 mit 17 Jahren und 112 Tagen Österreichs jüngster Nationalspieler aller Zeiten. |
Al-Ahli, 1) Jemen: → Sanaa [1]. – 2) Saudi-Arabien: → Djidda [1]. – 3) VAE: → Dubai [1].
Al-Ahli SC, Katar: → Doha [1].
Al-Ahly, Ägypten: → Kairo [1].
Al-Ain, VAE (Stadt im Emirat Abu Dhabi); Al-Ain Club, eigtl. „Al Ain Sports & Culture Club“, gegr. 1968; Spielkleidung: Violett/Weiß/Violett; Stadion: Thanon-Bin-Mohammed-Stadium, 20 000 Plätze. – INTERNET: www.alainteam.com
Spieler (Auswahl): R. Acuña – Edilson – M. Hadji – H. und I. Hassan – N. Jestrović – A. Keïta – H. Mohammed – B. Sanogo – J. Valdivia. – Trainer (Auswahl): Amarildo – T. Cerezo – B. Metsu – W. Schäfer – W. Zenga.
| Al-Ain Club: Internationale Erfolge (Auswahl) AFC Champions League 2003 |
Alajuelense, Costa Rica (Hauptstadt der gleichnamigen Provinz); LD Alajuelense (Liga Deportiva Alajuelense), gegr. am 18. Juni 1919; Spielkleidung: Rot-Schwarz/Schwarz/Rot; Stadion: Alejandro Morera Soto, 17 900 Plätze. – INTERNET: www.ldacr.org
Spieler (Auswahl): W. Alfaro – P. Chinchilla – R. Fonseca – R. Gómez – L. González – C. Hernández – L. Marin – B. Ruiz – M. Solis – H. Wallace. – Trainer (Auswahl): A. Solano.
| LD Alajuelense: Internationale Erfolge (Auswahl) CONCACAF-Pokal der Landesmeister 1986 CONCACAF Champions League 2004 |
Åland United, Finnland: → Mariehamn.
Al-Arabi SC, Katar: → Doha [2].
Alavés, Deportivo, Spanien: → Vitoria-Gasteiz.
Albacete, Spanien (Hauptstadt der gleichnamigen Provinz); Albacete Balompié, gegr. am 1. August 1940 als Albacete FC, seit 1955 Albacete Balompié; Spielkleidung: Blau/Weiß/Rot; Stadion: Estadio Carlos Belmonte, 17 300 Plätze. – INTERNET: www.albacetebalompier.com
Spieler (Auswahl): M. Almunia – E. Amunike – D. Bauzá – L. Biagini – N. Bjelica – A. Cámara – D. Cañas – N. Cuevas – M. Etcheverry – R. González – Héctor – I. Helguera – P. Ibáñez – A. Iniesta – J. Molina – F. Morientes – F. Noguerol – C. Roa – I. Sáez – J. Sanz – I. Urzaiz – R. Valbuena – J. Zalazar. – Trainer (Auswahl): V. Espárrago – C. Ferrando – B. Floro – J. González – M. Monteagudo – J. Rubio – L. Suárez.
Albanien, Republik in SO-Europa, 28 748 km², 3,17 Mio. Ew.; Verband: The Football Association of Albania, Abk. FAA, gegr. 1930, Sitz: Tirana; Mitglied der FIFA seit 1932, der UEFA seit 1954; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Rot. – Höchste Spielklasse: Kategoria Superiore (zwölf Vereine), zweithöchste Spielklasse : Kategoria e parë (16 Vereine). – INTERNET: www.fshf.org
| Albanien: Erfolge (Auswahl) Balkancup 1946 |
Alberman, Gal, israel. Mittelfeldspieler, * 17. April 1983 Petah Tikva; 2000–05 Maccabi Petah Tikva, 2005/06 CD Teneriffa, 2006–08 Beitar Jerusalem, 2008–10 Borussia Mönchengladbach, 2010/11 Maccabi Tel Aviv; 16 Bundesligaspiele (2008–10); 26 Länderspiele (seit 2003; ein Tor); in Israel Fußballer des Jahres 2008.
Albert, 1) Flórián („Császár“), ungar. Trainer, * 15. September 1941 Hercegszántó; war Angriffsspieler (Mittelstürmer): 1958–74 Ferencvárosi TC (Budapest; 339 Ligaspiele; 245 Tore); 75 Länderspiele (1959–74; 32 Tore); WM-Endrunde 1962, 1966; Europapokal der Nationen 1964 (Dritter), EM-Endrunde 1972; olymp. Fußballturnier 1960; Europas Fußballer des Jahres 1967. – Später Trainer: 1975/76 Al-Ahli Banghazi (Libyen). – 2) Phillippe („Jef“), belg. Abwehrspieler, * 10. August 1967 Bouillon; 1976–85 FC Bouillon, 1985–89 Sporting Charleroi, 1989–92 KV Mechelen, 1992–94 RSC Anderlecht, 1994–98 Newcastle United, 1999 FC Fulham, 1999/2000 Sporting Charleroi; 41 Länderspiele (1987–97; fünf Tore); WM-Endrunde 1990, 1994; in Belgien Fußballer des Jahres 1992.
| F. Albert Das Stadion von Ferencvárosi TC erhielt 2007 den Namen „Flórián -Albert-Stadion“. |
Albertini, Demetrio, ital. Mittelfeldspieler, * 23. August 1971 Besana Brianza; 1988–90 AC Mailand, 1990/91 Calcio Padova, 1991–2002 AC Mailand, 2002/03 Atlético Madrid, 2003/04 Lazio Rom, 2004/05 Atalanta Bergamo, 2005 FC Barcelona; 79 Länderspiele (1989–2002; zwei Tore); U-21-Europameister 1992; WM-Endrunde 1994, 1998; EM-Endrunde 1996, 2000; olymp. Fußballturnier 1992.
Albertosi, Enrico, ital. Torhüter, * 2. November 1939 Pontremoli; bis 1958 Spezia Calcio (La Spezia), 1958–68 AC Florenz, 1968–74 Cagliari Calcio, 1974–80 AC Mailand; 34 Länderspiele (1961–72); WM-Endrunde 1962 (nicht eingesetzt), 1966, 1970, 1974 (nicht eingesetzt); EM-Endrunde 1968 (Europameister [nicht eingesetzt]).
Albertz, Jörg, dt. Mittelfeldspieler, * 29. Januar 1971 Mönchengladbach; 1975–78 PSV Mönchengladbach, 1978–90 Borussia Mönchengladbach, 1990–93 Fortuna Düsseldorf, 1993–1996 Hamburger SV, 1996–2001 Glasgow Rangers, 2001–03 Hamburger SV, 2003/04 Shanghai Shenhua, 2004/05 SpVgg Greuther Fürth, 2005–07 Fortuna Düsseldorf, 2008 FC Clyde (Schottland); 150 Bundesligaspiele (1990–2003; 29 Tore); drei Länderspiele (1996–98); in China Fußballer des Jahres 2003.
„Albiceleste“ [„Weiß-Hellblaue“], Bez. für die argentin. Nationalmannschaft.
AlbinoLeffe, UC (Unione Calcio AlbinoLeffe; nach den Ortschaften Albino und Leffe [bei Bergamo]), Italien (Region Lombardei), entstand 1998 durch Fusion von Leffe Calcio (gegr. 1938) und Albinese Calcio (gegr. 1969); Spielkleidung: Hellblau/Dunkelblau/Dunkelblau; Stadion: Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo), 24 726 Plätze. – INTERNET: www.albinoleffe.com
Spieler (Auswahl): R. Bonazzi – K. Conteh – A. dal Canto – I. del Prato – R. Garlini – M. Gobbi – M. Gritti – V. Iacopino – F. Inzaghi – M. Poloni – G. Signori. – Trainer (Auswahl): E. Gustinetti – E. Mondonico.
Albiol, Raúl, Spanien: → Raúl Albiol.
Albirroja [„Weiß-Rote“], Bez. für die paraguay. Nationalmannschaft.
Ålborg, Dänemark: andere Schreibweise für → Aalborg.
Albrecht, 1) Ernst, dt. Angriffsspieler (Rechtsaußen), * 12. November 1907 Düsseldorf, † 26. März 1976; 1924–44 Fortuna Düsseldorf, 1951/52 PSV Düsseldorf; 17 Länderspiele (1928–34; vier Tore); WM-Endrunde 1934 (nicht eingesetzt); olymp. Fußballturnier 1928. – 2) Hermann, dt. Schiedsrichter, * 1. September 1961 Buchenberg (Bayerisch-Schwaben); Verein: SpVgg Kaufbeuren; Landesverband: Bayer. Fußballverband (BFV); DFB-Schiedsrichter seit 1985; FIFA-Referee 1993–2003; Zweite Bundesliga 1987–2005 (84 Spiele); Bundesliga 1989–2005 (192 Spiele); zehn Länderspiele; 28 EC-Spiele; UEFA-Wettbewerb U 16 1994 (u. a. Finale); U-20-WM-Endrunde 1995; DFB-Pokal-Finale 2001; 2003 kurzzeitig K-League.
Al-Chubar, Saudi-Arabien (Stadt am Pers. Golf); Al-Qadisiya, gegr. 1967; Spielkleidung: Gelb/Rot/Gelb; Stadion: Prince Saud bin Jalawi Stadium, 10 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): Y. Al-Qahtani – J. Cominges – J. Pivarnik. – Trainer (Auswahl): D. Dimitrow – J. und R. Pivarnik.
Alcock, Charles, engl. Klubfunktionär, * 2. Dezember 1842 Sunderland, † 26. Februar 1907; gründete 1859 – nach Absolvierung der Harrow School – mit seinem Bruder John Alcock und „Old Harrovians“ (Absolventen der Harrow School) den Forest Football Club, der sich dem „Dribbling Game“ verschrieb. Nachfolgeverein seit 1864 war der Wanderers FC, der das 1-1-2-7-System (→ Spielsystem) praktizierte. Alcock war Mittelstürmer und bestritt 1875 sein einziges Länderspiel, in dem er ein Tor erzielte. – 1863 war er Mitbegründer der Football Association (FA) und Inspirator eines internat. Regelwerks. 1869 publizierte er seine berühmten Fußballannalen („Football Annuals“).
Aldair, eigtl. „Aldair Santos do Nascimento“, brasilian. Abwehrspieler, * 30. November 1965 Ilhéus; 1985–89 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 1989/90 Benfica Lissabon, 1990–2003 AS Rom (330 Ligaspiele), 2003/04 CFC Genua, 2007–09 SS Murata; 81 Länderspiele (1989–2000; drei Tore); WM-Endrunde 1990, 1994 (Weltmeister), 1998; olymp. Fußballturnier 1996; Südamerikameister 1995.
Al-Deayea, Mohammad, saudi-arab. Torhüter, * 2. August 1972 Al-Tae; 1991–99 Al-Tae SC, 1999–2006 Al-Hilal (Riad); 177 Länderspiele (1990–2006); U-16-Weltmeister 1989; WM-Endrunde 1994, 1998, 2002, 2006 (nicht eingesetzt); Asiens Torhüter des (20.) Jahrhunderts.
Al-Dschaisch, Syrien: → Damaskus.
A-League, höchste Spielklasse in → Australien.
Alejnikov, Sergej (auch „Sergei Aleinikov“), weißruss. Trainer, * 7. November 1961 Minsk; war Mittelfeldspieler: 1975–81 Burewestnik Minsk, 1981–89 Dinamo Minsk, 1989/90 Juventus Turin, 1990–92 US Lecce, 1992–95 Gamba Osaka, 1996 IK Oddevold (Schweden), 1996–98 USC Corigliano (Italien); 77 Länderspiele für die UdSSR bzw. GUS (1984–92; vier Tore); WM-Endrunde 1986, 1990; EM-Endrunde 1988, 1992. – Später Trainer: 2002/03 FK Moskau, 2003–05 US Lecce (Fußballakademie), 2005–07 Juventus Turin (Jugend), 2007/08 NK Kras AED (Monrupino [Italien]).
Alemannia 90 Wacker, BFC, Dtl.: → Berlin [4].
Alemão, eigtl. „Ricardo Rogério de Brito“, brasilian. Mittelfeldspieler, * 22. November 1961 Lavras; 1975–80 CD Lavras, 1980–86 Botafogo FR (Rio de Janeiro), 1987/88 Atlético Madrid, 1988–92 SSC Neapel, 1992–94 Atalanta Bergamo, 1994–96 FC São Paulo, 1996 FC Volta Redonda (Brasilien); 39 Länderspiele (1983–90; drei Tore); WM-Endrunde 1986, 1990.
Alenichev, Dmitriy (auch „Dmitri Alenitschew“), russ. Mittelfeldspieler, * 20. Oktober 1972 Welikije Luki; 1990–93 Lokomotive Moskau, 1994–98 Spartak Moskau, 1998/99 AS Rom, 2000 AC Perugia, 2000–04 FC Porto, 2004–06 Spartak Moskau; 55 Länderspiele (1996–2005; sechs Tore); WM-Endrunde 2002; EM-Endrunde 2004; in Russland Fußballer des Jahres 1997.
Aleppo, Syrien (Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements); Al-Ittihad, eigtl. „Al-Ittihad of Aleppo“, gegr. 1953; Spielkleidung: Rot; Stadion: Aleppo International, 75 000 Plätze. – INTERNET: www.ittihadaleppo.com
Spieler (Auswahl): A. F. Alagha – A. Dakka – O. E. Edet – M. Farres – O. Hemidi – M. Kailouni – A. H. Mohamad – B. Tarab. – Trainer (Auswahl): D. Racolta – V. Tita.
| Al-Ittihad: Internationale Erfolge (Auswahl) AFC Cup 2010 |
Alessandria, Italien (Stadt in Piemont); US Alessandria (Unione Sportiva Alessandriagegr. 1912 als FC Alessandria, 1920 Fusion mit Unione Sportiva Alessandrina (gegr. 1915) zu US Alessandria; Spielkleidung: Silbergrau/Schwarz/Schwarz; Stadion: Giuseppe Moccagatta, 4 981 Plätze. – INTERNET: www.alessandriacalcio.it
Spieler (Auswahl): F. Artico – A. Baloncieri – G. Bercellino – L. Bertolini – P. Bisoli – A. Bolla – M. Briano – G. Camolese – C. Carcano – M. Carrera – F. Cozza – G. Ferrari – G. Iachini – M. Pelatti – S. Porrini – P. Rava – E. Reja – G. Rivera – A. Servili – R. Vonlanthen – G. Zappella. – Trainer (Auswahl): A. Baloncieri – S. Jacolino – Á. Weisz.
Ålesund, Norwegen (Stadt in der Region Vestlandet); Aalesunds FK (Aalesunds Fotballklubb), gegr. am 25. Juni 1914; Spielkleidung: Orange/Blau/Orange; Stadion: Color Line, 10 778 Plätze. – INTERNET: www.aafk.no
Spieler (Auswahl): T. Aarøy – D. Arnefjord – J. Arneng – J. Aubynn – E. Jääger – B. Kibebe – A. Lindegaard – M. Nylund – B. H. und J. A. Riise. – Trainer (Auswahl): E. Olsen – K. A. Rekdal.
| Aalesunds FK: Erfolge (Auswahl) Landespokal 2009 |
Alex, 1) eigtl. „Alexsandro de Souza“, brasilian. Mittelfeldspieler, * 14. September 1977 Curitiba; 1995–97 Coritiba FC (Curitiba), 1997–2000 SE Palmeiras (São Paulo), 2000 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 2001 SE Palmeiras und Cruzeiro EC (Belo Horizonte), 2002 SE Palmeiras und AC Parma, 2002–04 Cruzeiro EC, 2004–11 Fenerbahçe SK (Istanbul; Torschützenkönig 2007 [19], 2011 [28]); 48 Länderspiele (1998–2005; zwölf Tore). – 2) eigtl. „Alessandro dos Santos“ jap. Abwehrspieler brasilian. Herkunft (seit 2001 jap. Staatsbürgerschaft), * 20. Juli 1977 Maringá (Brasilien); 1986–94 Grêmio Maringá, 1994–97 Meitokugijuku Highschool (Japan), 1997–2003 Shimizu S-Pulse, 2004–06 Urawa Red Diamonds, 2007 RB Salzburg, 2008/09 Urawa Red Diamonds, 2009–11 Nagoya Grampus; 82 Länderspiele für Japan (2002–06; sieben Tore); WM-Endrunde 2002, 2006; in Japan Fußballer des Jahres 1999.
Alex Alves, eigtl. „Alexandro Alves do Nascimento”, brasilian. Angriffsspieler, * 30. Dezember 1974 Campo Formoso; 1993/94 EC Vitória (Salvador), 1994/95 SE Palmeiras (São Paulo), 1996/97 Portuguesa São Paulo, 1998/99 Cruzeiro EC (Belo Horizonte), 1999–2003 Hertha BSC, 2003 Atlético Mineiro (Belo Horizonte), 2004 Vasco da Gama (Rio de Janeiro), 2005 EC Vitória, 2007 Boavista SC (Brasilien), 2008 Fortaleza EC (Brasilien), 2008/09 AO Kavala, 2009 Fortaleza EC; 81 Bundesligaspiele (1999–2003; 25 Tore).
Alexandersson, Niclas, schwed. Mitelfeldspieler, * 29. Dezember 1971 Halmstad; 1988–95 Halmstads BK, 1996/97 IFK Göteborg, 1997–2000 Sheffield Wednesday, 2000–03 FC Everton, 2003 West Ham United und FC Everton, 2004–08 IFK Göteborg; 109 Länderspiele (1993–2008; sieben Tore); WM-Endrunde 2002, 2006; EM-Endrunde 2000, 2008.
Alexandris, Alexandros („Alexios“), griech. Angriffsspieler (Mittelstürmer), * 21. Oktober 1968 Kiato; bis 1984 Pelopas Kiato, 1984–86 Anagennisi Kiato, 1986–91 Veria FC (Griechenland), 1991–94 AEK Athen (Torschützenkönig 1994 [24, mit K. → Warzycha]), 1994–2004 Olympiakos Pyräus (Torschützenkönig 1994 [23], 2001 [20], 2002 [19]), 2004 AE Larisa, 2005 Kallithea FC (Griechenland), 2005/06 APOP Kinyras (Zypern; Spielertrainer); 42 Länderspiele (1991–2002; zehn Tore); WM-Endrunde 1994; in Griechenland Fußballer des Jahres 2001.
Alex Silva, eigtl. „Alex Sandro da Silva“, brasilian. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 10. März 1985 Amparo; Bruder von → Luisão; bis 2000 Rio Branco EC (Americana [Brasilien]), 2000–02 Ponte Preta (Campinas), 2003–05 EC Vitória (Salvador), 2006–08 FC Sao Paulo, 2008/09 Hamburger SV, 2010/11 FC Sao Paulo, 2011 Hamburger SV; 17 Bundesligaspiele (seit 2008); zwei Länderspiele (seit 2007); olymp. Fußballturnier 2008.
Al-Faisaly, Jordanien: → Amman [1].
Algarve, Portugal: südlichste Region des Landes; Hauptort: Faro.
| Algarve: Vereine (Auswahl) SC Farense SC Olhanense |
Algarve-Cup, Frauenfußball: seit 1994 in der Region → Algarve jährlich im Fühjahr veranstaltetes Turnier für Nationalmannschaften; neben den Olymp. Spielen sowie den Welt- und Europameisterschaften das bedeutendste internat. Turnier (deshalb auch „Mundialito“ genannt). In zwei Gruppen spielen je vier Mannschaften gegeneinander, es folgen Platzierungsspiele um Platz sieben (Vierter gegen Vierter), Platz fünf (Dritter gegen Dritter), Platz drei (Zweiter gegen Zweiter) und Finale (Erster gegen Erster). – Bekannteste Spielorte sind Faro, Portimão, Olhão und Albufeira.
| Algarve-Cup: Sieger | |||
| 1994 | Norwegen | 2003 | USA |
| 1995 | Schweden | 2004 | USA |
| 1996 | Norwegen | 2005 | USA |
| 1997 | Norwegen | 2006 | Deutschland |
| 1998 | Norwegen | 2007 | USA. |
| 1999 | China | 2008 | USA |
| 2000 | USA | 2009 | Schweden |
| 2001 | Schweden | 2010 | USA |
| 2002 | China | 2011 | USA |
Algerien, Republik in N-Afrika, 2,382 Mio. km², 32,819 Mio. Ew; Verband: Fédération Algérienne de Football, Abk. FAF, gegr. 1962, Sitz: Algier; Mitglied der FIFA seit 1963, der CAF seit 1964; Spielkleidung: Weiß. – Höchste Spielklasse: Championnat National de Première Division (18 Vereine). – INTERNET: www.faf.org.dz
| Algerien: Erfolge (Auswahl) Afrikameister 1990 |
Al-Gharafa, Katar: → Doha [3].
Algier (frz. Alger), Hauptstadt von Algerien; MC Algier, eigtl. „MC Alger“ (Mouloudia Club d’Alger), gegr. 1921; Spielkleidung: Rot; Stadion: Stade 5 Juillet 1962, 66 000 Plätze. – INTERNET: www.mouloudia.org
Spieler (Auswahl): M. Aberrane – L. Belloumi – A. Besseghir – H. Bougueche – I. Bouzid – N. Daham – F. Hadjadj – M. Ouahmane – R. Saïfi. – Trainer (Auswahl): E. Fabbro – M. Renquin.
| MC Algier: Internationale Erfolge (Auswahl) Afrikapokal der Landesmeister 1976 |
Al-Hilal, Saudi-Arabien: → Riad [1].
Al-Hilal Khartum, Sudan: → Khartum [1].
Alianza FC, El Salvador: → San Salvador [1].
Alicante, Spanien (Stadt in der Region Valencia); Hércules Alicante, eigtl. „Hércules CF“ (Hércules Club de Fútbol), gegr. 1922; Spielkleidung: Blau-Weiß/Schwarz/Blau; Stadion: Estadio José Rico Pérez, 29 584 Plätze. – INTERNET: herculescf.es
Spieler (Auswahl): K. Agassa – S. Aragonés – P. Artner – Capdevila – D. Cortes – R. Drenthe – F. J. Farinos – S. Fernandéz – J. Fusté – A. Galindo – Giuliano – P. Graff – J. Jancović – M. Kempes – Moisés – A. Montenegro – D. Pavlicić – F. Pena – J. Portillo – J. Redondo – Rufete – G. Saccardi – D. Sanabria – R. Schiavi – J. Tomaszewski – Tote – D. Trezeguet – Urbano – N. Valdez – J. Visnjić. – Trainer (Auswahl): J. Bordalás – M. Djukić – S. Kocsis – M. Muñoz – A. Olaskoaga – F. Puskás – A. Ramallets – E. Vigo.
Al-Ittihad, Asien: 1) Katar: → Doha [3]. – 2) Libyen: → Tripolis. – 3) Saudi-Arabien: → Djidda [2]. – 4) Syrien: → Aleppo.
Aliyev, Oleksandr (auch „Aleksandr Alijew“), ukrain. Mittelfeldspieler, * 3. Februar 1985 Chabarowsk (Russland); 2001/02 Borispol Kiew, 2002–05 Dynamo Kiew, 2006 Metalurg Saporoschje, 2006 –10 Dynamo Kiew, 2010/11 Lokomotive Moskau; zwölf Länderspiele für die Ukraine (seit 2008; vier Tore).
Al-Jaber, Sami (auch “Sami Abdullah al-Dschabir“), saudi-arab. Angriffsspieler,* 11. Dezember 1972 Riad; 1987–2000 Al-Hilal (Riad), 2000 Wolverhampton Wanderers, 2001–06 Al-Hilal (Riad); 158 Länderspiele (1992–2006; 44 Tore); WM-Endrunde 1994, 1998, 2002, 2006.
Al-Jazira Club, VAE: → Abu Dhabi [1].
Al-Karama, Syrien: → Homs.
Al-Kharitiyath, Katar (Stadt bei Ar-Rayyan); Al-Kharitiyath SC (Al-Kharitiyath Sports Club), gegr. 1996 als Al Hilal SC, seit 2004 Al-Kharitiyath SC; Spielkleidung: Blau/Weiß/Blau; Spielort: Ar-Rayyan; Stadion: Ahmed bin Ali, 25 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): M. Abdulrabb – A. Darwish – Y. Kébé – D. Khan – S. Nasrullah – O. Okonkwo – J. Sultan. – Trainer (Auswahl): B. Simondi.
Al-Khor, Stadt in Katar; Al-Khor SC (Al-Khor Sports Club), gegr. 1961 als Al-Taawun, seit 2002 Al-Khor SC; Spielkleidung: Blau; Stadion: Al-Khawr, 20 000 Plätze. – INTERNET: www.alkhor-club.com
Spieler (Auswahl): B. Abdoulaye – E. Awal – M. Dagano – B. Gebril – N. Jalal – M. Karim – Y. Mahmud – M. Mubarak – Q. Munir – S. Shaker – M. Yasser. – Trainer (Auswahl): B. Marchand – A. Perrin.
Alkmaar, Niederlande (Stadt in Nordholland); AZ Alkmaar, eigtl. „AZ“ (Alkmaar-Zaanstreek), entstand 1967 nach Zusammenschluss von FC Zaanstreek und VV Alkmaar (gegr. 1954) als AZ ’67 Alkmaar, seit 1986 AZ Alkmaar; Spielkleidung: Rot/Weiß/Weiß; Stadion: DSB, 17 000 Plätze. – INTERNET: www.az.nl
Spieler (Auswahl): Ari – P. Arntz – S. Arveladze – P. Cocu – S. Cziommer – T. de Cler – M. Dembélé – D. de Zeeuw – J. Didulica – J. Efring – M. El Hamdaoui – F. Ewert – J. Hasselbaink – J. Holland – B. Holman – H. Hovenkamp – K. Jaliens – W. Kist – D. Koevermans – R. Landerl – M. Martens – J. Mathijsen – M. Meerdink – J. Metgot – M. Moisander – H. Moreno – K. Nygaard – B. Opdam – G. Pelle – J. Peters – S. Pocognoli – S. Poulsen – M. Ramljak – F. Ricksen – S. Romero – S. Schaars – F. Schinkels – G. Siedl – K. Sinouh – R. Spelbos – E. W. Treytel – L. van Gaal – B. van Galen – W. van Hanegem – B. van Marwijk – H. Visser – M. Vonk. – Trainer (Auswahl): C. Adriaanse – D. Advocaat – H. Eijenkeenbrook – W. Frank – G. Keßler – R. Koeman – H. J. Kraay – J. Notermans – G. van der Lem – L. van Gaal – W. van Hanegem – H. van Stee – G. Verbeek.
| AZ Alkmaar: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1981, 2009 Landespokal 1978, 1981, 1982 |
Alkorta, Rafael, eigtl. “Rafael Alkorta Martinez”, span. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 16. September 1968 Bilbao; 1978–93 Athletic Bilbao, 1993–97 Real Madrid, 1997–2002 Athletic Bilbao; 58 Länderspiele (1989–98; vier Tore); WM-Endrunde 1990, 1994, 1998; EM-Endrunde 1996.
Al-Kuwait Kaifan, Kuwait: → Kuwait-Stadt [2].
Allagui, Sami, tunes. Angriffsspieler (auch dt. Staatsbürgerschaft), * 28. Mai 1986 Düsseldorf (Dtl.); 1993–99 FC Büderich (NRW), 1999–2002 Fortuna Düsseldorf, 2002–05 Alemannia Aachen, 2005/06 RSC Anderlecht, 2007 KSV Roeselare, 2007/08 Carl Zeiss Jena, 2008–10 SpVgg Greuther Fürth, 2010/11 1. FSV Mainz 05; 13 Bundesligaspiel (2010; sechs Tore); neun Länderspiele für Tunesien (seit 2008; zwei Tore).
Allardyce, Sam („Big Sam“), eigtl. „Samuel Allardyce“, engl. Trainer, * 19. Oktober 1954 Dudley; war Abwehrspieler: 1973–80 Bolton Wanderers, 1980/81 AFC Sunderland, 1981–83 FC Millwall, 1983 Tampa Bay Rowdies, 1983/84 Coventry City, 1984/85 Huddersfield Town, 1985/86 Bolton Wanderers, 1986–89 Preston North End, 1989–91 West Bromwich Albion, 1991/92 FC Limerick (Irland; Spielertrainer). – Später Trainer: 1992/93 Preston North End (Assistent), 1994–96 FC Blackpool, 1997–99 Notts County, 1999–2007 Bolton Wanderers, 2007/08 Newcastle United, 2008–10 Blackburn Rovers, 2011 West Ham United.
Allbäck, Marcus, schwed. Angriffsspieler,* 5. Juli 1973 Göteborg; 1992–97 Örgryte IS (Göteborg), 1997 Lyngby FC, 1997/98 AS Bari, 1998–2000 Örgryte IS (Torschützenkönig 1999 [15]), 2001–02 SC Heerenveen, 2002–04 Aston Villa, 2004/05 Hansa Rostock, 2005–08 FC Kopenhagen, 2008/09 Örgryte IS; 23 Bundesligaspiele (2004/05; vier Tore); 74 Länderspiele (1999–2008; 30 Tore); WM-Endrunde 2002, 2006; EM-Endrunde 2000 (nicht eingesetzt), 2004, 2008.
Allchurch, Ivor, walis. Angriffsspieler, * 16. Dezember 1929 Swansea, † 10. Juli 1997 ebenda; 1947–58 Swansea Town, 1958–62 Newcastle United, 1962–65 Cardiff City, 1965–68 Swansea Town, 1968 Worcester City (England); 68 Länderspiele (1951–66; 24 Tore); WM-Endrunde 1958.
| I. Allchurch Er wurde 1966 zum „Member of the British Empire“ (MBE) ernannt. |
Allegri, Massimiliano, ital. Trainer, * 11. August 1967 Livorno; war Mittelfeldspieler: 1984/85 UF Cuoiopelli (Santa Croce [Italien]), 1985–88 AS Livorno, 1988/89 Pisa Calcio, 1989/90 AS Livorno, 1990/91 AC Pavia (Italien), 1991–93 Pescara Calcio, 1993–95 Cagliara Calcio, 1995–97 Perugia Calcio, 1997/98 Calcio Padova, 1998 SSC Neapel, 1998–2000 Pescara Calcio, 2000/01 AC Pistoiese, 2001–03 Aglianese Calcio (Agliano [Italien]). – Später Trainer: 2003/04 Aglianese Calcio, 2004/05 SPAL Ferrara (Italien), 2005–07 US Grosseto (Italien), 2007/08 Sassuolo Calcio (Italien), 2008–10 Cagliari Calcio, 2010/11 AC Mailand (Landesmeister 2011); in Italien Trainer des Jahres 2009, 2010.
Allemandi, Luigi, ital. Abwehrspieler, * 8. November 1903 San Damiano Macra, † 25. September 1978 Pietra Ligure; 1921–25 AC Legnano (Italien), 1925–27 Juventus Turin, 1927–35 Inter Mailand, 1935–37 AS Rom, 1937/38 AFC Venezia, 1938/39 Lazio Rom; 24 Länderspiele (1925–36); Weltmeister 1934.
Allemann, Anton („Toni“), schweizer. Mittelfeldspieler (Außenläufer), * 6. Januar 1936, † 3. August 2008 Klosters (Kt. Graubünden); 1957–61 Young Boys Bern, 1961–63 AC Mantova, 1963/64 PSV Eindhoven, 1964–66 1. FC Nürnberg, 1966–68 Grasshopper-Club Zürich, 1968/69 FC La Chaux-de-Fonds, 1969–72 FC Solothurn, 1972/73 FC Schaffhausen (Spielertrainer); 50 Bundesligaspiele (1964–66; acht Tore); 27 Länderspiele (1958–66; neun Tore); WM-Endrunde 1962.
Allerheiligen bei Wildon, Österreich (Gemeinde in der Steiermark); SV Allerheiligen, eigtl. „USV Allerheiligen“ (Union-Sportverein Allerheiligen), gegr. am 30. Mai 1967; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Schwarz; Stadion: Sportanlage Allerheiligen, 1 500 Plätze. – INTERNET: www.svallerheiligen.at
Spieler (Auswahl): A. Huter – A. Kasch – K.-H. Puntigam – B. Sambolec – D. Sauer – M. Six. – Trainer (Auswahl): U. Kleindienst – A. Moriggl – M. Posch.
| SV Allerheiligen: Erfolge (Auswahl) (Mitte-/West-) Oberligameister 2001 |
Allgäu, Dtl.: Alpen- und Voralpenland östl. vom Bodensee, erstreckt sich u. a. über den südl. Teil von Bayerisch-Schwaben und den SO-Zipfel von Baden-Württemberg.
| Allgäu: Vereine (Auswahl) SpVgg Kaufbeuren FC Kempten FC Wangen |
Allgöwer, Karl („Wasen-Karle“), dt. Mittelfeldspieler, * 5. Januar 1957 Geislingen an der Steige (Württemberg); 1965–72 SV Altenstadt (Geislingen an der Steige), 1972–77 SC Geislingen, 1977–80 Stuttgarter Kickers, 1980–91 VfB Stuttgart; 338 Bundesligaspiele (1980–91; 129 Tore); zehn Länderspiele (1980–86); WM-Endrunde 1986 (nicht eingesetzt). – Sein Bruder Ralf Allgöwer (* 1964) war ebenfalls Mittelfeldspieler: 1986/87 VfB Stuttgart, 1987–89 Stuttgarter Kickers, 1989–94 SSV Ulm 1846, 1994–96 VfB Stuttgart; 13 Bundesligaspiele (1986–89; ein Tor).
Allianz-Arena [nach der Versicherungsgruppe Allianz AG Holding], München-Fröttmaning: Heimstätte von Bayern München und von TSV München 1860; erbaut Oktober 2002 bis April 2005, 69 000 Plätze (auf drei Rängen). Dach und Fassade bestehen aus rautenförmigen Kissen (0,2 mm dickes Tetrafluorethylen), die rot (Bayern) oder blau (1860) beleuchtet werden können; WM-Stadion 2006.
Allofs, 1) Klaus, dt. Funktionär; * 5. Dezember 1956 Düsseldorf-Gerresheim; Bruder von [2]; war Angriffsspieler: 1964–72 TuS Gerresheim, 1972–81 Fortuna Düsseldorf (Torschützenkönig 1979 [20]), 1981–87 1. FC Köln (Torschützenkönig 1985 [26]), 1987–89 Olympique Marseille, 1989/90 Girondins Bordeaux, 1990–93 Werder Bremen; 424 Bundesligaspiele (1975–93; 177 Tore); 56 Länderspiele (1978–88; 17 Tore); WM-Endrunde 1986; EM-Endrunde 1980 (Europameister [Torschützenkönig: 3]), 1984. – Später Trainer (1998/99 Fortuna Düsseldorf) und Funktionär: 1999–2011 Werder Bremen (1999–2003 Sportdirektor, 2003–09 Geschäftsführer Profifußball, 2009–11 Vorsitzender der Geschäftsführung). – 2) Thomas, dt. Angriffsspieler,* 17. November 1959 Düsseldorf-Gerresheim; Bruder von [1]; bis 1978 TuS Gerresheim, 1978–82 Fortuna Düsseldorf, 1982–86 1. FC Kaiserslautern, 1986–89 1. FC Köln (Torschützenkönig 1989 [17, mit R. → Wohlfarth]), 1989/90 RC Straßburg, 1990–92 Fortuna Düsseldorf; 378 Bundesligaspiele (1978–92; 148 Tore).
„All Whites“, Bez. für die neusseländ. Nationalmannschaft.
Almaty (1921–93 Alma-Ata), Kasachstan (bis 1997 Hauptstadt des Landes); 1) FK Almaty (Futbolnyi Klub Almaty), gegr. 2000 als FC Zesna Almaty, 2004–09 FK Almaty, 2009 Fusion mit MegaSport Almaty zu Lokomotive Astana (→ Astana [2]) und Wechsel nach dorthin; Spielkleidung: Rot/Weiß/Weiß; Stadion: Zentralstadion Almaty, 25 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): M. Azovskiy – D. Byakov – J. Irismetov – S. Larin – V. Likhobabenko – O. Litvinenko – S. Ostapenko – D. Rodionov – A. Sriubas – A. Trawin – E. Valuta. – Trainer (Auswahl): E. Hess – B. Storck.
| FK Almaty: Erfolge (Auswahl) Landespokal 2006 |
2) Kairat Almaty, eigtl. „FK Kairat Almaty“ (Futbolnyi Klub Kairat Almaty), gegr. am 23. November 1952 als Dinamo Alma-Ata, 1954/55 Lokomotive Alma-Ata, 1955/56 Uroschai Alma-Ata, 1990–93 FC Alma-Ata, seitdem Kairat Almaty; Spielkleidung: Rot/Blau/Blau; Stadion: Zentralstadion Almaty, 25 000 Plätze. – Der Verein wurde 2009 vom Spielbetrieb der Liga ausgeschlössen.
Spieler (Auswahl): V. Artemov – D. Bjakov – A. Bogomolov – G. Bošković – S. Boychenko – G. Gochkuliev – A. Kadyrkulov – V. Karpenko – A. Karpovich – A. Kuchma – V. Likhobabenko – P. Shopov – J. Sjomin – S. Smakov – A. Trawin. – Trainer (Auswahl): J. Gregory – Z. Krmpotic – L. Paphomov.
| Kairat Almaty: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1992, 2004 Landespokal 1992, 1996, 2000, 2001*, 2003 * Mit Zhenis Astana |
Almeida, Hugo, Portugal: → Hugo Almeida.
Almelo, Niederlande (Stadt in Overijssel); Heracles Almelo, gegr. am 3. Mai 1903; Spielkleidung: Weiß-Schwarz/Schwarz/Weiß-Schwarz; Stadion: Polman, 8 500 Plätze. – INTERNET: www.heracles.nl
Spieler (Auswahl): B. Daelemans – R. De Vries – R. Friend – N.-J. Hoogma – S. Lakić – R. Maas – K. Michalke – M. Nurmela – M. Pieckenhagen – M. Smit – S. Tanghe – H. ten Cate. – Trainer (Auswahl): P. Bosz – R. Brood – G. Heerkes – F. Korbach – H. ten Cate – G. Verbeek.
Almeria, Spanien (Stadt in Andalusien); UD Almeria (Unión Deportivo Almeria), gegr. am 10. Januar 2001 durch Fusion von Almeria CF (gegr. 1989) und Polideportivo Almeria (gegr. 1983) als Almeria CF, seit dem 28. Juni des gleichen Jahres UD Almeria; Spielkleidung: Rot-Weiß/Rot/Weiß; Stadion: De los Juegos Mediterráneos, 21 350 Plätze. – INTERNET: www.udalmeriasad.com
Spieler (Auswahl): S. Acasiete – Alberto – M. Bermejo – Corona – A. Crusat – L. de Palmas – Diego Alves – J. dos Santos – Esteban – Felipe Melo – Francisco – Guilherme – Jaime – Juanito – Juanma Ortiz – P. Mairata – Manolo – M. M’Bami – J. Mena – Michel – Á. Negredo – J. Ortiz – M. Paulista – P. Piatti – F. Soriano – K. Uche – A. Velamazán – F. Westerveld. – Trainer (Auswahl): G. Arconada – F. Castro – Casuco – U. Emery – J. Lillo – R. Olabe – H. Sánchez – U. Stielike – E. Vigo.
Al-Merreikh, Sudan: → Khartum [2].
Almeyda, Matias, eigtl. „Matias Jesús Almeyda“, argentin. Trainer, * 21. Dezember 1973 Azul; war Mittelfeldspieler: 1991–96 CA River Plate (Buenos Aires), 1996/97 FC Sevilla, 1997–2000 Lazio Rom, 2000–02 AC Parma, 2002–04 Inter Mailand, 2004/05 Brescia Calcio, 2005 Quilmes AC (Argentinien), 2005/06 Universidad de Chile (Santiage de Chile), 2007 Lyn Oslo, 2009–11 River Plate Buenos; 39 Länderspiele (1996–2003; ein Tor); WM-Endrunde 1998, 2002; olymp. Fußballturnier 1996; in Italien Fußballer des Jahres 1999. – Später Trainer: 2011 CA River Plate.
Al-Montashari, Hamad, eigtl. „Hamad al-Muntaschari“, saudi-arab. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 22. Juni 1982 Djidda; 2000–11 Al-Ittihad (Djidda); 32 Länderspiele (seit 2002; sechs Tore); WM-Endrunde 2006; Asiens Fußballer des Jahres 2005.
Al-Nasr, 1) Saudi-Arabien: → Riad [2]. – 2) VAE: → Dubai [2].
Aloisi, John („Das Känguru“), austral. Angriffsspieler (Mittelstürmer), auch ital. Staatsbürgerschaft, * 5. Februar 1976 Adelaide; 1991/92 Adelaide City, 1993 Standard Lüttich, 1993–95 Antwerp FC, 1995/96 US Cremonese, 1997/98 FC Portsmouth, 1998–2001 Coventry City, 2001–05 CA Osasuna, 2005–07 Deportivo Alavés, 2007/08 Central Coast Mariners (Gosford [Australien]), 2008–10 FC Sydney, 2010/11 Melbourne Heart; 55 Länderspiele (1997–2008; 27 Tore); WM-Endrunde 2006.
Alonso, M. und X., Spanien: → Xabi Alonso.
Al-Owairan, Saeed („Wüstenmaradona“), auch „Said Al-Uwairan“, saudi-arab. Angriffsspieler, * 19. August 1967 Al-Shabab (Riad); 1981–2001 Al-Shabab; 55 Länderspiele (1994–98; 24 Tore); WM-Endrunde 1994, 1998; Asiens Fußballer des Jahres 1994.
Alpay, Özalan, türk. Abwehrspieler, * 29. Mai 1973 Karisyaled; bis 1992 Soma Linyitspor (Türkei), 1992/93 Altay İzmir , 1993–99 Beşiktaş JK (Istanbul), 1999/2000 Fenerbahçe SK (Istanbul), 2000–03 Aston Villa, 2004 Incheon United (Südkorea), 2004/05 Urawa Red Diamonds, 2005–08 1. FC Köln; 21 Bundesligaspiele (2005/06; ein Tor); 90 Länderspiele (1995–2005; vier Tore); WM-Endrunde 2002; EM-Endrunde 1996, 2000.
Alpine, DSV, Österreich: → Leoben.
Al-Qadsia, Kuwait: → Kuwait-Stadt [3].
Al-Qadisiya, Saudi-Arabien: → Al-Chubar.
Al-Qahtani, Yassir, eigtl. „Yassir Sa’id al-Qahtani“, saudi-arab. Angriffsspieler, * 10. Oktober 1982 Riad; bis 2005 Al-Qadisiya (Saudi-Arabien), 2005–11 Al-Hilal (Riad); 67 Länderspiele (seit 2004; 50 Tore); WM-Endrunde 2006; Asiens Fußballer des Jahres 2007.
Al-Rayyan SC, Katar: → Ar-Rayyan.
Al-Sadd SC, Katar: → Doha [4].
Al-Sailiya SC, Katar: → Doha [5].
Alsenborn, SV, Dtl.: → Enkenbach-Alsenborn.
Al-Shabab, Saudi-Arabien: → Riad [3].
Altach, Österreich (Gemeinde in Vorarlberg); SCR Altach (Sportclub Rheindorf Altach), gegr. am 26. Dezember 1929 als FA („Fußballabteilung“) Turnerbund Altach, 1946–1949 SV Altach, 1949 aufgelöst und Neugründung (bisherige Fußballabteilung) als SCR Altach; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Gelb; Stadion: Cashpoint-Arena, 10 000 Plätze. – INTERNET: www.scra.at
Spieler (Auswahl): Ailton – P. Chinchilla – A. Dober – A. Dorta – A. Guem – A. Hütter – K. Hutwelker – M. Jagne – T. Jun – R. Kienast – R. Kirchler – S. Kling – M. Krassnitzer – F. Ledezma – O. Mattle – P. Mayer – A. Michl – B. Muhr – K. Schoppitsch. – Trainer (Auswahl): M. Bender – H. Fuchsbichler A. Hütter – P. Kohl – O. Schnellrieder – U. Schönenberger – M. Streiter – J. Trittinge – G. Zellhofer.
| SCR Altach: Erfolge (Auswahl) Erste-Liga-Meister 2006 Vorarlberger Meister 1986 Vorarlberger Cup 1987, 1988, 1993, 2002, 2003 |
Altafini, José, eigtl. „José João Altafini“, Brasilien/Italien: → Mazzola [1].
Altair, eigtl. „Altair Gomes de Figueiredo“, brasilian. Abwehrspieler, * 22. Januar 1938 Niterói; 1955–70 Fluminense FC (Rio de Janeiro); 22 Länderspiele (1958–68; WM-Endrunde 1962 (Weltmeister), 1966.
Al-Talaba SC, Irak: → Bagdad [1].
Al-Taliyani, Adnan, eigtl. “Adnan Khamees Al-Talyani“, arab. Mittelfeldspieler, * 30. Oktober 1964; 1980–99 Sharjah FC (VAE); 162 Länderspiele für die VAE (1984–97; 53 Tore); WM-Endrunde 1990.
„alt aussehen“ → Fußballerjargon.
Altbayern, Dtl.: Bez. für das Gebiet der östl. Regierungsbezirke → Oberbayern, → Niederbayern und → Oberpfalz.
Al-Temyat, Nawaf („Goldjunge“), saudi-arab. Mittelfeldspieler, * 28. Juni 1976 Riad; 1993–2008 Al-Hilal (Riad); 58 Länderspiele (1998–2006; 13 Tore); WM-Endrunde 1998, 2002, 2006; Asiens Fußballer des Jahres 2000.
Altenburg, Dtl. (Stadt in Thüringen); Motor Altenburg, eigtl. „SV Motor Altenburg“ (Sportverein Motor Altenburg), gegr. 1908 als Eintracht 08 Altenburg, 1945 aufgelöst und 1946 als SG Altenburg Nord neu gegr., 1949/50 ZSG Altenburg, 1950–52 BSG Stahl Altenburg, 1952–90 BSG Motor Altenburg, 1990–97 SV 1990 Altenburg, seitdem SV Motor Altenburg; DDR-Oberliga 1949–52; Spielkleidung: Gelb-Schwarz/Schwarz/Schwarz; Stadion: Skatbank-Arena, 25 000 Plätze. – ITERNET: www.motor-altenburg.de
Spieler (Auswahl): R. Baumann – A. und F. Bialas – P. Bräutigam – W. Flehming – K. Friedemann – A. Gräfe – H. Hänisch – G. Hercher – K. Hermann – W. Jäschke – H.-G. Kiupel – H. Klemig – K. Melzer – H. Pohle – H. Rößner – W. Schellenberg – F. Seifarth – H. Sittner – M. Spindler – W. Syring – N. Teichmann – M. Thiere – R. Trölitzsch – G. Uhsemann – H. Vollert – G. Weidhas – H. Welwarsky. – Trainer (Auswahl): G. Bäßler – H. Haese – M. Hofmann – H. Klemig – J. Staude – R. Wallzeck.
| Motor Altenburg: Erfolge (Auswahl) Bezirksmeister* 1963, 1965, 1969, 1979, 1981 * Bezirk Leipzig |
Altersklasse, DFB: a) → Seniorenklasse; b) Altersgruppe im Jugendbereich, wobei als Stichtag für die Einteilung in die jeweilige Altersklasse der 1. Januar eines jeden Jahres gilt. So sind z. B. A-Junioren (früher A-Jugend) eines Spieljahrs solche, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. Im Bereich der B-Junioren/-Juniorinnen (früher B-Jugend) und jünger sind gemischte Staffeln (Knaben/Mädchen) zulässig.
| Altersklassen: Kategorien | |
| A-Junioren | U 19/U 18 |
| B-Junioren/-Juniorinnen | U 17/U 16 |
| C-Junioren/-Juniorinnen | U 15/U 14 |
| D-Junioren/-Juniorinnen | U 13/U 12 |
| E-Junioren/-Juniorinnen | U 11/U 10 |
| F-Junioren/-Juniorinnen | U 9/U 8 |
| G-Junioren/-Juniorinnen | Bambini/U 7 |
Altersmannschaft, Abk. AM, Team, das sich aus Spielern über 32 Jahren zusammensetzt. I. d. R. handelt es sich dabei um Aktive, die zuvor über Jahre in Senioren- („Männer“-)Mannschaften gespielt haben, also durchweg routiniert sind (bzw. es eigtl. sein müssten); früher als „Alte Herren“ (Abk. AH) bezeichnet. In Wettbewerbsspielen bedeuten bei den Altersgrenzen „Ü“ svw. „über“, die nachfolgende Ziffer gibt das Lebensalter an („Ü 35“, „Ü 40“, „Ü 50“, „Ü 60“ usw.). – Analog hierzu bezeichnen sich Frauen-Teams oftmals als „Old Ladys“ (zuzüglich Vereinsname).
| Altersmannschaft Im AM-Bereich können in Pflichtspielen bis zu vier Spieler aus- und auch wieder eingewechselt werden. |
Altintop, 1) Halil, türk. Angriffsspieler (auch dt. Staatsbürgerschaft), * 8. Dezember 1982 Gelsenkirchen; Zwillingsbruder von [2]; 1991/92 Schwarz-Weiß Gelsenkirchen Süd, 1992–97 TuS Rotthausen (NRW), 1997–2003 SG Wattenscheid 09, 2003–06 1. FC Kaiserslautern, 2006–09 FC Schalke 04, 2010/11 Eintracht Frankfurt, 2011 Trabzonspor (Türkei); 236 Bundesligaspiele (2003–11; 47 Tore); 37 Länderspiele für die Türkei (seit 2005; acht Tore); EM-Endrunde 2008. – 2) Hamit, türk. Mittelfeldspieler (auch dt. Staatsbürgerschaft); Zwillingsbruder von [1]; 1991/92 Schwarz-Weiß Gelsenkirchen Süd, 1992–97 TuS Rotthausen, 1997–2003 SG Wattenscheid 09, 2003–07 FC Schalke 04, 2007–11 Bayern München, 2011 Real Madrid; 176 Bundesligaspiele (2003–11; 15 Tore); 65 Länderspiele für die Türkei (seit 2004; sechs Tore).
| Hamit Altintop Er erhielt 2011 den „FIFA Puskás-Preis“. |
Altlüdersdorf, SV, Dtl.: → Gransee.
Altmann, Wolfgang („Der Alte“), dt. Trainer, * 22. Dezember 1952 Markranstädt; war Mittelfeldspieler: 1960–69 Turbine Markranstädt, 1969–71 Chemie Leipzig, 1971–87 1. FC Lokomotive Leipzig, 1987–90 TSG Markkleeberg; 325 (DDR-)Oberligaspiele (1971–87; 36 Tore). – Später Trainer: 2002–11 Kickers Markkleeberg (Assistent).
Altmark, Dtl.: histor. Landschaft westl. der Elbe im Land Sachsen-Anhalt; Hauptort: Stendal.
| Altmark: Vereine (Auswahl) Eintracht Salzwedel 1. FC Lok Stendal |
Altmeister, DFB: Mannschaft, die in (längst) vergangenen Jahren wiederholt den Meistertitel in der höchsten Spielklasse errang, ohne in neuerer Zeit an die damaligen Erfolge heranreichen zu können; nicht zu verwechseln mit Exmeister, einem ehemaligen Dt. Meister. – Zu den Altmeistern bis 1945 zählen z. B. der 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 (je sechsmal Landesmeister), aber auch die früheren VfB Leipzig und SpVgg Fürth (je dreimal Landesmeister).
Altobelli, Alessandro („Spillo“), ital. Angriffsspieler, * 28. November 1955 Sonnino; 1974–77 Brescia Calcio, 1977–88 Inter Mailand, 1988/89 Juventus Turin, 1989/90 Brescia Calcio, 1990–92 Ascoli Calcio; 61 Länderspiele (1980–88; 25 Tore); WM-Endrunde 1982 (Weltmeister), 1986; EM-Endrunde 1980, 1988.
Altona 93, FC, Dtl.: → Hamburg [4]).
Al-Uwairan, Said, Saudi-Arabien: svw. Said → Al-Owairan.
Álvarez, 1) Antonio („Der Marschall“), eigtl. „Antonio Álvarez Giraldez“, span. Trainer, * 10. April 1955 Marchena; war Abwehrspieler (Libero): 1974–87 FC Sevilla, 1987–91 CD Málaga, 1991–95 FC Granada. – Später Trainer: 2000–10 FC Sevilla (Assistent, 2010 Cheftrainer [Landespokal 2010]). – 2) Leonel, eigtl. „Leonel Zuleta de Jesús Álvarez“, kolumbian. Mittelfeldspieler, * 29. Juli 1965 Medellin; 1983–87 Independiente Medellin, 1988/89 Atlético Nacional (Medellin), 1990 América de Cali, 1990–92 Real Valladolid, 1992–95 América de Cali, 1996 Dallas Burn, 1996–98 CD Veracruz, 1998/99 Dallas Burn, 1999–2001 New England Revolution (Foxborough), 2002 Deportivo Pereira (Kolumbien), 2003/04 Deportes Quindio (Armenia [Kolumbien]); 101 Länderspiele (1985–97; ein Tor); WM-Endrunde 1990, 1994.
Álvaro Pereira, Diego, eigtl. „Álvaro Daniel Pereira Barragán“, uruguay. Mittelfeldspieler, * 28. November 1985 Montevideo; 2004/05 Miramar Misiones (Montevideo), 2005–07 Quilmes AC (Argentinien), 2007/08 Argentinos Juniors (Buenos Aires), 2008/09 CFR Cluj, 2009–11 FC Porto; 27 Länderspiele (seit 2006; drei Tore); WM-Endrunde 2010.
Alves, 1) Afonso, Brasilien: → Afonso Alves. – 2) Alex, Brasilien: → Alex Alves. – 3) Bruno, Portugal: → Bruno Alves. – 4) Dani, Brasilien: → Dani Alves. – 5) João, eigtl. „Joao Antonio Ferreira Resende“, port. Trainer, * 5. Dezember 1952 Albergaria-a-Velha; war Mittelfeldspieler: 1973/74 SC Varzim, 1974–76 Boavista Porto, 1976–78 UD Salamanca, 1978/79 Benfica Lissabon, 1979/80 Paris St.-Germain, 1980–83 Benfica Lissabon, 1983–85 Boavista Porto. – Später Trainer: 2009–11 Servette Genf.
Álvez, Fernando, eigtl. „Fernando Harry Álvez Mosquera“, uruguay. Torhüter, * 4. September 1959 Montevideo; bis 1977 Defensor SC (Montevideo), 1978–84 CA Peñarol (Montevideo), 1984 Club Libertad (Asunción), 1985/86 CA Peñarol, 1987 CD Santa Fe (Bogotá), 1988–91 CA Peñarol, 1991 Independiente Medellin, 1992–95 Deportivo Mandiyú (Corrientes [Argentinien]), 1995 CA River Plate (Buenos Aires), 1996 San Lorenzo de Almagro (Buenos Aires), 1997 CA Peñarol; 40 Länderspiele (1980–97); WM-Endrunde 1986, 1990.
Al-Wahda, 1) Jemen: → Sanaa [2]. – 2) Saudi-Arabien: → Mekka. – 3) VAE: → Abu Dhabi [2].
Al-Wakrah, Katar (Hafenstadt am Pers. Golf); Al-Wakrah SC (Al-Wakrah Sports Club), gegr. 1959; Spielkleidung: Hellblau-Weiß/Schwarz/Hellblau; Stadion: Al-Wakrah, 20 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): Akwá – K. Fadiga – F. Leboeuf – E. Mohammed – J. Muntasser – A. Radhi. – Trainer (Auswahl): M. Baždarević – R. Hollmann – M. Madjer – C. Stefanescu.
Al-Wasl, VAE: → Dubai [3].
Al-Zawra SC, Irak: → Bagdad [2].
Alzenau, Dtl. (Stadt in Unterfranken); Bayern Alzenau, eigtl. „FC Bayern Alzenau“ (Fußballclub Bayern Alzenau), gegr. am 27. März 1920, 1922 Anschluss an TuS Alzenau, 1923 Ausgliederung der Fußballabteilung als FC Bayern Alzenau, 1945 aufgelöst und als SKG Alzenau neu gegr., seit 1947 wieder FC Bayern Alzenau; Spielkleidung: Blau; Stadion: Städt. Stadion am Prischoß, 5 113 Plätze. – INTERNET: www.bayern-alzenau.de
Spieler (Auswahl): A. Anicic – C. Elcioglu – B. Goedecke – J. Grüter – I. Krešić – D. Lange – S. Popp – S. Schneider – C. Schönig – J. Seitz – H. Westermann – C. Zanetti – B. Ziegenbein. – Trainer (Auswahl): S. Lutz – K. Reusing – M. Roth.
| Bayern Alzenau: Erfolge (Auswahl) Hessenmeister 2011 |
AM, Abk. für → Altersmannschaft.
Amadò, Lauro („Lajo“), schweizer. Angriffsspieler, * 15. März 1912 Lugano, † 6. Juni 1971; 1930–32 FC Lugano, 1932–34 Servette Genf, 1934–40 FC Lugano, 1940–49 Grasshopper-Club Zürich (Torschützenkönig 1943 [21], 1947 [19]); 54 Länderspiele (1935–48; 21 Tore); WM-Endrunde 1938.
Amanatidis, Ioannis („Ama“), griech. Angriffsspieler, * 3. Dezember 1981 Kozani; 1991–95 Stuttgarter SC, 1995–2000 VfB Stuttgart, 2001/02 SpVgg Greuther Fürth, 2002/03 VfB Stuttgart, 2004 Eintracht Frankfurt, 2004/05 1. FC Kaiserslautern, 2005–11 Eintracht Frankfurt; 198 Bundesligaspiele (2002–11; 54 Tore); 35 Länderspiele (2002–09; drei Tore); EM-Endrunde 2008.
Amancio, eigtl. “Amancio Amaro Varela”, span. Trainer, * 16. Oktober 1939 La Coruña; war Angriffsspieler (Rechtsaußen): 1953–57 Victoria Coruña, 1958–62 Deportivo La Coruña, 1962–76 Real Madrid (Torschützenkönig 1969 [14, mit J. → Gárate], 1970 [16, mit L. → Aragonés und J. Gárate]); 42 Länderspiele (1962–74; zwölf Tore); WM-Endrunde 1966; Europapokal der Nationen 1964 (Sieger). – Später Trainer: 1982–85 Castilla CF (Madrid), 1985/86 Real Madrid.
Amarildo, eigtl. „Amarildo Tavares da Silveira”, brasilian. Trainer; * 29. Juni 1940 Campos (zu Rio de Janeiro); war Angriffsspieler: 1956/57 Goytacaz FC (Brasilien), 1958 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 1959–63 Botafogo FR (Rio de Janeiro), 1963–67 AC Mailand, 1967–71 AC Florenz, 1971/72 AS Rom, 1973/74 Vasco da Gama (Rio de Janeiro); 24 Länderspiele (1962/63; neun Tore); Weltmeister 1962. – Später Trainer: 1984–87 Espérance Tunis, 1990–92 AC Florenz (Assistent), 1992/93 Al-Ain Club (VAE).
Amateur, Aktiver, der aufgrund seines Mitgliedschaftsverhältnisses Fußball spielt und als Entschädigung kein Entgelt bezieht, sondern seine nachgewiesenen Auslagen und allenfalls einen pauschalierten Aufwandersatz von derzeit bis zu 149,99 € im Monat erstattet bekommt. Bis 2005 wurden im dt. Profifußball die zweiten Mannschaften der Männer als Amateure deklariert, obwohl die Spieler ihren Lebensunterhalt i. d. R. durch den Fußball finanzierten. Seit 2006 werden diese bisherigen Amateurteams mit dem Vereinsnamen und einer nachfolgenden „II“ benannt (z. B. Hamburger SV II), aber innerhalb des Vereins meist als „U 23“ geführt. S. a. Nichtamateur
| Amateur Amateur [eng., frz.] Aficionado [span.] Amador [port.] Dilettante [ital.] |
Amateur-Europameisterschaft, zw. 1966 und 1978 viermal ausgetragener Wettbewerb für Amateur-Nationalmannschaften. Die Qualifikationsspiele wurden in vier Vorrundengruppen ausgetragen, wobei sich die jeweiligen Sieger für die Endrunde qualifizierten. Die attraktiveren EC-Wettbewerbe und die 1966 einsetzenden EM-Qualifikationsspiele für Nationalmannschaften ließen den Amateurwettbewerb von Beginn an ein ausgesprochenes „Schattendasein“ fristen. Der zudem noch zusehends schwindende „Erfolg“ (den es interessenweit ohnehin nie gab) bewog die UEFA 1978 dazu, den Wettbewerb abzuschaffen. Der ewige Streit um eine einheitl. Amateurdefinition und die spärl. Zuschauerzahlen bei den Spielen trugen maßgeblich zu dieser Entscheidung bei.
| Amateur-Europameisterschaft: Sieger 1967 Österreich 1970 Spanien 1974 BRD, Jugoslawien (kein Finale, beide zum Sieger erklärt) 1978 Jugoslawien |
Amateur-Länderpokal, DFB: ein von 1951 bis 1996 von den Landesverbänden ausgetragener Pokalwettbewerb, 1951 bis 1964 in einfacher Runde (K.-o.-System) und seit 1965 mit Hin- und Rückspiel; seit 1997 für U-19-Mannschaften, seit 2002 für U-21-Mannschaften (U-21-Länderpokal). – Den Amateur-Länderpokal für Frauen (U-20-Frauen-Länderpokal) gibt es seit 1981.
| Amateur-Länderpokal: Sieger (Männer/Frauen) 1951 Niederrhein/ – 1952 Bayern/ – 1953 Bayern/ – 1954 Bayern/ – 1955 Bayern/ – 1956 Hessen/ – 1957 Niedersachsen/ – 1958 Niederrhein/ – 1959 Hamburg/ – 1960 Mittelrhein/ – 1961 Hamburg/ – 1962 Westfalen/ – 1963 Bayern/ – 1964 Mittelrhein/ – 1965 Bayern/ – 1966 Westfalen/ – 1967 Nordbaden/ – 1968 Bayern/ – 1969 Nordbaden/ – 1970 Bayern/ – 1971 Bayern/ – 1972 Nordbaden/ – 1973 Nordbaden/ – 1974 Mittelrhein/ – 1975 Südwest/ – 1976 Niedersachsen/ – 1977 Bayern/ – 1978 Westfalen/ – 1980 Bayern/ – 1981 Südwest/Mittelrhein |
| 1982 Südwest/Niederrhein 1983 Hessen/Bayern 1984 Bremen/Hessen 1985 Rheinland/Niederrhein 1986 Westfalen/Niederrhein 1987 Niedersachsen/Niederrhein 1988 Württemberg/Mittelrhein 1989 Bayern/Württemberg 1990 Bayern/Hessen 1991 Niederrhein/Hessen 1992 Hessen/Hessen 1993 Westfalen/Westfalen 1994 Westfalen/Hessen 1995 Niederrhein/Hessen 1996 Baden/Niederrhein 1997 Westfalen/Hessen 1998 Westfalen/Hessen 1999 Schleswig-Holstein/Hessen 2000 Bayern/Hessen 2001 Württemberg/Hessen 2002 Mittelrhein/Bayern 2003 Südwest/Niederrhein 2004 Mittelrhein/Niederrhein 2005 Sachsen/Niederrhein 2006 Niederrhein/Niederrhein 2007 Niederrhein/ – 2008 Südwest/Württemberg 2009 Württemberg/Niederrhein 2010 Mittelrhein/Brandenburg 2011 – /Rheinland |
Amateur-Nationalmannschaft, früher die Nationalmannschaft eines Landes mit Profifußball, in der ausschl. Amateure spielen durften. Die Amateur-Nationalmannschaft (bis 1979) des Dt. Fußball-Bundes (DFB) setzte sich z. B. aus Spielern der Amateur- und Oberligen zusammen. – Das Interesse der Öffentlichkeit in diesen Ländern richtete sich aber bereits damals hauptsächlich auf die eigentl. Nationalmannschaft, die sich aus den besten Spielern des Landes, d. h. aus Profis, zusammensetzt.
Amateuroberliga, DFB: svw. → Oberliga [1b].
Amateurspieler, DFB: svw. → Amateur.
Amauri, eigtl. „Amauri Carvalho De Oliveira“, ital. Angriffsspieler brasilian. Herkunft (seit 2010 ital. Staatsbürgerschaft), * 3. Juni 1980 Carapicuiba (Brasilien); bis 2000 Santa Caterina Clube (Brasilien), 2000 AC Bellinzona, 2001 SSC Neapel, 2001/02 Piacenza Calcio, 2002 FC Empoli, 2002/03 FC Messina, 2003–06 Chievo Verona, 2006–08 US Palermo, 2008–11 Juventus Turin; ein Länderspiel für Italien (2010).
Amavisca, eigtl. „José Emilio Amavisca Gárate“, span. Mittelfeldspieler, * 19. Juni 1971 Laredo; 1988/89 SD Laredo, 1989–91 Real Valladolid, 1991/92 UE Lleida (Spanien), 1992–94 Real Valladolid, 1994–98 Real Madrid, 1998–2001 Racing Santander, 2001–04 Deportivo La Coruña, 2004/05 Espanyol Barcelona; 15 Länderspiele (1994–97; ein Tore); EM-Endrunde 1996; Olympiasieger 1992; in Spanien Fußballer des Jahres 1995.
Ambrosini, Massimo, ital. Mittelfeldspieler, * 29. Mai 1977 Pesaro; 1993–95 AC Cesena, 1995–97 AC Mailand, 1997/98 Vicenza Calcio, 1998–2011 AC Mailand; 35 Länderspiele (seit 1999); EM-Endrunde 2000, 2008.
Amedick, Martin, dt. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 6. September 1982 Paderborn; 1987–95 Delbrücker SC, 1995–98 SC Paderborn 07, 1998–2004 Arminia Bielefeld, 2004–06 Eintracht Braunschweig, 2006–08 Borussia Dortmund, 2008–11 1. FC Kaiserslautern; 60 Bundesligaspiele (seit 2006; vier Tore); 93 Zweitligaspiele (2003–10; zwei Tore).
Amerell, Manfred („Herr der Pfeifen“), dt. Schiedsrichter, * 25. Februar 1947 München; Bundesliga 1986–94 (66 Spiele); DFB-Pokal-Finale 1994. – Er war Mitglied des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses sowie Mitglied im Vorstand des Süddt. Fußball-Verbands (SFV).
| M. Amerell Gegen ihn wurde von Schiedsrichter Michael Kempter im Dezember 2009 Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Belästigung erhoben, in deren Folge er von seinen Ämtern im Februar 2010 zurücktrat. |
Amerhauser, Martin, österr. Mittelfeldspieler, * 23. Juli 1974 Salzburg; 1993–95 Austria Salzburg, 1995/96 Grazer AK, 1996–99 Austria Salzburg, 1999–2005 Grazer AK; elf Länderspiele (1998–2005; drei Tore); WM-Endrunde 1998.
América de Cali, Kolumbien: → Cali [1].
Américo, Mario (stets nur „Américo“ – nicht mit dem Vornamen – genannt), brasilian. (Kult-)Masseur, * 28. Juli 1912 São Paulo, † 9. April 1990 São Paulo; Ex-Amateurboxer; betreute die brasilian. Nationalmannschaft bei sieben WM-Endrunden (1950–74). Typisch für ihn: im rasenden Tempo hin zum verletzten Spieler, „bewaffnet“ mit Plasteimer und Patronentaschengürtel für medizin. Utensilien (Tinkturen aus Pflanzen und Heilkräutern). – Später Stadtverordneter von São Paulo.
Amerikanische Jungferninseln, CONCACAF: → Jungferninseln.
Amerikanisch-Samoa, nicht eingemeindetes Territorium der USA auf den Samoainseln, einer Inselgruppe in Polynesien; 199 km², 58 000 Ew.; Verband: Football Federation American Samoa, Abk. FFAS, gegr. 1984, Sitz: Pago Pago; Mitglied der OFC seit 1993, der FIFA seit 1998; Spielkleidung: Marineblau/Rot/Weiß. – Höchste Spielklasse: FFAS Senior League (zwölf Vereine). – INTERNET: www.ffas.as
| Amerikanisch-Samoa Am 11. April 2001 verliert Amerikanisch-Samoa in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Australien mit 0:31, ein „Weltrekord“-Ergebnis in offiziellen Länderspielen. |
Amman, Hauptstadt von Jordanien; 1) Al-Faisaly, eigtl. „Al-Faisaly Club“, gegr. 1932; Spielkleidung: Hellblau/Weiß/Hellblau; Stadion: Amman International, 25 000 Plätze. – INTERNET: www.faisaly.com
Spieler (Auswahl): A. Al-Amry – A. Al-Sahbi – W. Al-Thowaibi – W. Ayan – A. Dawshs – A. P. Diop – D. Jertec – I. Madkhali – M. Memelli. – Trainer (Auswahl): C. Dalić – T. Jassam.
| Al-Faisaly: Internationale Erfolge (Auswahl) AFC Cup 2005, 2006 |
2) Nadi Shabab Al Ordon (auch „Jordan Youth Club”), gegr. 2002; Spielkleidung: Rot-Weiß/Rot/Rot; Stadion: Prince Mohammad, 17 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): A. Bashir – A. Deep – M. Hassan – F. Latifa – A. Nawwas – M. Yassin. – Trainer (Auswahl): C. Aristica.
| Nadi Shabab Al Ordon: Internationale Erfolge (Auswahl) AFC Cup 2007 |
Amoah, Charles, ghanaischer Angriffsspieler, * 28. Februar 1975 Accra; bis 1994 Okwawu United (Nkawkaw [Ghana]), 1995/96 FC Winterthur, 1996–98 FC Frauenfeld (Kt. Thurgau), 1998/99 FC Wil, 1999–2001 FC St. Gallen (Torschützenkönig 2000 [25]), 2001–03 Sturm Graz, 2003 Austria Salzburg, 2004 Sturm Graz, 2004–07 Okwahu United, 2007 LASK Linz; in der Schweiz Fußballer des Jahres 2000.
Amokachi, Daniel, eigtl. “Daniel Owefin Amokachi”, nigerian. Trainer, * 30. Dezember 1972 Kaduna; war Angriffsspieler: 1986–89 Kaduna United, 1989/90 Ranchers Bees (Kaduna), 1990–94 FC Brügge, 1994–96 FC Everton, 1996–2000 Beşiktaş JK (Istanbul), 2001 US Créteil, 2002 Colorado Rapids; 42 Länderspiele (1989–2002; 14 Tore); WM-Endrunde 1994, 1998; Olympiasieger 1996; Afrikameister 1994. – Später Trainer: 2006/07 Nasarawa United (Nigeria), 2007 Nigeria (Nationalmannschaft; Assistent von B. → Vogts), 2007/08 FC Enyimba, 2010 Nigeria (Nationalmannschaft; Assistent von L. → Lagerbäck [WM-Endrunde 2010]).
Amoros, Manuel, frz. Abwehrspieler, * 1. Februar 1962 Nîmes; 1972–78 GC Lunel (Frankreich), 1978–89 AS Monaco, 1989–93 Olympique Marseille, 1993–95 Olympique Lyon, 1995/96 Olympique Marseille; 82 Länderspiele (1982–92; ein Tor); WM-Endrunde 1982 (“Bester junger Spieler”), 1986; EM-Endrunde 1984 (Europameister), 1992; in Frankreich Fußballer des Jahres 1986.
Amoroso, Márcio, eigtl. “Márcio Amoroso dos Santos”, brasilian. Angriffsspieler, * 5. Juli 1974 Brasilia; 1992 Guarani FC (Campinas), 1992/93 Verdy Kawasaki, 1994/95 Guarani FC (Torschützenkönig 1994 [19, mit → Túlio Maravilha]), 1996 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 1996–99 Udinese Calcio (Torschützenkönig 1999 [22]), 1999–2001 AC Parma, 2001–04 Borussia Dortmund (Torschützenkönig 2002 [18, mit M. → Max]), 2004/05 FC Málaga, 2005 FC São Paulo, 2006 AC Mailand, 2006/07 Corinthians Paulista (São Paulo), 2007 Grêmio FBPA (Pôrto Alegre), 2008 Aris Saloniki, 2009 Guarani FC; 59 Bundesligaspiele (2001–04; 28 Tore); 19 Länderspiele (1995–2003; zehn Tore).
Amri, Chadli, alger. Angriffsspieler (auch frz. Staatsbürgerschaft), * 14. Dezember 1984 Saint-Avold (Frankreich); 1991–2002 FC Folschwiller (Frankreich), 2002/03 FC Metz, 2003/04 ASC Lascabas (Frankreich), 2004–06 1. FC Saarbrücken, 2006–10 1. FSV Mainz 05, 2010/11 1. FC Kaiserslautern; 40 Bundesligaspiele (seit 2006; zwei Tore); neun Länderspiele für Algerien (seit 2006).
Amsterdam, Hauptstadt der Niederlande; 1) Ajax Amsterdam, eigtl. „AFC Ajax“ (Amsterdamse Football Club Ajax), gegr. am 18. März 1900 als Amsterdamse FC Ajax, 1908 Fusion mit Holland Amsterdam unter Beibehaltung des Namens AFC Ajax; Spielkleidung: Weiß-Rot/Weiß/Weiß-Rot; Spielort: Zuidoost; Stadion: Amsterdam-Arena, 51 324 Plätze. – INTERNET: www.ajax.nl
Spieler (Auswahl): W. Addicks – W. Anderiesen – F. Arnesen – S. Arveladze – T. Atouba – R. Babel – Y. Benayoun – A. Bergdølmo – D. Bergkamp – H. Blankenburg – D. Blind – H. Bloomvliet – K. Boulahrouz – A. Charisteas – C. Chivu – J. Cruyff – E. Davids – F., J. und R. de Boer – T. de Cler – N. und S. de Jong – H. Delsen – T. de Mul – J. de Natris – D. de Zeeuw – G. Dräger – J. Dusbaba – E. Elia – M. El Hamdaoui – U. Emanuelson – E. Enoh – C. Eriksen – G. Fortgens – T. Galásek – R. Geels – J. Grønkjær – H. Groot – Z. Grygera – W. Gupffert – A. Haan – J. Heitinga – H. Hordijk – A. Hossam – B. Hulshoff – K.-J. Huntelaar – Z. Ibrahimović – W. Jansen – H. Jensen – W. Jonk – R. Kaiser – N. Kanu – P. Keizer – W. Kieft – P. Kluivert – R. Koeman – M. Krohn-Dehli – R. Krol – S. Kuffour – T. La Ling – P. Larsson – B. und M. Laudrup – F. Ledezma – S. Lerby – J. Litmanen – B. Lobonţ – N. Lodeiro – A. Luque – H. Maduro – Maxwell – B. McCarthy – W. Meeuws – S. Menzo – M. und R. Michels – A. Mokoena – A. und G. Mühren – J. und Y. Mulder – B. Müller – J. Neeskens – C. Nuninga – S. Oliseh – J. Olsen – A. Ooijer – P. Ouderland – M. Overmars – M. Pantelić – P. Pasanen – A. Pelser – S. Pienaar – E. Pieters-Graafland – J. Potharst – J. Prins – A. Pronk – N. Rafael – M. Reiziger – N. Rep – F. Rijkaard – M. Rijnders – M. Rosenberg – A. Rudy – M. Santos – H. Schilcher – D. Schoenaker – P. Schrijvers – C. Seedorf – J. Silooy – W. Sneijder – W. Sonck – J. Stam – F. Stapleton – A. Steffenhagen – M. Stekelenburg – J. Stoffelen – G. Stroker – L. Suárez – M. Sulejmani – W. Suurbier – J. Swart – S. Tahamata – T. Tainio – H. Trabelsi – M. van Basten – D. van Burik – J. van Damme – C. van de Hoeven – P. van der Kuil – H. van der Linden – A. van der Meyde – E. van der Sar – R. van der Vaart – G. van der Wiel – J. van Diepenbeek – D. van Dijk – J. van Dort – T. van Duivenbode – G. Vanenburg – L. van Gaal – A. van Kool – J. van’t Schip – Z. Varga – V. Vasović – F. Verlaat – T. Vermaelen – J. Vertonghen – W. Volkers – A. Winter – Richard und Rob Witschge – J. Wouters. – Trainer (Auswahl): C. Adriaanse – L. Beenhakker – V. Boškov – C. Brom – J. Cruiyff – F. de Boer – A. de Mos – T. Harms – B. Hulshoff – T. Ivić – M. Jol – G. Knobel – R. Koeman – A. Kohn – A. Koster – S. Kovačs – K. Lindner – R. Michels – M. Olsen – J. Reynolds – H. ten Cate – M. van Basten – L. van Gaal – J. van’t Schip – R. Witschge – J. Wouters.
| Ajax Amsterdam: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972*, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011 Landespokal 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972*, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 Europapokal der Landesmeister 1971, 1972*, 1973 Champions League 1995 Europapokal der Pokalsieger 1987 UEFA-Pokal 1992 Europa-Supercup 1972, 1973, 1995 Weltpokal 1972, 1995 Internationaler Fußballcup 1962 * „Europäisches Triple“ |
2) FC Amsterdam (Football Club Amsterdam), gegr. am 11. Oktober 1907 als DWS („Door Wilskracht Sterk“) Amsterdam, 1958 Fusion mit BVC Amsterdam zu DWS/A Amsterdam, 1962–72 DWS Amsterdam, 1972 Fusion mit Blauw Wit BV Amsterdam zu FC Amsterdam, aufgelöst 1982; Spielort: Old South; Spielkleidung: Rot-Schwarz/Weiß/Schwarz; Stadion: Olympiastadion, 64 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): C. Adriaanse – W. Couperus – R. Gullit – R. Israel – J. Jongbloed – G. Nelson – D. Osei – H. Otto – R. Rensenbrink – P. Schrijvers – R. Seedorf – R. Stjeward – W. Suurbier – D. van Wijk. – Trainer (Auswahl): H. Wisman.
| FC Amsterdam: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1964 |
Amunike, Emmanuel, nigerian. Angriffsspieler, * 25. Dezember 1970 Eze Obodo; bis 1990 Nigerlux Lagos, 1990/91 Concord FC (Nigeria), 1991/92 Julius Berger FC (Lagos), 1992–94 Zamalek SC (Kairo), 1994–96 Sporting Lissabon, 1997–2000 FC Barcelona, 2000–02 Albacete Balompié, 2002–07 Al-Wihdat (Amman); 17 Länderspiele (1993–2000; fünf Tore); WM-Endrunde 1994; Olympiasieger 1996; Afrikas Fußballer des Jahres 1994.
Anastasi, Pietro, ital. Angriffsspieler, * 7. April 1948 Catania; 1966–68 FC Varese 1910, 1968–76 Juventus Turin, 1976–78 Inter Mailand, 1978–81 Ascoli Calcio, 1981/82 FC Lugano; 25 Länderspiele (1968–76; zwei Tore); WM-Endrunde 1974; Europameister 1968.
Anastopoulos, Nikolaos („Nikos“), griech. Angriffsspieler, * 22. Januar 1958 Athen; 1977–80 Panionios Athen, 1980–87 Olympiakos Piräus (Torschützenkönig 1983 [29], 1984 [18], 1986 [19], 1987 [16]), 1987/88 US Avellino, 1988/89 Panionos Athen,1989–92 Olympiakos Piräus, 1992/93 Ionikos Nikea (Griechenland), 1993/94 Olympiakos Piräus; 73 Länderspiele (1979–88; 29 Tore); EM-Endrunde 1980.
Anatolien, Kleinasien, Türkei: Region, die zu Vorderasien gehört.
| Anatolien: Vereine (Auswahl) Eskişehirspor Gaziantepspor Kocaelispor Konyaspor Malatyaspor Manisaspor Sivasspor |
Ancelotti, Carlo („Mister“), ital. Trainer, * 10. Juni 1959 Reggiolo; war Mittelfeldspieler: 1976–79 AC Parma, 1979–87 AS Rom, 1987–92 AC Mailand; 26 Länderspiele (1981–91; ein Tor); WM-Endrunde 1990; EM-Endrunde 1988. – Später Tainer: 1992–95 Italien (Nationalmannschaft; Assistent von A. → Sacchi), 1995/96 Reggina Calcio, 1996–98 AC Parma, 1999–2001 Juventus Turin, 2001–09 AC Mailand, 2009–11 FC Chelsea; Welt-Clubtrainer des Jahres 2007; in Italien Trainer des Jahres 2001, 2004.
| C. Ancelotti: Erfolgsstationen (Auswahl) | |
| AC Mailand Grau Grau Grau FC Chelsea Grau | Landesmeister 2004 Landespokal 2003 Champions League 2003, 2007 Europa-Supercup 2003, 2007 Landesmeister 2010 Landespokal 2010 |
Ancona, Italien (Hauptstadt der Region Marken); AC Ancona (Associazione Calcio Ancona, gegr. 1905 als US Anconitana Ancona, 1927 Fusion mit SEF Stamura zu SS Ancona (1928 Austritt von SEF Stamura), 1932 Fusion mit Emilio Bianchi Ancona zu US Anconitana-Bianchi, 1982–2004 Anconia Calcio, 2004 aufgelöst und als AC Ancona neu gegr.; Spielkleidung: Rot/Weiß/Rot; Stadion: Stadio del Conero, 26 000 Plätze. – INTERNET: www.anconacalcio.it
Spieler (Auswahl): L. Anderson – D. Andersson – D. Baggio – L. Détári – F. di Sauro – M. Jardel – G. Langella – N. Mendil – D. Morello – F. Mortelliti – G. Pandev – O. Ruggeri – G. Sgarra – A. Teodorani – M. Vieri – S. Zaraté – L. Zavagno. – Trainer (Auswahl): R. Bocchini – F. Brini – F. Monaco – L. Simoni – N. Sonetti – L. Spalletti.
Andalusien, Spanien: Region im S des Landes; Hauptort: Sevilla. – Die andalus. Auswahl, deren Verband FAF (Federación Andaluza de Fútbol) nicht der FIFA und der UEFA angehört, bestreitet seit 1923 in unregelmäßigen Abständen Freundschaftsspiele; Spielkleidung: Weiß/Grün/Weiß.
| Andalusien: Vereine (Auswahl) UD Almeria Real Betis Balompié CF Cádiz FC Córdoba FC Granada Recreativo Huelva FC Málaga FC Sevilla CD Xerez |
Anderbrügge, Ingo („Der Hammer“), dt. Trainer, * 2. Januar 1964 Datteln (NRW); war Mittelfeldspieler: bis 1984 Germania Datteln, 1984–88 Borussia Dortmund, 1988–99 FC Schalke 04, 2000/01 Sportfreunde Siegen; 292 Bundesligaspiele (1984– 99; 53 Tore). – Später Trainer: 2005 Werner SC 2000 (Werne [NRW]), 2004/06 SpVgg. Erkenschwick, 2006/07 VfB Hüls, 2007/08 Wacker Burghausen.
| I. Anderbrügge „Ich habe zum ersten Mal gegen eine Mannschaft mit schwarzen Trikots gespielt. Das ist ja schlimm, man denkt, da laufen lauter Schiedsrichter herum.“ |
Anderlecht, RSC, Belgien: → Brüssel [2]).
Andermatt, Martin, schweizer. Trainer, * 21. November 1961 Baar (Kt. Zug); war Abwehrspieler: 1978/79 SC Zug, 1979–83 FC Wettingen (Kt. Aargau), 1983–89 FC Basel, 1989/90 Grasshopper Zürich, 1990–92 FC Wettingen; elf Länderspiele (1983–89). – Später Trainer: 1995–97 FC Emmenbrücke (Kt. Luzern; Spielertrainer), 1997/98 FC Winterthur, 1998/99 FC Baden, 1999/2000 SSV Ulm, 2001/02 Eintracht Frankfurt, 2002/03 FC Wil, 2003–06 FC Vaduz (in → Personalunion Liechtenstein [Nationalmannschaft]), 2006–08 Young Boys Bern, 2009/10 FC Aarau.
Andersen, 1) Henrik, dän. Abwehrspieler (Linksverteidiger), * 7. Mai 1965 Amager (zu Kopenhagen); bis 1982 Fremad Amager, 1982–90 RSC Anderlecht, 1990–98 1. FC Köln; 125 Bundesligaspiele (1990–98; fünf Tore); 30 Länderspiele (1985–94; zwei Tore); WM-Endrunde 1986; Europameister 1992. – Sein Sohn Kristoffer Andersen (* 1985) ist Mittelfeldspieler: 2003–05 KAS Eupen, 2005–07 FC Brügge, 2007/08 Borussia Mönchengladbach, 2008/09 VfR Aalen, 2009/10 MSV Duisburg, 2010 /11 VfL Osnabrück; 46 Zweitligaspiele (seit 2009; drei Tore). – 2) Jörn, norweg. Trainer (seit 1992 auch dt. Staatsbürgerschaft), * 3. Februar 1963 Fredrikstad; war Angriffsspieler: 1975–81 Østsiden IL (Norwegen), 1982–84 Fredrikstad FK, 1985 Valerenga IF (Oslo), 1985–88 1. FC Nürnberg, 1988–90 Eintracht Frankfurt (Torschützenkönig 1990 [18]), 1990/91 Fortuna Düsseldorf, 1991–93 Eintracht Frankfurt, 1994 Hamburger SV, 1995 Dynamo Dresden, 1995–97 FC Zürich, 1997/98 FC Lugano; 243 Bundesligaspiele (1985–95; 67 Tore); 27 Länderspiele (1985–89; fünf Tore). – Später Trainer: 1999–2001 FC Locarno (Spielertrainer), 2001/02 FC Luzern (U 21), 2003/04 Rot-Weiß Oberhausen, 2005/06 Borussia Mönchengladbach (Assistent), 2007/08 Kickers Offenbach, 2008/09 1. FSV Mainz 05, 2010 AE Larisa. – Sein Sohn Niklas Andersen (* 1988) ist Abwehrspieler: 2007/08 Rot-Weiss Essen, 2008–11 Werder Bremen; ein Bundesligaspiel (2009); 63 Drittligaspiele(seit 2008; zwei Tore).
Anderson, 1), eigtl. “Anderson Luis de Abreu Oliveira”, brasilian. Mittelfeldspieler, * 13. April 1988 Pôrto Alegre; 1993–2005 Grêmio FBPA (Pôrto Alegre), 2006/07 FC Porto, 2007–11 Manchester United; sieben Länderspiele (seit 2007); U-17-WM-Endrunde 2005. – 2) Sonny, eigtl. „Sonny Anderson Da Silva“, brasilian. Abwehrspieler, * 19. September 1970 Goiatura; 1987–90 Vasco da Gama (Rio de Janeiro), 1991/92 Guarani FC (Campinas), 1992/93 Servette Genf, 1993/94 Olympique Marseille, 1994–97 AS Monaco (Torschützenkönig 1996 [21]), 1997–99 FC Barcelona, 1999–2003 Olympique Lyon (Torschützenkönig 2000 [23], 2001 [22]), 2003/04 FC Villarreal, 2004–06 Al-Rayyan SC (Katar), 2006 Al-Gharafa (Doha); sieben Länderspiele (1997–2001; ein Tor). – 3) Viv, eigtl. „Vivian Alexander Anderson“, engl. Abwehrspieler (Rechtsverteidiger), * 29 Juli 1956 Nottingham; 1974–84 Nottingham Forest, 1984–87 FC Arsenal, 1987–90 Manchester United, 1991–93 Sheffield Wednesday, 1993/94 FC Barnsley, 1994/95 FC Middlesbrough; 30 Länderspiele (1978–88; zwei Tore); WM-Endrunde 1982, 1986 (nicht eingesetzt); EM-Endrunde 1980, 1988 (nicht eingesetzt).
| V. Anderson Er trug 1978 als erster Farbiger in der bis dahin 106-jährigen Länderspielgeschichte Englands das Nationaltrikot. |
Andersson, 1) Björn, schwed. Mittelfeldspieler, * 20. Juli 1951 Markaryd; 1970–74 Östers IF, 1974–77 Bayern München, 1977–79 Östers IF (Växjö), 1980/81 Markaryds IF, 1982–84 Vallentuna BK (Schweden); 47 Bundesligaspiele (1974–77; ein Tor); 28 Länderspiele (1972–77; ein Tor); WM-Endrunde 1974. – 2) Daniel, schwed. Mittelfeldspieler, * 28. August 1977 Borgeby; Bruder von [5]; bis 1993 Bjärreds IF (Schweden), 1994–98 Malmö FF, 1998–2001 AS Bari, 2001/02 AC Venedig, 2002/03 Chievo Verona, 2003/04 Ancona Calcio, 2004–11 Malmö FF; 74 Länderspiele (1997–2009); WM-Endrunde 2002 (nicht eingesetzt), 2006. – 3) Kennet, schwed. Angriffsspieler, * 6. Oktober 1967 Eskilstuna; 1985–88 IFK Eskilstuna, 1989–91 IFK Göteborg, 1991–93 KV Mechelen, 1993 IFK Norrköping, 1993/94 Lille OSC, 1994/95 SM Caen, 1995/96 AS Bari, 1996–99 FC Bologna, 1999 Lazio Rom, 1999–2002 FC Bologna, 2002–04 Fenerbahçe SK (Istanbul); 83 Länderspiele (1989–2000; 31 Tore); WM-Endrunde 1994; EM-Endrunde 1992, 2000. – 4) Malin, schwed. Trainerin, * 4. Mai 1973 Kristianstad; war Mittelfeldspielerin: 1983–98 Arkelstorps IF (Schweden), 1999–2001 Älvsjö AIK (Schweden), 2002–05 Malmö FF Dam; 151 Länderspiele (1994–2005); WM-Endrunde 1995, 1999, 2003; EM-Endrunde 2005; olymp. Fußballturnier 2000, 2004; in Schweden Fußballerin des Jahres 2005. – Später Trainerin: 2006–11 Schweden (U 21). – 5) Patrik, schwed. Abwehrspieler, * 18. August 1971 Borgeby; Bruder von [2]; 1989–92 Malmö FF, 1992/93 Blackburn Rovers, 1993–99 Borussia Mönchengladbach, 1999–2001 Bayern München, 2001–04 FC Barcelona, 2004/05 Malmö FF; 212 Bundesligaspiele (1993–2001; elf Tore); 96 Länderspiele (1992–2002; drei Tore); WM-Endrunde 1994; EM-Endrunde 1992, 2000; olymp. Fußballturnier 1992; in Schweden Fußballer des Jahres 1995, 2001. – 6) Roland, schwed. Trainer, * 28. März 1950 Malmö; war Abwehrspieler: 1968–74 Malmö FF, 1975/76 Djurgårdens IF (Stockholm), 1977–83 Malmö FF; 19 Länderspiele (1974–78); WM-Endrunde 1978. – Später Trainer: 1983–85 Malmö FF (Jugend), 1985–87 Al-Ittihad (Djidda), 1988–90 Lunds BK (Schweden), 1991/92 Malmö FF (Assistent), 1993 Al-Ittihad (Djidda), 1994 Malmö FF (Assistent), 1995–97 Qatar SC (Doha), 1997/98 Young Boys Bern, 1998/99 Malmö FF, 2002/03 Al-Shaab (VAE), 2004–09 Schweden (Nationalmannschaft; Assistent von L. → Lagerbäck), 2010 Nigeria (Nationalmannschaft; Assistent von L. Lagerbäck).
Andō, Kozue, jap. Mittelfeldspielerin, * 9. Juli 1982 Utsunomiya; 2002–04 Saitama Reinas (Japan), 2005–09 Urawa Red Diamonds Ladies (Saitama [Japan]), 2010/11 FCR Duisburg; 30 Bundesligaspiele (seit 2010; elf Tore); 87 Länderspiele (seit 1999; 17 Tore); WM-Endrunde 1999, 2007, 2011 (Weltmeisterin); olymp. Fußballturnier 2004, 2008.
Andorra, Fürstentum in den östl. Pyrenäen, 468 km², 83 888 Ew.; Verband: Federció Andorrana de Fútbol, Abk. FAF, gegr. 1994, Sitz: Escaldes-Engordany; Mitglied der FIFA und der UEFA seit 1996; Spielkleidung: Gelb/Rot/Blau. – Höchste Spielklasse: Lliga Nacional (acht Vereine). – INTERNET: www.fedandfutf.com
| Andorra Nach den 14 Spielen der Vorrunde spielen die ersten vier Mannschaften um die Landesmeisterschaft, die letzten vier gegen den Abstieg. |
Andorra la Vella, Hauptstadt von Andorra; FC Santa Coloma (Futbol Club Santa Coloma), gegr. 1986; Spielkleidung: Weiß/Rot/Weiß; Stadion: Comunal de Andorra la Vella, 1 800 Plätze. – INTERNET: www.fcsantacoloma.com
Spieler (Auswahl): I. Alberca – M. Beloa – O. da Cunha – M. dos Santos – J. Fernandez – G. Garcia – L. Gastón – G. Meza – V. Rodriguez – D. Rosa – H. Walker. – Trainer (Auswahl): V. Marques – X. Rouira –Y. Vladimirov.
| FC Santa Coloma: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011 Landespokal 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Andrade, José („Negro“), uruguay. Mittelfeldspieler (Außenläufer), * 1. Oktober 1901 Montevideo, † 4. Oktober 1957 ebenda; 1923–25 CA Bella Vista (Montevideo), 1925–30 Nacional Montevideo, 1931/32 CA Peñarol (Montevideo), 1933 Wanderers Montevideo; 31 Länderspiele (1922–33); Weltmeister 1930; Olympiasieger 1924, 1928. – Sein Neffe Victor Andrade (* 1927, † 1985) war ebenfalls Mittelfeldspieler: u. a. 1950 Central Español Montevideo FC, 1954 CA Peñarol; WM-Endrunde 1950 (Weltmeister), 1954.
| J. Andrade Er liebte den Erfolg, die Show und den Ruhm, führte ein ausschweifendes Leben und feierte Feste. Später verlor er alles, was er besaß und starb schließlich einsam in einem Armenhaus in Montevideo. |
Andreasen, Leon, eigtl. „Leon Hougaard Andreasen“, dän. Mittelfeldspieler, * 23. April 1983 Aidt Thorso; bis 1999 Hammel GF (Dänemark), 1999–2005 Aarhus GF, 2005/06 Werder Bremen, 2007 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen, 2008 FC Fulham, 2009–11 Hannover 96; 65 Bundesligaspiele (2005–10; neun Tore); 15 Länderspiele (2007–09; zwei Tore); U-21-EM-Endrunde 2006.
Andreev, Herman, russ. Trainer, * 20. Januar 1966 Murmansk; war Abwehrspieler: bis 1990 Spartak Moskau, 1990–92 Al-Masry Club (Port Said [Ägypten]),,1992–95 SV Babelsberg 03. – Später Trainer: 2000–02 und 2003 SV Babelsberg 03, 2003/04 VfB Leipzig, 2004/05 Hallescher FC, 2006 SV Yeşilyurt (Moabit [Berlin]), 2007–09 VFC Plauen.
Andrejević, Mihajlo, serb. Funktionär (Prof. Dr. med.), * 16. Juli 1898, † 20. September 1989; von 1938 bis 1982 Mitglied des → FIFA-Exekutivkomitees und FIFA-Vertreter beim → International Football Association Board (IFAB), seit der WM-Endrunde 1970 Vorsitzender der Medizin. Komission, 1966 bis 1982 Mitglied der WM-Organisationskommission; vertrat die FIFA bei den WM-Endrunden 1930–82. Andrejević wurde 1984 mit dem neu geschaffenen „FIFA-Orden“ (→ FIFA) geehrt.
Andreolo, Miguel, ital. Abwehrspieler (Stopper) uruguay. Herkunft; * 6. September 1912 Montevideo, † 15. Mai 1981 Potenza (Italien); 1932–35 Nacional Montevideo, 1935–43 Bologna AGC, 1944 Lazio Rom, 1945–48 SSC Neapel, 1948/49 Catania Calcio, 1949/50 AC Forli (Italien); bestritt als → „Oriundi“ 26 Länderspiele für Italien (1936–42; ein Tor); Weltmeister 1938.
André Santos, eigtl. „André Clarindo dos Santos“, brasilian. Abwehrspieler (Linksverteidiger), * 8. März 1983 São Paulo; bis 2004 Figueirense FC (Florianópolis [Brasilien]), 2005/06 CR Flamengo (Rio de Janeiro), 2006 Atlético Mineiro (Belo Horizonte), 2007 Figueirense FC, 2008/09 Corinthians Paulista (São Paulo), 2009–11 Fenerbahçe SK (Istanbul), 2011 FC Arsenal; 22 Länderspiele (seit 2009).
Andresen, Martin, norweg. Mittelfeldspieler, * 2. Februar 1977 Kråkstad; bis 1992 Kråkstad IL, 1992–94 Ski IL Football (Norwegen), 1995/96 Moss FK, 1997 Viking Stavanger, 1998/99 Stabæk IF, 1999/2000 FC Wimbledon, 2000 Molde FK, 2000–04 Stabæk IF, 2004 Blackburn Rovers und Stabæk IF, 2005–07 SK Brann, 2008–10 Valerenga IF (2009/10 Spielertrainer); 43 Länderspiele (2001–09; drei Tore); in Norwegen Fußballer des Jahres 2003.
Andrews, Marvin, Abwehrspieler aus Trinidad & Tobago, * 22. Dezember 1975 Sanguan; bis 1992 San Juan Jabloteh (Trinidad & Tobago), 1992–97 FC Carib (Trinidad & Tobago), 1997–2000 Raith Rovers FC (Schottland), 2000–04 FC Livingston, 2004–06 Glasgow Rangers, 2006–09 Raith Rovers FC, 2009 Hamilton Academical (Schottland), 2009/10 Queen Of The South (Schottland), 2010/11 Wrexham United; 98 Länderspiele (1996–2009; zehn Tore); WM-Endrunde 2006.
Anelka, Nicolas, frz. Angriffsspieler, * 14. März 1979 Versailles; bis 1993 Saint Quentin FC (Frankreich), 1993–95 INF Clairefontaine (Frankreich), 1996/97 Paris St.-Germain, 1997–99 FC Arsenal, 1999/2000 Real Madrid, 2000/01 Paris St.-Germain, 2001/02 FC Liverpool, 2002–05 Manchester City, 2005/06 Fenerbahçe SK (Istanbul), 2006–08 Bolton Wanderers, 2008–11 FC Chelsea (Torschützenkönig 2009 [19]); 69 Länderspiele (1998–2010; 15 Tore); WM-Endrunde 2010; EM-Endrunde 2000 (Europameister), 2008.
| N. Anelka Er konvertierte 2001 zum Islam und erhielt den moslemischen Namen „Abdul-Salam Bilal“. |
ANFA, Abk. für All-Nepal Football Association, den Fußballverband von → Nepal.
Anfang, Markus, dt. Mittelfeldspieler, * 12. Juni 1974 Köln; bis 1992 KSV Heimersdorf (Köln), 1992–94 Bayer Dormagen (NRW), 1994/95 Bayer 04 Leverkusen, 1995–97 Fortuna Düsseldorf, 1997/98 FC Schalke 04, 1998–2002 FC Tirol (Innsbruck), 2002–04 1. FC Kaiserslautern, 2004 Energie Cottbus, 2004–06 MSV Duisburg, 2006–08 Fortuna Düsseldorf, 2008 Wacker Innsbruck, 2009/10 Eintracht Trier; 73 Bundesligaspiele (1995–2006; drei Tore).
Anfield, Liverpool: Heimstätte des FC Liverpool (an der Anfield Road), 45 000 Plätze, 1884 errichtet und bis 1892 auch Stadion des FC Everton; erster großer Ausbau 1895, weitere folgten 1975, 1992 und 1995; berühmt ist der Tribünensektor „The Kop“ (12 500 Plätze) für die Fans der „Reds“.
Angelov, Stanislav („Franz“), bulgar. Mittelfeldspieler, * 12. April 1978 Sofia; 1992–2001 ZSKA Sofia, 2001–07 Levski Sofia, 2007–10 Energie Cottbus, 2010 Steaua Bukarest, 2011 Anorthosis Famagusta; 57 Bundesligaspiele (2007–09; drei Tore); 35 Länderspiele (seit 2006; zwei Tore).
Angerer, Nadine („Natze“), dt. Torhüterin ital. Herkunft (Vater), * 10. November 1978 Lohr a. Main (Unterfranken); bis 1988 ESV Gemünden (Gemünden am Main [Unterfranken]), 1988–95 ASV Hofstetten (Gemünden am Main), 1995/96 1. FC Nürnberg, 1996–99 Wacker München, 1999–2001 Bayern München, 2001–07 Turbine Potsdam, 2008 Djurgården Damfotboll (Stockholm), 2009–11 1. FFC Frankfurt; 198 Bundesligaspiele (seit 2001); 103 Länderspiele (seit 1996); WM-Endrunde 2003 (Weltmeisterin [nicht eingesetzt]), 2007 (Weltmeisterin), 2011; EM-Endrunde 1997 (Europameisterin [nicht eingesetzt]), 2001 (Europameisterin [nicht eingesetzt]), 2005 (Europameisterin [nicht eingesetzt]), 2009 (Europameisterin); olymp. Fußballturnier 2000 (nicht eingesetzt), 2004 (nicht eingesetzt), 2008.
| N. Angererer Nach dem Weltmeisterschaftsfinale 2007 in Shanghai wurde sie zur besten Torhüterin der WM-Endrunde gewählt, ließ sie doch kein Gegentor zu. Dies gelang zuvor bei gleichem Anlass keinem Torhüter, weder bei den Männern noch bei den Frauen. |
Angers, Frankreich (Stadt in der Region Pays de la Loire); Angers SCO (Angers Sporting Club de I’Ouest), gegr. 1919 als Sporting Club de l’Ouest Angers, seit 1989 Angers SCO; Spielkleidung: Weiß/Schwarz/Weiß; Stadion: Jean-Bouin, 17 000 Plätze. – INTERNET: www.angers-sco.fr
Spieler (Auswahl): L. Amisse – A. Aston – M. Berdoll – S. Bruey – V. Carlier – T. Cygan – J.-M. Guillou – C. Hnatov – R. Kopa – J. Martinelli – T. Ongoly – Pepe Mel – P. Planus – A. Réveillère – U. Romé – M. Stéphan. – Trainer (Auswahl): J.-L- Garcia – D. Goavec – E. Guérit – R. Morini – V. Vasović.
Angola, Republik an der W-Küste Afrikas, 1,247 Mio. km², 12,127 Mio. Ew.; Verband: Federaçao Angolana de Futebol, Abk. FAF, gegr. 1979, Sitz: Luanda; Mitglied der FIFA und der CAF seit 1980; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Rot. – Höchste Spielklasse: Girabola (16 Vereine). – INTERNET: www.fafutebol-angola.og.ao
Angriffsspieler, Bez. für den vorgeschobensten Mannschaftsteil (meist zwei oder drei Angreifer), z. B. rechter (früher Rechtsaußen) und linker Angriffsspieler (früher Linkssaußen), mittlerer Angriffsspieler (früher Mittelstürmer); auch → Doppelspitze.
| Angriffsspieler Forward [engl.] Attaquant [frz.] Delantero [span.] Avançado [port.] Attaccante [ital.] |
Anguilla, Insel der Kleinen Antillen in der Karibik, brit. Kronkolonie, 96 km², 14 436 Ew.; Verband: Anguilla Football Association, Abk. AFA, gegr. 1990, Sitz: The Valley; Mitglied der FIFA und der CONCACAF seit 1996; Spielkleidung: Türkis-Weiß/Orange-Blau/Türkis-Orange. – Höchste Spielklasse: AFA League (sieben Vereine).
Anhalt, Dtl.: Region im Land Sachsen-Anhalt; Hauptort: Dessau:
| Anhalt: Vereine (Auswahl) SV Dessau 05 Vorwärts Dessau |
Anif, Österreich (Gemeinde im Land Salzburg); USK Anif (Union-Sportklub Anif), gegr. am 20. Mai 1947 als TuS („Turn- und Sportunion“) Ainif, im Herbst 1948 Gründung der Sektion Fußball innerhalb der TuS und Umbennennung in USK Anif; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Rot; Stadion: Sportanlage Anif, 1 200 Plätze. – INTERNET: www. usk-leube-anif.at
Spieler (Auswahl): M. Amerhauser – S. Bahar – A. Fötschl – T. Hoang – A. Ivinger – W. Koch – A. Kroissl – A. Macek – T. Schmidhuber – V. Stricker. – Trainer (Auswahl): T. Hofer – S. Holzmann – H. Roitner.
| USK Anif: Erfolge (Auswahl) Salzburger Landesmeister 1978, 1989, 1993, 1998, 2003, 2007 |
Anjalankoski, MyPa, Finnland: → Kouvola.
Anjukow, A, Russland: → Anyukov, A.
Ankara, Hauptstadt der Türkei; 1) Ankaraspor, eigtl. “Ankaraspor Kulübü”, gegr.
1978 als Ankara Belediyespor, 1984–98 Ankara Büyükşehir Belediyespor, 1998–2005 Büyükşehir Belediye Ankaraspor, seitdem Ankaraspor; Spielkleidung: Blau-Weiß/Weiß/Weiß; Spielort: Yenikent; Stadion: Yenikent-Asaş-Stadion, 24 000 Plätze Plätze. S. a. Berliner AK (→ Berlin [6]). – INTERNET: www.ankaraspor.com.tr
Spieler (Auswahl): E. Albayrak – V. Arslan – E. Asik – S. Balci – U. Boral – M. Cakir – R. Kingson – B. Mercimek – B. Molnar – Ö. Özgür – A. Petrous – F. Risp – Y. Simsek – A. Tasdemir – M. Tosun. – Trainer (Auswahl): S. Aybaba – A. Kocaman – J. Röber – S. Sušić.
2) Gençlerbirliği Ankara, eigtl. „Gençlerbirliği SK Ankara“ (Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara), gegr. am 14. März 1923; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Rot; Stadion: „Ankara-Stadion des 19. Mai“, 19 125 Plätze. – INTERNET: www.genclerbirligi.org.tr
Spieler (Auswahl): A. Abdelaziz – F. Akyel – E. Baytar – E. Bolić – U. Boral – B. Christensen – F. Daems – A. Eðvaldsson – A. El-Saqua – Geremi – G. Gönül – A. Hassan – M. Jedinak – I. Mansiz – M. Nas – E. Özbey – O. und R. Öztürk – M. Pektemek – S. Smeltz – K. Tayfun – Ö. Ümit – J. Vranješ – S. Youla – T. Zdebel. – Trainer (Auswahl): S. Abaya – A. Arica – M. Bakkal – F. Çapa – O. Çetin – T. Doll – H. Dramani – M. Kaplan – B. Korkmaz – W. Meeuws – R. Stumpf – E. Yanal – R. Zumdick.
| Gençlerbirliği Ankara: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1987, 2001 |
3) MKE Ankaragücü (Makina Kimya Endüstrisi Ankaragücü), gegr. am 1. Januar 1910; Spielkleidung: Blau/Gelb/Gelb; Stadion: „Ankara-Stadion des 19. Mai“, 19 125 Plätze. – INTERNET: www.ankaragucu.org.tr
Spieler (Auswahl): E. Adatepe – V. Agali – B. Aksancak – E. Baljić – I. Boakye – N. Carle – C. Eris – A. Evren – Geremi – H. Kutlu – I. Mansiz – Z. Özgültekin – M. Özkan – S. Posavec – A. O. Renklibay – M. Sapara – H. Şaş – S. Šesták – F. Tekke – A. Viduslu – R. Vittek – I. Yavuz – M. Zewlakow. – Trainer (Auswahl): V. Bozinoski – H.-P. Briegel – R. Kapsal – H. Karaman – H. Kutlu – T. Lav – R. Lemerre – M. Stoichita – S. Sušić – E. Yenal.
| MKE Ankaragücü: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1972, 1981 |
Annan, Anthony („Tony“), ghanaischer Mittelfeldspieler, * 21. Juli 1986 Accra, bis 2002 Sekondi Eleven Wise (Sekondi-Takoradi [Ghana]), 2003–05 Hasaacas Sekondi (Sekondi-Takoradi [Ghana]), 2005/06 Hearts of Oak (Accra), 2007/08 Start Kristiansand (Norwegen), 2008 Stabæk IF, 2008–10 Rosenborg Trondheim, 2011 FC Schalke 04, 2011 Vitesse Arnhem; neun Bundesligaspiele (seit 2011); 45 Länderspiele (seit 2007; ein Tor); WM-Endrunde 2010.
| A. Annan Sein Onkel ist der Ex-Generalsekretär (1997–2006) der UNO Kofi Annan (* 1938). |
Anonma („Anoma“), Genoveva, eigtl. „Genoveva Anonma Nze“, äquatorialguineische Mittelfeldspielerin, * 19. April 1989 Malabo; bis 2005 Águilas Verdes (Malabo), 2005/06 SA Malabo, 2006/07 Mamelodi Sundowns (Pretoria), 2007/08 SA Malabo, 2009–11 FF USV Jena, 2011 Turbine Potsdam; 50 Bundesligaspiele (seit 2009; 37 Tore); 37 Länderspiele (seit 2002; 24 Tore); WM-Endrunde 2011; Afrikameisterin 2008.
Ansbach, Dtl. (Stadt in Mittelfranken); SpVgg Ansbach, eigtl. „SpVgg Ansbach 09“ (Spielvereinigung Ansbach 1909), gegr. 1909 als TV 1860 Ansbach, seit 1917 SpVgg Ansbach 09; Spielkleidung: Rot; Stadion: PIGROL-Sportpark, 5 000 Plätze. – INTERNET: www.spvgg-ansbach.de
Spieler (Auswahl): H.-J. Brunner – M. Fischer – R. Kovacic – A. Maul – J. Müller – T. Raffel – G. Volkert – A. Wolf. – Trainer (Auswahl): H.-J. Brunner – R. Eisenberger.
| SpVgg Ansbach: Erfolge (Auswahl) Bayerischer Meister 2001 |
Anschlusstor, Tor, das einen gegner. Zweitorevorsprung bis auf ein Tor reduziert, z. B. von 2:4 auf 3:4. S. a. Ehrentor.
Anschneiden, bewusst außermittiges Treffen des Balles, um ihm dadurch einen Drall zu verleihen (→ Effetstoß); nichts für technisch Unbegabte.
Anstoß, Anspiel des Balles zu Spielbeginn, nach einem Torerfolg, zu Beginn der zweiten Halbzeit und zu Beginn jeder Spielzeithälfte einer Verlängerung; wird im Mittelpunkt des Mittelkreises ausgeführt, wenn der Schiedsrichter durch einen Pfiff das Zeichen dazu gegeben hat. Aus einem Anstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Ein inoffizieller Anstoß (als Zeremonie gedacht) ist der → Ehrenanstoß.
| Anstoß Kick off [engl.] Coup d’envoi [frz.] Salida [span.] Pontapé de saida [port.] Calcio d’inizio [ital.] |
Antalya, Türkei (Hauptort der gleichnamigen Provinz); Antalyaspor, eigtl. „Antalyaspor AŞ“ (Antalyaspor Anonym Şirketi), gegr. 1966 durch Fusion der ortsansässigen Vereine Yenikapi Suspor, TEAŞ Işıkspor und Ferrokromspor zu Antalyaspor Kulübü, seit 1997 Antalyaspor AŞ; Spielkleidung: Rot; Stadion: Antalya Mardan, 10 000 Plätze. – INTERNET: www.antalyaspor.tr
Spieler (Auswahl): M. Aslan – J. Bieniuk – A. Bilgin – O. Córdoba – P. Dziewicki – M. Gaudino – T. Gülleri – M. Gürsel – M. Jedinak – I. Kahraman – L. Kartop – U. Kavuk – R. Kingson – V. Musić – H. Özer – R. Rüştü – D. Schuster – M. Suazo – M. Yildiz. – Trainer (Auswahl): R. Abramczik – G. Bulak – Ş. Güneş – J. Jarabinsky – M. Özdilek – M. Unal – Y. Vural.
Antar, Roda, libanes. Mittelfeldspieler, * 12. September 1980 Freetown (Sierra Leone); bis 2001 FC Tadamon Sur Club (Libanon), 2001–03 Hamburger SV, 2003–07 SC Freiburg, 2007–09 1. FC Köln, 2009–11 Shandong Luneng (China); 82 Bundesligaspiele (2001–09; zwölf Tore); 48 Länderspiele (seit 2000; 22 Tore).
Antenen, Charles („Kiki“), schweizer. Angriffsspieler (Rechtsaußen); * 3. November 1929 La Chaux-de-Fonds, † 20. Mai 2000; 1941–52 FC La Chaux-de-Fonds, 1952/53 Lausanne-Sports, 1953–65 FC La Chaux-de-Fonds; 56 Länderspiele (1948–62; 22 Tore); WM-Endrunde 1950, 1954, 1962.
Antić, Radomir, serb. Trainer, * 22. November 1948 Užice; war Abwehrspieler: bis 1968 Sloboda Užice, 1968–76 Partizan Belgrad, 1976–78 Fenerbahçe SK (Istanbul), 1978/79 Real Saragossa, 1979–84 Luton Town; ein Länderspiel für Jugoslawien (1973). – Später Trainer: 1985–88 Partizan Belgrad (Assistent), 1988–91 Real Saragossa, 1991/92 Real Madrid, 1992–95 Real Oviedo, 1995–2000 Atlético Madrid (Landesmeister und -pokal 1996), 2000/01 Real Oviedo, 2003 FC Barcelona, 2004 Celta Vigo, 2008–10 Serbien (Nationalmannschaft [olymp. Fußballturnier 2008, WM-Endrunde 2010]).
Antigua & Barbuda, Staat im Karib. Meer, Kleine Antillen, 442 km², 85 632 Ew.; Verband: Antigua/Barbuda Football Association, Abk. ABFA, gegr. 1928, Sitz: St. John’s; Mitglied der FIFA seit 1972, der CONCACAF seit 1980; Spielkleidung: Gelb-Schwarz/Gelb-Schwarz/Gelb-Schwarz. – Höchste Spielklasse: Red Stripe Premier Division (zehn Vereine). – INTERNET: www.footballantigua.com
Antognoni, Giancarlo, ital. Angriffsspieler, * 1. April 1954 Marsciano; 1970–72 US Astimacobi (bei Turin), 1972–87 AC Florenz, 1987–89 Lausanne-Sports; 73 Länderspiele (1974–83; sieben Tore); WM-Endrunde 1978, 1982 (Weltmeister); EM-Endrunde 1980.
Antoniadis, Antonis, griech. Angriffsspieler, * 25. Mai 1946 Xanthi; bis 1968 AO Xanthi, 1968–78 Panathinaikos Athen (Torschützenkönig 1970 [25], 1972 [39], 1973 [22], 1974 [26], 1975 [20, mit ROBERTO CALCADERA von Ethnikos Piräus]), 1978/79 Olympiakos Piräus, 1979–81 Atromitos Athinon (Athen), 1981/82 Panathinaikos Athen; 21 Länderspiele (1970–77; sechs Tore).
Antwerpen, Belgien (Stadt in Flandern); 1) Antwerp FC, eigtl. “Royal Antwerp FC” (Royal Antwerp Football Club), gegr. am 1. September 1880 als Antwerp Cricket and Football Club, 1894 Anschluss von Cercle d’Agrément Antwerpen, seit 1895 Royal Antwerp Football Club; Spielkleidung: Rot/Weiß/Rot; Spielort: Deurne; Stadion: Bosuilstadion, 16 649 Plätze. – INTERNET: www.rafc.be
Spieler (Auswahl). J. Aloisi – A. Biga – N. Claesen – A. Czerniatynski – A. Di Gregorio – F. Dong – L. Fazekas – A. Gómez – K. Hilton – N. Jurčević – R. Kaiser – H.-P. Lehnhoff – V. Mees – E. Meijer – J. O’Shea – V. Petrović – L. Pilot – J. Poortvliet – A. Riedl – P. Ristovic – K.-H. Seol – F. Severeyns – C. Tomsin – L. van Gaal – R. van Gool – W. van Moer – G. Verjans. – Trainer (Auswahl): P. Csernai – A. Desaeyere – A. Haan – H. Houwaart – W. Joyce – G. Keßler – L. Novák – R. Svilar – G. Thys – J. Tipuric – R. van Acker.
| Antwerp FC: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1929, 1931, 1944, 1957 Landespokal 1955, 1992 |
2) Beerschot VAC (Beerschot Voetbalen Atletikclub), gegr. am 3. September 1899 als Beerschot AC, 1926–68 R Beerschot AC, 1968–99 Beerschot VAC, 1999 aufgelöst durch Fusion mit KFC Germinal Ekeren zu Germinal Beerschot (→ Antwerpen [3]).
Spieler (Auswahl): R. Braine – R. Claessen – L. Emmerich – W. Sonck – G. Thys – S. Tahamata – A. Tolsa – J. Tomaszewski – K. Vandenbergh – J. Vliers. – Trainer (Auswahl): J. Bonfrère – D. Davidovic – D. Frivalsky – P. Garot – F. Geeraerts – B. Hughes – L. Novák.
| Beerschot VAC: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1938, 1939 Landespokal 1971, 1979 |
3) Germinal Beerschot, eigtl. „Germinal Beerschot Antwerpen“, gegr. 1920 in Ekeren (heute zu Antwerpen) als FC Germinal Ekeren, 1971–99 KFC Germinal Ekeren, 1999 Fusion mit Beerschot VAC (→ Antwerpen [2]) zu Germinal Beerschot Antwerpen; Spielkleidung: Violett/Weiß/Violett-Weiß; Spielort: Wilrijk; Stadion: Stade de Olympique („Het Kiel“), 25 000 Plätze. – INTERNET: www.germinal-beerschot.be
Spieler (Auswahl): M. Aerts – A. Bancé – J. Cavens – N. Claesen – L. Da Silva – M. Dembélé – J. De Roeck – D. Dheedene – T. Dosunmu – B. Goor – A. Ilie – S. Keita – W. Meeuws – N. Milenkovic – I. Mitreski – A. Mokoena – D. Quinteros – W. Sonck – F. Sterchele – S. Tahamata – J. van Damme – K. Van Doren – T. Vermaelen – A. Vidmar. – Trainer (Auswahl): A. Anthuenis – M. Brys – H. Helleputte – F. van der Elst.
| Germinal Beerschot: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1997, 2005 |
Anyang, Südkorea: Stadt 20 km südl. von Seoul, in der von 1995 bis 2002 Anyang LG Cheetahs beheimatet war (→ Seoul).
Anyukov, Aleksandr, russ. Abwehrspieler (Rechtsverteidiger), * 28. September 1982 Samara; 2000–05 Krylja Sowjetow Samara, 2005–11 Zenit St. Petersburg; 48 Länderspiele (seit 2004; ein Tor); EM-Endrunde 2004, 2008.
Aogo, Dennis, dt. Abwehrspieler (Linksverteidiger) nigerian. Herkunft (Vater), * 14. Januar 1987 Karlsruhe; 1991–93 FV Grünwinkel (Karlsruhe), 1993/94 Bulacher SC (Karlsruhe), 1994–2000 Karlsruher SC, 2000–02 Waldhof Mannheim, 2002–08 SC Freiburg, 2008–11 Hamburger SV; 89 Bundesligaspiele (seit 2004; ein Tor); sieben Länderspiele für Deutschland (seit 2010); U-21-Europameister 2009; WM-Endrunde 2010. S. a. Fußball [Migration in Deutschland].
AOL-Arena, Hamburg: → HSH-Nordbank-Arena.
Aouate, David („Dudu“), israel. Torhüter, * 17. Oktober 1977 Nazerat Illit; bis 1991 Maccabi Haifa, 1991–93 Maccabi Tiberius (Israel), 1993–97 Maccabi Haifa, 1997/98 Maccabi Tel Aviv, 1988–2001 Hapoel Haifa, 2001–03 Maccabi Haifa, 2003–06 Racing Santander, 2006–08 Deportivo La Coruña, 2008–11 RCD Mallorca; 41 Länderspiele (seit 1999).
Apertura, Lateinamerika: → Spieljahr.
APF, Abk. für Asociación Paraguaya de Fútbol, den Fußballverband von → Paraguay.
Apostolakis, Efstratios, griech. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 11. Mai 1964 Agrinio; 1984/85 Panaitolikos Agrinio, 1985–90 Olympiakos Piräus, 1990–99 Panathinaikos Athen; 96 Länderspiele (1986–96; fünf Tore); WM-Endrunde 1994.
Appiah, Stephen, ghanaischer Mittelfeldspieler, * 24. Dezember 1980 Accra; bis 1997 Hearts of Oak (Accra), 1997–2000 Udinese Calcio, 2000–02 AC Parma, 2002/03 Brescia Calcio, 2003–05 Juventus Turin, 2005–09 Fenerbahçe SK (Istanbul), 2009/10 FC Bologna, 2010/11 AC Cesena; 68 Länderspiele (2005–10; 16 Tore); WM-Endrunde 2006, 2010; in Ghana Fußballer des Jahres 2004, 2005.
Apulien, Italien: Region im SO des Landes; Hauptort: Bari.
| Apulien: Vereine (Auswahl) AS Bari US Foggia US Lecce |
Aqsaqtuk → Fußball [Geschichte].
Aqtöbe (auch Aktjubinsk), Kasachstan (Hauptstadt der gleichnamigen Region); FK Aqtöbe (Futbolnyj Klub Aqtöbe), gegr. 1967 als FK Aktjubinsk, seit 1997 FK Aqtöbe; Spielkleidung: Rot/Blau/Blau; Stadion: Zentralstadion, 13 500 Plätze. – INTERNET: www.fcaktobe.kz
Spieler (Auswahl): U. Asanbaev – K. Aschirbekov – V. Curcic – Z. Dekhanov – Z. Joksimovic – N. Khokhlov – D. Kishenko – V. Krivenzov – Y. Logvinenko – R. Nesterenlo – S. Rogaciov – S. Smakov – A. Sokolenko – M. Tleshev – R. Urazbahti – O. Voskoboynikov. – Trainer (Auswahl): A. Ishenko – A. Miroshnichenko – V. Muhanov.
| FK Aqtöbe: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 2005, 2007, 2008, 2009 Landespokal 2008 |
Äquatorialguinea, Repulik in W-Afrika, 28 051 km², 501 000 Ew.; Verband: Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Abk. FEGUIFUT, gegr. 1960, Sitz: Malabo; Mitglied der FIFA und der CAF seit 1986; Spielkleidung: Rot.
| Äquatorialguinea: Erfolge (Auswahl) Frauen Afrikameister 2008 |
Aquilani, Alberto („Il Principe”), ital. Mittelfeldspieler, * 7. Juli 1984 Rom; bis 1995 USD Spes Montesacro (Rom), 1995–2003 AS Rom, 2003/04 US Triestina, 2004–09 AS Rom, 2009/10 FC Liverpool, 2010/11 Juventus Turin; 16 Länderspiele (seit 2006; drei Tore); EM-Endrunde 2008.
Arab Cup, in unregelmäßigen Abständen ausgetragener Wettbewerb der Union of Arab Football Federationes (→ AFF [1]), offen für deren Mitgliedsländer (zw. 1966 und 1985 durch den Palästina Cup ersetzt).
| Arab Cup: Sieger | |
| 1963 1964 1966 1985 1988 1992* 1998 2002 | Tunesien Irak Irak Irak Irak Ägypten Saudi-Arabien Saudi-Arabien |
| * Im Rahmen der Arabischen Spiele |
Arabische Champions League, TV-gesponsorter Vereinswettbewerb für Teams aus dem arab. Raum; 1982–2001 als Arab Club Champions Cup sowie 2002 und 2003 als Prince Faisal bin Fahad Tournament geführt. Der Wettbewerb hat nicht die Bedeutung wie die → AFC Champions League und die → African Champions League und wird ohne die jeweiligen Landesmeister ausgetragen.
.
| Arabische Champions League: Sieger (seit 2002) | |
| 2002 | Al-Ahli (Djidda) |
| 2003 | Zamalek SC (Kairo) |
| 2004 | CS Sfax (Tunesien) |
| 2005 | Al-Ittihad (Djidda) |
| 2006 | Raja Casablanca (Marokko) |
| 2007 | ES Sétif (Algerien) |
| 2008 | ES Sétif Sétif (Algerien) |
| 2009 | Espérance Sportive de Tunis (Tunesien) |
Arad, Rumänien (Stadt im Banat); UT Arad, eigtl. „FC UT Arad“ (Fotbal Club Unizale Textile Arad), gegr. am 18. April 1945 als IT Arad, 1958–85 UT Arad, 1985–94 FCM UT Arad, seit 1994 FC UT Arad; Spielkleidung: Rot/WeißWeiß; Stadion: Micul Highbury, 20 000 Plätze. – INTERNET: www.uta-arad.ro
Spieler (Auswahl): M. Axente – G. Bacut – L. Bonyhadi – L. Brosovszky – M. Coras – G. Cornea – F. Domide – O. Dorin – H. Duckadam – F. und N. Dumitrescu – G. Gornea – G. Jankovic – I. Lereter – A. Marki – A. Mercea – S. Oncica – M. Petescu – I. Petschovschi – P. Schiopu – G. Vaczi. – Trainer (Auswahl): M. Barbu – N. Dumitrescu – M. Lăcătuş – L. Marius – I. Popa.
| UT Arad: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1947, 1948, 1950, 1954, 1969, 1970 Landespokal 1948, 1953 |
Aragonés, Luis, eigtl. „José Luis Aragonés Suárez Martinez“, span. Trainer, * 28. Juli 1938 Hortaleza (zu Madrid); war Angriffsspieler: 1957/58 FC Getafe, 1958/59 Recreativo Huelva, 1959/60 Hércules Alicante (Spanien), 1960 AD Plus Ultra (Madrid), 1960/61 Real Oviedo, 1961–64 Real Betis Sevilla, 1964–74 Atlético Madrid (Torschützenkönig 1970 [16, mit → Amancio und J. → Gárate]); elf Länderspiele (1964–71; drei Tore). – Später Trainer: 1974–80 Atlético Madrid, 1981/82 Real Betis Balompié (Sevilla), 1982–87 Atlético Madrid, 1987/88 FC Barcelona, 1990/91 Espanyol Barcelona, 1991–93 Atlético Madrid, 1993–95 FC Sevilla, 1995–97 CF Valencia, 1997/98 Real Betis Balompié, 1999/2000 Real Oviedo, 2000/01 RCD Mallorca, 2001–03 Atlético Madrid, 2003/04 RCD Mallorca, 2004–08 Spanien (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2006, EM-Endrunde 2008]), 2008/09 Fenerbahçe SK (Istanbul); Welt-Nationaltrainer 2008.
| L. Aragonés: Erfolgsstationen (Auswahl) Grau Atlético Madrid Grau Grau FC Barcelona Spanien | Grau Grau Grau Landesmeister 1977 Landespokal 1976, 1985, 1992 Weltpokal 1974 Landespokal 1988 Europameister 2008 |
Arango, Juan, eigtl. „Juan Fernando Arango Sáenz“, venezolan. Mittelfeldspieler (seit 2007 auch span. Staatsbürgerschaft), * 17. Mai 1980 Maracay; 1987–97 UCV Aragua (Venezuela), 1997–99 Nueva Cadiz FC (Cumana [Venezuela]), 1999 Caracas FC (Venezuela), 2000 CD Saltillo (Mexiko), 2000/01 CF Monterrey, 2002/03 CF Pachuca, 2003/04 Puebla FC, 2004–09 RCD Mallorca, 2009–11 Borussia Mönchengladbach; 59 Bundesligaspiele (seit 2009; sechs Tore); 96 Länderspiele für Venezuela (seit 1999; 19 Tore).
„Aranycsapat“ [ungar. „Goldene Elf”], Bez. für die ungar. Nationalmannschaft zw. 1950 und 1954, die 32 Pflichtspiele in Folge (vom 14. Mai 1950 bis zum WM-Finale am 4. Juli 1954) nicht verlor. Unvergessen in dieser Ära ist das → „Spiel des Jahrhunderts“.
Arbeiter-Turner-Bund, Abk. ATB, am 2. Mai 1893 in Gera gegründeter erster proletar. dt. Körperkulturverband, in dem der Arbeiterfußball seine Heimat fand. Der 9. ATB-Bundesturntag fasste am 1. Juni 1909 den Beschluss, dass „ … Spielvereine, welche die Statuten des ATB anerkennen, in den ATB aufgenommen werden dürfen.” Danach entwickelte sich der Arbeiterfußballsport zwar sprunghaft, blieb jedoch im Vergleich zum bürgerl. Fußball relativ unbedeutend. Ab 1920 fanden Endrunden um die dt. Meisterschaft der „Sparte Fußball“ des Arbeiter-Turn-und-Sport-Bundes (Abk. ATSB, 1919 aus dem ATB hervorgegangen) statt. Die Nationalmannschaft des ATSB absolvierte von 1924 bis 1932 45 Länderspiele (Bilanz: 30 Siege, drei Unentschieden, zwölf Niederlagen).
Árbeloa, Álvaro, eigtl. „Álvaro Arbeloa Coca“, span. Abwehrspieler (Innenverteidiger), * 17. Januar 1983 Salamanca; 1994–2000 Real Saragossa, 2000–06 Real Madrid Castilla bzw. Real Madrid, 2006/07 Deportivo La Coruña, 2007–09 FC Liverpool, 2009–11 Real Madrid; 25 Länderspiele (seit 2008); Weltmeister 2010; Europameister 2008.
Arconada, Luis, eigtl. “Luis Miguel Arconada Etxarri“, span. Torhüter, * 26. Juni 1954 San Sebastián; 1973–89 Real Sociedad (San Sebastián; 551 Primera-División-Spiele); 59 Länderspiele (1977–85); WM-Endrunde 1978 (nicht eingesetzt), 1982; EM-Endrunde 1980, 1984.
| Arconada Er wurde 1980, 1981 und 1982 mit der “Trofeo Ricardo Zamora” ausgezeichnet. |
Arda Turan, türk. Mittelfeldspieler, * 30. Januar 1987 Fatih (zu Istanbul); 1999–2002 Altıntepsi Makelspor (Istanbul), 2002–04 Galatasaray SK (Istanbul), 2005/06 Manisaspor (Türkei), 2006–11 Galatasaray SK, 2011 Atlético Madrid; 48 Länderspiele (seit 2006; neun Tore); EM-Endrunde 2008.
Ardiles, Osvaldo („Ossie“), eigtl. „Osvaldo César Ardiles“, argentin. Trainer, * 3. August 1952 Bell Ville (zu Córdoba); war Mittelfeldspieler („Pitón“): 1969–73 Instituto Atlético Central Córdoba, 1973/74 CA Belgrano (Córdoba), 1975–78 CA Huracán (Buenos Aires), 1978–82 Tottenham Hotspur, 1982/83 Paris St.-Germain, 1983–88 Tottenham Hotspur, 1988 Blackburn Rovers, 1988/89 Queens Park Rangers (London), 1989 Swindon Town (Spielertrainer); 53 Länderspiele (1975–82; zwölf Tore); WM-Endrunde 1978 (Weltmeister), 1982. – Später Trainer: 1989–91 Swindon Town, 1991/92 Newcastle United, 1992/93 West Bromwich Albion, 1993/94 Tottenham Hotspur, 1995 CD Guadalajara, 1996–98 Shimizu S-Pulse (Ligapokal 1996), 1999 Croatia Zagreb, 2000/01 Yokohama Marinos, 2001 Al-Ittihad (Djidda), 2002/03 RC Avellaneda, 2003–05 Tokyo Verdy, 2006/07 Beitar Jerusalem, 2007 CA Huracán, 2008 Club Cerro Porteño (Asunción).
| O. Ardiles Er zählt zum erlesenen Kreis der Ehrenmitglieder des Tottenhamer Traditionsklubs aus dem Londoner Norden und vertritt den Verein als dessen Botschafter. |
Arena → Stadion.
Arena, Bruce, US-amerikan. Trainer ital. Herkunft, * 21. September 1951 Brooklyn (New York City); war Torhüter: u. a. 1969–71 Nassau Community College (USA); ein Länderspiel (1973). – Später Trainer: 1978–96 University of Virginia (USA), 1996 USA (U 23), 1996–98 United Washington (MLS-Meister 1996, 1997), 1998–2006 USA (Nationalmannschaft [WM-Endrunde 2002, 2006, CONCACAF-Meister 2002, 2005]), 2006/07 RB New York, 2008–11 LA Galaxy (Carson).
Arena AufSchalke, Gelsenkirchen: → Veltins-Arena.
Arévalo Rios, Egidio, eigtl. „Egidio Raúl Arévalo Rios“, ecuadorian. Mittelfeldspieler, * 1. Januar 1982 Paysandú; 1999–2001 Paysandú Bella Vista, 2002–06 CA Bella Vista (Montevideo), 2006/07 CA Peñarol (Montevideo), 2008 Danubio FC (Montevideo), 2009 Club San Luis (San Luis Potosi [Mexiko]), 2007–10 CF Monterrey, 2010 CA Peñarol, 2011 Botafogo FR (Rio de Janeiro); 14 Länderspiele (seit 2006); WM-Endrunde 2006.
Argentinien, Staat in S-Amerika, 2,780 Mio. km², 40,134 Mio. Ew.; Verband: Associación del Fútbol Argentino, Abk. AFA, gegr. 1893, Sitz: Buenos Aires; Mitglied der FIFA seit 1912, der CONMEBOL seit 1916; Spielkleidung: Hellblau-Weiß/Schwarz/Weiß. – Höchste Spielklasse: Primera A (20 Vereine). – INTERNET: www.afa.org.ar
| Argentinien: Erfolge (Auswahl) Weltmeister 1978, 1986 Olympiasieger 2004, 2008 Südamerikameister 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959 Copa América 1991, 1993 Konföderationenpokal 1992 Frauen Südamerikameister 2006 Junioren U-20-Jugendweltturnier 1979 U-20-Weltmeister 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 |
Argentinos Juniors, Argentinien: → Buenos Aires [1].
Århus (bis 1948 Aarhus), Dänemark (Stadt in Mitteljütland); Aarhus GF (Aarhus Gymnastik Forening), gegr. am 26. September 1880; Spielkleidung: Weiß/Blau/Weiß; Stadion: Atletion, 21 000 Plätze. – INTERNET: www.agf.dk
Spieler (Auswahl): J. Amdisen – L. Andreasen – L. Bastrup – T. Bechmann – J. Bjerregaard – O. Budtz – H. Bundgaard – L. Dannerup – G. Dembélé – H. Enoksen – P. Feilhaber – P. Foldgast – P. Friman – H. From – S. Grahn – J. Høyer – A. und H. Jensen – M. Jørgensen – G. Kjeldberg – B. Kristensen – H. Nielsen – J. Olesen – J. Poulsen – F. Povlsen – N. Rafael – T. Rasmussen – Mads und Marc Rieper – A. Rou – P. Sand – H. Sigurdsson – J. Sivebæk – J. Sørensen – T. Thorninger – D. Williams – B. Wolmar. – Trainer (Auswahl): S. Åkeby – J. Bjerregaard – O. Christensen – B. Guttmann – P. Hansen – A. Hebo – A. Larsen – O. Pedersen – A. Reese – M. Rieper – P. Sand – J. Stampe – J. Wähling.
| Aarhus GF: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1955, 1956, 1957, 1960, 1986 Landespokal 1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996 |
Arles, Frankreich (Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône); AC Arles-Avignon (L’Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon), gegr. am 18. Februar 1913; Spielkleidung: Gelb-Blau/Blau/Blau; Stadion: Parc des Sports, 7 194 Plätze. – INTERNET: www.arles-avignon.com
Spieler (Auswahl): A. Ayew – A. Basinas – H. Bouazza – R. Cabella – A. Charisteas – D. Cissé – K. Diawara – M. Domingo – K. Ghilas – G. Givet – D. Koranyi – C. Meriem – C. Merville – F. Pavón – B. Psaume. – Trainer (Auswahl): M. Estevan – F. Hadžibegić.
Arlt, 1) Harry (“Dampf”), dt. Trainer, * 11. November 1926 Dresden-Friedrichstadt; war Angriffsspieler (Mittelstürmer): 1936–45 Dresdner Sportfreunde 01, 1945–50 SG Dresden-Mickten, 1950/51 Sachsenverlag Dresden, 1951–54 Rotation Dresden (Torschützenkönig 1953 [26]), 1954–59 Einheit Dresden; 139 (DDR-)Oberligaspiele (1951–59; 68 Tore). – Später Trainer: 1970–78 Lokomotive Dresden. – 2) Willi, dt. Angriffsspieler (Linksaußen), * 27. Oktober 1919 Röderau-Bobersen (Sa.), † 27. Juli 1947 (sowjet. Kriegsgefangenschaft); bis 1937 SV Röderau, 1937–42 Riesaer SV, 1942–44 SV Thorn (Westpreußen); elf Länderspiele (1939–42; zwei Tore); spielte repräsentativ für Sachsen.
Armenien, Republik im Hochland von Armenien (Vorderasien), 29 800 km², 3,2 Mio. Ew.; Verband: Football Federation of Armenia, Abk. FFA, gegr. 1992, Sitz: Jerewan; Mitglied der FIFA und der UEFA seit 1992; Spielkleidung: Rot/Blau/Rot. – Höchste Spielklasse: STAR Premier League (acht Vereine). – INTERNET: www.ffa.am
| Armenien Seit dem 23. September 1991 unabhängig – zuvor Bestandteil (als „Armenische SSR“) der UdSSR –, bestritt Armenien am 12. Oktober 1992 sein erstes Länderspiel (0:0 gegen Moldawien). |
Armfield, James („Jimmy“), engl. Trainer, * 21. September 1935 Denton; war Abwehrspieler: 1954–71 FC Blackpool; 43 Länderspiele (1959–66); WM-Endrunde 1962, 1966 (Weltmeister [nicht eingesetzt]). – Später Trainer: 1971–74 Bolton Wanderers, 1974–78 Leeds United.
| J. Armfield Er wurde 2000 mit dem „Order of the British Empire“ (OBE) geehrt. |
Arnautović, Marko, österr. Angriffsspieler serb. Herkunft (Vater), auch serb. Staatsbürgerschaft, 19. April 1989 Wien-Floridsdorf; 1995–98 Floridsdorfer AC (Wien), 1998–2001 Austria Wien, 2001/02 Vienna Wien, 2002/03 Austria Wien, 2003/04 Rapid Wien, 2004–06 Floridsdorfer AC, 2006–09 FC Twente (Enschede), 2009/10 Inter Mailand, 2010/11 Werder Bremen; 25 Bundesligaspiele (seit 2010; drei Tore); zwölf Länderspiele für Österreich (seit 2008; fünf Tore).
Arnesen, Frank, dän. Funktionär, * 30. September 1956 Kopenhagen; war Mittelfeldspieler: 1962–75 Fremad Amager (Kopenhagen), 1975–81 Ajax Amsterdam, 1981–83 CF Valencia, 1983–85 RSC Anderlecht, 1985–88 PSV Eindhoven; 52 Länderspiele (1977–87; 14 Tore); WM-Endrunde 1986; EM-Endrunde 1984. – Später Trainerssistent (1991–93 PSV Eindhoven) und Sportdirektor (1994–2004 PSV Eindhoven, 2004/05 Tottenham Hotspur, 2009–11 FC Chelsea, 2011 Hamburger SV).
| F. Arnesen „Meine Philosophie ist es, nicht nur Spieler für heute, sondern auch Spieler für morgen zu holen.“ |
Arnhem (dt. Arnheim), Niederlande (Hauptort der Provinz Gelderland); Vitesse Arnhem, eigtl. „SBV Vitesse“ (Stichting Betaald Voetball Vitesse), gegr. am 14. Mai 1892 als VAV Vitesse Arnhem, 1984–90 Arnhemse VC Vitesse, seitdem SBV Vitesse; Spielkleidung: Schwarz-Gelb/Weiß/Weiß; Stadion: Gelredome, 26 900 Plätze. – INTERNET: www.vitesse.nl
Spieler (Auswahl): M. Amoah – A. Arnhem – P. Cocu – T. de Mul – F. de Munck – P. Fränkel – T. Jannsen – L. Kingston – R. Knopper – D. Lazović – N. Machlas – R. Makaay – S. Rajković – P. Rink – S. Sansoni – D. Stevanovič – V. Stojković – H. ten Cate – R. van der Schaaf – P. van Hooijdonk – P. Verhaegh – H. Wapenaar – A. Yakuba – M. Zongo. – Trainer (Auswahl): L. Beenhakker – T. Bos – A. de Mos – F. de Munck – A. Ferrer – J. Jongbloed – A. Jorge – R. Koeman – H. Neumann – E. Sturing – H. ten Cate.
Arnold, 1) Graham, eigtl. “Graham James Arnold”, austral. Trainer, * 3. August 1963 Sydney; war Angriffsspieler: 1980–82 Canterbury FC (Australien), 1983–90 Sydney Croatia (Torschützenkönig 1986 [15]), 1990–92 Roda JC (Kerkrade), 1992–94 RFC Lüttich, 1994 Sporting Charleroi, 1995/96 NAC Breda, 1997 Sanfrecce Hiroshima, 1998–2000 Northern Spirit FC (Sydney; Spielertrainer); 56 Länderspiele (1985–97; 19 Tore). – Später Trainer: 2000–07 Australien (Nationalmannschaft; bis 2006 Assistent [WM-Endrunde 2006], 2006/07 Cheftrainer, 2007–10 Assistent [olymp. Fußballturnier 2008, WM-Endrunde 2010]), 2010/11 Central Coast Mariners (Gosford [Australien]). – 2) Marc, dt. Funktionär (auch südafrikan. Staatsbürgerschaft), * 19. September 1970 Johannesburg (Südafrika); war Mittelfeldspieler: bis 1984 Rot-Weiß Lindorf (Ratingen [NRW]), 1984–92 Stuttgarter Kickers, 1992/93 Freiburger FC, 1993/94 SSV Ulm 1846 (Torschützenkönig 1994 [24]), 1994/95 Borussia Dortmund, 1996–98 Hertha BSC, 1999/2000 Karlsruher SC, 2000–03 LR Ahlen, 2003–05 Eintracht Braunschweig, 2005–07 Hessen Kassel; 35 Bundesligaspiele (1994–98; zwei Tore); 148 Zweitligaspiele (1999–2003; 23 Tore). – Später Funktionär: 2007/08 KSV Hessen Kassel (Manager), 2008–11 Eintracht Braunschweig (Sportl. Leiter).
Arnstadt, Dtl. (Stadt in Thüringen); SV 09 Arnstadt (Sportverein 09 Arnstadt), gegr. am 1. September 1949 in Rudisleben (seit 1999 zu Arnstadt) als BSG Podjomnik Rudisleben, 1952 Fusion mit BSG Nafa Ichtershausen (Nachbargemeinde) zu BSG Motor Rudisleben (eigtl. „BSG Motor Ichtershausen-Rudisleben“), 1990–95 SV Ichtershausen-Rudisleben, 1995–2002 SV Rudisleben, 2002 Fusion mit FV BC 07 Arnstadt (gegr. 1907) zu SG Rudisleben/BC 07 Arnstadt, seit 2009 SV 09 Arnstadt; Spielkleidung: Rot/Weiß/Rot; Stadion: Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, 4 000 Plätze. – INTERNET: www.sv09-arnstadt.de
Spieler (Auswahl): H. Brosselt – H. Bühner – W. Frank – K. Goldbach – H.-J. Lässig –H. Latsny – J. Lippert – H. Molata – J. Reske – K. Schröder – R. Schulenberg – T. Skaba – H. Wamser. – Trainer (Auswahl): K. Bangert – J. Heun – A. Krebs.
| SV 09 Arnstadt: Erfolge (Auswahl) Bezirksmeister* 1959, 1962, 1964, 1978 * Bezirk Erfurt |
Arppi Filho, Romualdo, brasilian. Schiedsrichter, * 7. Januar 1939 Santos; seit 1957 CBF-Schiedsrichter, 1963–87 FIFA-Referee; 36 Länderspiele (1966–87); WM-Endrunde 1986 (u. a. Finale); olymp. Fußballturnier 1968, 1980, 1984; Weltpokal 1984; Weltschiedsrichter des Jahres 1987.
Ar-Rayyan, Katar (Hauptort des gleichnamigen Distrikts); Al-Rayyan SC, (Al-Rayyan Sportclub), entstand 1967 durch Fusion von Rayyan FC und Nusoor Club; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Schwarz; Stadion: Ahmed bin Ali, 25 000 Plätze. – INTERNET: www.rayyanclub.com
Spieler (Auswahl): Afonso Alves – S. Anderson – J. Bąk – M. Basler – F. und R. de Boer – M. Bordon – C. Dugarry – B. El-Mourbaki – F. Hierro – R. Júnior – S. Lamouchi – Y. Mokhtari – L. Mpenza – Ricardinho – S. Trabelsi. – Trainer (Auswahl): L. Fernández – P. Lechanter – R. Madjer – M. Paquetá.
Arsenal, FC, England: → London [4].
Arsenal de Sarandi, Argentinien: → Avellaneda [1].
Arsenal LFC, England: → London [4].
Arshavin, Andrey (auch „Andrei Arschawin”), russ. Angriffsspieler, * 29. Mai 1981 Leningrad (heute Sankt Petersburg); 1999–2009 Zenit St. Petersburg, 2009–11 FC Arsenal; 52 Länderspiele (seit 2002; 16 Tore); EM-Endrunde 2008; in Russland Fußballer des Jahres 2006.
Artime, Luis („Artillero“), argentin. Angriffsspieler (Mittelstürmer), * 12. Dezember 1938 Buenos Aires; 1958–65 CA River Plate (Buenos Aires), 1966–68 CA Independiente (Avellaneda), 1969 SE Palmeiras (São Paulo), 1969–71 Nacional Montevideo, 1972 Fluminense FC (Rio de Janeiro), 1973/74 Nacional Montevideo; 25 Länderspiele (1961–67; 24 Tore); WM-Endrunde 1966.
Artner, Peter, österr. Mittelfeldspieler, * 20. Mai 1966 Wien; 1983–86 Austria Wien, 1986/87 Vienna Wien, 1987–93 Admira Wacker Wien, 1993–96 Austria Salzburg, 1996/97 Hércules Alicante, 1997–2000 US Foggia Calcio, 2001/02 SKN St. Pölten; 55 Länderspiele (1987–96; ein Tor); WM-Endrunde 1990.
Aruba, Insel der Kleinen Antillen vor der N-Küste S-Amerikas, 193 km², 71 890 Ew.; Verband: Arubaanse Voetbal Bond, Abk. AVB, gegr. 1932, Sitz: Noord; Mitglied der FIFA und der CONCACAF seit 1988; Spielkleidung: Gelb/Blau/Gelb-Blau. – Höchste Spielklasse: Division di Honor (16 Vereine). – INTERNET: www.avaruba.aw
Arveladze, Shota (auch „Schota Arweladse“), georg. Angriffsspieler, * 22. Februar 1973 Tiflis; 1990/91 Martve Tiflis, 1991/92 Iberia Tiflis, 1992/93 Iiberia-Dinamo Tiflis, 1993 Trabzonspor (Türkei), 1994 Dinamo Tiflis, 1995–97 Trabzonspor (Torschützenkönig 1996 [25]), 1997–2001 Ajax Amsterdam, 2001–05 Glasgow Rangers, 2005–07 AZ Alkmaar, 2007/08 UD Levante (Valencia); 60 Länderspiele (1997–2007; 27 Tore); in Georgien Fußballer des Jahres 1994, 1998, 2007. – Sein Zwillingsbruder Archil Arveladze (auch „Artschil Arweladse“), war ebenfalls Angriffsspieler: 1991–93 Iberia bzw. Dinamo Tiflis, 1993–97 Trabzonspor, 1997–2000 NAC Breda, 2000–03 1. FC Köln, 2003/04 Dinamo Tiflis, 2004/05 Lokomotive Tiflis; 29 Bundesligaspiele (2000–02; sieben Tore); 32 Länderspiele (1997–2003; sechs Tore). – Ihr älterer Bruder Revaz Arveladze (* 1969), auch „Rewas Arweladse“, war Mittelfeldspieler: bis 1993 Iberia bzw. Dinamo Tiflis, 1993/94 1. FC Köln, 1994/95 Tennis Borussia, 1995/96 FC Homburg, 1996/97 KV Mechelen, 1997/98 FC Homburg, 1998/99 Dinamo Tiflis, 1999/2000 Rot-Weiß Oberhausen; sieben Bundesligaspiele (1993/94; ein Tor).
Arvidsson, Magnus, schwed. Angriffsspieler, * 12. Februar 1973 Ängelholm; 1979–91 Förslövs IF (Schweden), 1992–94 Helsingborgs IF, 1995–97 IFK Hässleholm (Schweden), 1998/99 Trelleborgs FF, 1999–2006 Hansa Rostock, 2006–08 Halmstad BK, 2009 Helsingborgs IF; 154 Bundesligaspiele (1999–2005; 27 Tore); zwei Länderspiele (2000, 2004).
ASAL, Abk. für Australian Soccer Association Limited, den Fußballverband von → Australien.
Asamoah, 1) Gerald („Asa“), dt. Angriffsspieler ghanaischer Herkunft (seit 2000 dt. Staatsbürgerschaft), * 3. Oktober 1978 Mampong (Ghana); 1991–94 Werder Hannover, 1994–99 Hannover 96, 1999–2010 FC Schalke 04, 2010/11 FC St. Pauli; 306 Bundesligaspiele (1999–2011; 50 Tore); 43 Länderspiele für Deutschland (2001–06; sechs Tore); WM-Endrunde 2002, 2006. S. a. Fußball [Migration in Deutschland].– 2) Kwadwo, ghanaischer Mittelfeldspieler, * 9. Dezember 1988 Accra, 2006–08 Liberty Professionals (Dansoman [Ghana]), 2008 AC Bellinzona und FC Turin, 2008–11 Udinese Calcio; 22 Länderspiele (seit 2008; ein Tor); WM-Endrunde 2010.
| G. Asamoah „ Da krieg’ ich so den Ball, und das ist ja immer mein Problem.“ |
Asante Kotoko, Ghana: → Kumasi.
Aschaffenburg, Dtl. (Stadt in Unterfranken); Viktoria Aschaffenburg, eigtl. „SV Viktoria Aschaffenburg“ (Sportverein Viktoria Aschaffenburg), gegr. am 6. August 1901 als Aschaffenburger FC 1901, 1904 Fusion mit FC Viktoria Aschaffenburg zu FC Viktoria 1901 Aschaffenburg, 1906–37 SV Viktoria Aschaffenburg, 1937 Fusion mit Reichsbahn TuSpo Aschaffenburg zu Reichsbahn-Viktoria Aschaffenburg, 1939 Beendigung der Fusion und Umbenennung in SV Viktoria Aschaffenburg; Spielkleidung: Blau/Weiß/Weiß; Stadion: Am Schönbusch, 15 000 Plätze. – INTERNET: www.viktoria-aschaffenburg.de
Spieler (Auswahl): P. Barnes – R. Bommer – M. Brüdigam – H. Budion – H. Buller – H. Bundschuh – S. Fries – W. Giller – O. Groh – K. Hauner – V. Herr – W. Hitzel – C. Hock – R. Hoffmann – E. Horst – I. Iličević – I. Krešić – E. Lehner – F. Magath – A. Mirsberger – T. Oral – C. Reitmaier – Marcel und Markus Schäfer – O. Schmitt – W. Schnabel – J. Seitz – Trainer (Auswahl): R. Bommer – R. Borchers – L. Buchmann – H. Heese – L. Janda – W. Lorant – A. Möller – F. Rebell – M. Roth – N. Salov – W. Solz – H.-D. Zahnleiter.
| Viktoria Aschaffenburg: Erfolge (Auswahl) Hessenmeister 1985, 1988, 1992, Hessenpokal 1991 |
Aschtarak, Armenien: andere Schreibweise für → Ashtarak.
Ascoli Piceno, Italien (Stadt in der Region Marken); Ascoli Calcio, gegr. 1898; Spielkleidung: Schwarz-Weiß/Schwarz/Schwarz; Stadion: Cino e Lillo del Duca, 20 000 Plätze. – INTERNET: www.ascolicalcio.net
Spieler (Auswahl): A. Altobelli – P. Anastasi – L. Ariatti – A. Barzagli – O. Bierhoff – S. Bjelanović – V. Boudianski – L. Brady – I. Budan – W. Casagrande Junior – C. Cejas – S. Colantuono – N. Córdova – M. Delvecchio – G. Dirceu – B. Giordano – G. Iachini – Z. Muslimovič – G. Pagliuca – G. Pillon – F. Quagliarella – E. Skela. – Trainer (Auswahl): V. Boškov – F. Colomba – G. De Sisti – L. Dominissini – M. Giampaolo – M. Siva – N. Sonetti – A. Tesser.
| Ascoli Calcio: Erfolge (Auswahl) Mitropapokal 1987 |
ASEAN [Abk. für Association of Southeast Asian Nations], Organisation südostasiat. Staaten; Sitz: Jakarta. Verband ist die ASEAN Football Federation (→ AFF [3]).
ASEAN Football Championship, bis 2004 Tiger-Cup, Wettbewerb der Nationalmannschaften von Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Er wird organisiert von der ASEAN Football Federation (→ AFF [3]) und wurde von 1996 bis 2004 alle zwei Jahre, seit 2007 z. T. auch jährlich ausgetragen.
| ASEAN Football Championship: Sieger 1996 Thailand 1998 Singapur 2000 Thailand 2002 Thailand 2004 Singapur 2007 Singapur 2008 Vietnam 2010 Malaysia |
Asensi, Juan, eigtl. „Juan Manuel Asensi Ripoll“, span. Mittelfeldspieler, * 23. September 1949 Alicante; 1966–70 Elche CF, 1970–80 FC Barcelona, 1981/82 FC Puebla; 41 Länderspiele (1968–80; sieben Tore); WM-Endrunde 1978; EM-Endrunde 1980; olymp. Fußballturnier 1968.
Aserbaidschan, Republik in SW-Asien, 86 600 km², 8,239 Mio. Ew.; Verband: Association of Football Federations of Azerbaijan, Abk. AFFA, gegr. 1992, Sitz: Baku; Mitglied der FIFA und der UEFA seit 1994; Spielkleidung: Weiß/Blau/Weiß. – Höchste Spielklasse: Azerbaijan Premier League (zwölf Vereine). – INTERNET: www.affa.az
| Aserbaidschan Seit dem 30. August 1991 unabhängig – zuvor Bestandteil (als „Aserbaidschanische SSR“) der UdSSR –, bestritt Aserbaidschan am 17. September 1992 sein erstes Länderspiel (3:6 gegen Georgien). |
Ashanti Gold SC, Ghana: → Obuasi.
Ashtarak (auch Aschtarak), Armenien (Stadt in der Region Aragazotn); MIKA Ashtarak, eigtl. „FC MIKA Ashtarak“ (Football Club MIKA Ashtarak), gegr. 1985 als FC Kasach Ashtarak, seit 1999 FC MIKA Ashtarak; Spielkleidung: Schwarz-Weiß/Schwarz/Schwarz; Stadion: MIKA-Stadion (Jerewan [13 km entfernt]), 7 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): A. Adamyan – F. Dauda – T. Davtyan – S. Gorlukovich – F. Hakobyan – H. Mikaelyan – A. Petikyan. – Trainer (Auswahl): A. Adamyan – S. Barsegyan.
| MIKA Ashtarak: Erfolge (Auswahl) Landespokal 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011 |
Asian Super Cup, von 1995 bis 2002 zw. den Siegern des → Asienpokals der Landesmeister und des → Asienpokals der Pokalsieger ausgetragener Wettbewerb. Ab 2002/03 wurden beide Wettbewerbe zur → AFC Champions League zusammengeschlossen, sodass der Asian Super Cup hinfällig wurde.
| Asian Super Cup: Sieger | |
| 1995 | Yokohama Flügels (Japan) |
| 1996 | Seongnam Ilhwa Chunma (Südkorea) |
| 1997 | Al-Hilal (Saudi-Arabien) |
| 1998 | Al-Nasr (Saudi-Arabien) |
| 1999 | Al-Ittihad (Saudi-Arabien) |
| 2000 | Al-Hilal (Saudi-Arabien) |
| 2001 | Suwon Bluewings (Südkorea) |
| 2002 | Suwon Bluewings (Südkorea) |
Asiatische Spiele, svw. → Asienspiele.
Asien-Challenge-Cup, svw. → AFC Challenge Cup.
Asienmeisterschaft, zwei Jahre nach der 1954 erfolgten Gründung der Asian Football Confederation (→ AFC [1]) aus der Taufe gehobene, für alle asiat. Landesverbände offene Meisterschaft. Nach Qualifikationsspielen in Zonengruppen gibt es die Finalrunde der Gruppensieger. Die Asienmeisterschaft wird seit 1956 im Vierjahresrhythmus durchgeführt, bis 2004 jeweils im Jahr der Olymp. Sommerspiele und der EM-Endrunde. Um künftig eine Konzentration im Sportkalender zu vermeiden, beschloss die AFC, das Turnier von 2008 auf 2007 vorzuverlegen. Dieses Turnier der 14. Asienmeisterschaft fand in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wurde die Meisterschaft in mehreren Ländern ausgetragen. Der offizielle Name der Veranstaltung lautet AFC Asian Cup. – Frauenfußball: Das Turnier zur Ermittlung des Asienmeisters findet seit 1975 alle zwei bis drei Jahre statt. Seit 2006 trägt der Wettbewerb den Namen AFC Women’s Asian Cup.
| Asienmeisterschaft: Sieger | ||
| Jahr | Männer | Frauen |
| 1956 | Südkorea | – |
| 1960 | Südkorea | – |
| 1964 | Israel | – |
| 1968 | Iran | – |
| 1972 | Iran | – |
| 1975 | – | Neuseeland |
| 1976 | Iran | – |
| 1977 | – | Taiwan |
| 1979 | – | Taiwan |
| 1980 | Kuwait | – |
| 1981 | – | Taiwan |
| 1983 | – | Thailand |
| 1984 | Saudi-Arabien | – |
| 1986 | – | China |
| 1988 | Saudi-Arabien | – |
| 1989 | – | China |
| 1991 | – | China |
| 1992 | Japan | – |
| 1993 | – | China |
| 1995 | – | China |
| 1996 | Saudi-Arabien | – |
| 1997 | – | China |
| 1999 | – | China |
| 2000 | Japan | – |
| 2001 | – | Nordkorea |
| 2003 | – | Nordkorea |
| 2004 | Japan | – |
| 2006 | – | China |
| 2007 | Irak | – |
| 2008 | – | Nordkorea |
| 2010 | – | Australien |
| 2011 | Japan | – |
Asienpokal der Landesmeister, von 1967 bis 2002 ausgetragener Wettbewerb, offen für alle Landesmeister der Asian Football Confederation (→ AFC [1]); 1969 nicht ausgetragen, ebenso von 1973 bis 1985 (wegen polit. und finanzieller Probleme). Bis 1989/90 wurden Vorrunden in den Zonengruppen O-Asien und W-Asien gepielt, darunter gab es weitere Regionalgruppen. Seit 1990/91 folgten nach zwei einleitenden Runden, in denen nach dem → K.-o.-System mit Hin- und Auswärtsspielen die Vereine der jeweiligen Regionen aufeinander trafen, die Turniere der acht Besten. Diese wurden in zwei Gruppen (O- und W-Asien) mit je vier Mannschaften gebildet. Die Sieger erreichten das Halbfinale, das wie das Finale auf „neutralem Platz“ ausgetragen wurde. Von 1995 bis 2002 spielte der Gewinner gegen den Sieger des → Asienpokals der Pokalsieger um den → Asian Supercup. Seit 2003 gibt es die → AFC Champions League.
| Asienpokal der Landesmeister: Sieger 1967 Hapoel Tel Aviv (Israel) 1968 Maccabi Tel Aviv (Israel) 1970 Taj Club Teheran (Iran) 1971 Maccabi Tel Aviv (Tsrael) 1986 Daewoo Royals (Südkorea) 1987 Furukawa Electric Company (Japan) 1988 Yomiuri Kawasaki (Japan) 1989 Al-Sadd SC (Katar) 1990 Liaoning Shenyang (China) 1991 Esteghlal Teheran (Iran) 1992 Al-Hilal (Saudi-Arabien) 1993 Pas Teheran (Iran) 1994 Thai Farmers Bank (Thailand) 1995 Thai Farmers Bank (Thailand) 1996 Seongnam Ilhwa Chunma (Südkorea) 1997 Pohang Steelers (Südkorea) 1998 Pohang Steelers (Südkorea) 1999 Júbilo Iwata (Japan) 2000 Al-Hilal (Saudi-Arabien) 2001 Suwon Bluewings (Südkorea) 2002 Suwon Bluewings (Südkorea) |
Asienpokal der Pokalsieger, von 1991 bis 2002 ausgetragener Wettbewerb, offen für alle Pokalsieger der Asian Football Confederation (→ AFC [1]) und ausgetragen im → K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel. Bis 1994 wurden zwei Finals (Hin- und Rückspiel) ausgetragen, 1995–2002 nur noch ein Spiel (z. T. auf → „neutralem Platz“). Der Wettbewerb wurde wie der frühere → Asienpokal der Landesmeister seit 2002/03 durch die → AFC Champions League ersetzt.
| Asienpokal der Pokalsieger: Sieger 1991 Persepolis Teheran (Iran) 1992 Nissan FC (Japan) 1993 Yokohama Flügels (Japan) 1994 Al-Qadisiya (Saudi-Arabien) 1995 Yokohama Flügels (Japan) 1996 Bellmare Hiratsuka (Japan) 1997 Al-Hilal (Saudi-Arabien) 1998 Al-Nasr (Saudi-Arabien) 1999 Al-Itttihad (Saudi-Arabien) 2000 Shimizu S-Pulse (Japan) 2001 Al-Shabab (Saudi-Arabien) 2002 Al-Hilal (Saudi-Arabien) |
Asiens Fußballer des Jahres, von der Asian Football Confederation (→ AFC [1]) seit 1993 (bis dahin inoffiziell) jährlich durchgeführte Wahl, die von 1988 bis 1991 von der IFFHS initiiert wurde (1992 ausgefallen).
| Asiens Fußballer des Jahres* 1988 A. Radhi (Irak) 1989 J.-S. Kim (Südkorea) 1990 J.-S. Kim (Südkorea) 1991 J.-S. Kim (Südkorea) 1992 nicht vergeben 1993 K. Miura (Japan) 1994 S. Al-Owairan (Saudi-Arabien) 1995 M. Ihara (Japan) 1996 K. Azizi (Iran) 1997 H. Nakata (Japan) 1998 H. Nakata (Japan) 1999 A. Daei (Iran) 2000 N. Al-Temyat (Saudi-Arabien) 2001 Z. Fan (China) 2002 S. Ono (Japan) 2003 M. Mahdavikia (Iran) 2004 A. Karimi (Iran) 2005 H. Al-Montashari (Saudi-Arabien) 2006 K. Ibrahim (Katar) 2007 Y. Al-Qahtani (Saudi-Arabien) 2008 S. Jeparov (Usbekistan) 2009 Y. Endō (Japan) 2010 S. Ognenovski (Australien) * Bis 1993 inoffiziell |
Asienspiele, Wettkämpfe (u. a. im Fußball) zw. den Olymp. Sommerspielen, offen für Amateure nach dem IOK-Reglement. beim ersten Fußballturnier bei den Asienspielen 1951 nahmen sechs, beim 15. Turnier 2006 zwölf Länder teil.
| Asienspiele: Sieger der Fußballturniere 1951 Indien 1954 Taiwan 1958 Taiwan 1962 Indien 1966 Birma 1970 Birma und Südkorea 1974 Iran 1978 Nordkorea und Südkorea 1982 Irak 1986 Südkorea 1990 Iran 1994 Usbekistan 1998 Iran 2002 Iran 2006 Katar |
Asker SK, Norwegen: Bærum [1].
ASN Pfeil Phönix, Dtl.: → Nürnberg [1].
Aspach, Dtl. (Gemeinde in Württemberg); SG Sonnenhof Großaspach (Sportgemeinschaft Sonnenhof Großaspach), entstand am 25. August 1994 in Großaspach (seit 1972 zu Aspach) durch Fusion der Fußballabteilungen von Spvgg Großaspach und FC Sonnenhof Großaspach; Spielkleidung: Rot; Spielot: Fautenhau; Stadion: Comtech-Arena, 10 000 Plätze. – INTERNET: www.sg-sonnenhof-grossaspach.de
Spieler (Auswahl): F. Aupperle – M. Cimander – M. Gentner – A. Krasniqi – K. Kraus – A. Kuchma – R. Rehm – P. Röcker – N. Spina. – Trainer (Auswahl): H.-J. Boysen – J. Hartmann – J. Kiefer – T. Letsch – A. Malchow – R. Rehm – A. Zorniger.
| SG Sonnenhof Großaspach: Erfolge (Auswahl) Baden-Württemberg-Meister 2009 Württembergischer Meister 2005 Württembergischer Pokal 2009 |
Asparuchov, Georgi („Gundi“), bulgar. Angriffsspieler (Mittelstürmer), * 4. Mai 1943 Sofia, † 30. Juni 1971 (Verkehrsunfall); 1960/61 Levski Sofia, 1961–63 Botev Plovdiv, 1964–71 Levski Sofia; 50 Länderspiele (seit 1962; 19 Tore); WM-Endrunde 1962, 1966, 1970; in Bulgarien Sportler des Jahres 1965 und Fußballer des (20.) Jahrhunderts.
.
| G. Asparuchov Ihm zu Ehren wurde 1972 das „Wassil-Lewski-Stadion“ des Vereins Levski Sofia in „Georgi-Asparuchov-Stadion“ umbenannt. |
Asprilla, Faustino, eigtl. “Faustino Hernán Asprilla Hinestroza”, kolumbian. Angriffsspieler, * 10. November 1969 Tuluá; bis 1989 Cucuta Deportivo (Kolumbien), 1990–92 Atlético Nacional (Medellin), 1992–95 AC Parma, 1996–98 Newcastle United, 1998/99 AC Parma, 1999 SE Palmeiras (São Paulo), 2000 Fluminense FC (Rio de Janeiro) und SE Palmeiras, 2000/01 Fluminense FC, 2002/03 Universidad de Chile (Santiage de Chile), 2004 Estudiantes de la Plata; 57 Länderspiele (1993–2001; 20 Tore); WM-Endrunde 1994, 1998.
Assauer, Rudolf („Rudi“), dt. Funktionär, * 30. April 1944 Sulzbach-Altenwald (Saarland); war Abwehrspieler: 1952–63 SpVgg Herten (NRW), 1964–70 Borussia Dortmund, 1970–76 Werder Bremen; 307 Bundesligaspiele (1964–76; 13 Tore). – Später Manager: 1976–81 Werder Bremen, 1981–86 FC Schalke 04, 1990–93 VfB Oldenburg, 1993–2006 FC Schalke 04.
| R. Assauer „Es gibt so viele Trainer, die kommen und gehen. Irgendwann vergisst du mal die Vornamen.“ |
Assenmacher, Karl-Josef, dt. Schiedsrichter, * 30. Mai 1947; DFB-Schiedsrichter seit 1970; FIFA-Referee 1983–93; Zweite Bundesliga 1976–94 (99 Spiele); Bundesliga 1978–94 (153 Spiele); zwölf Länderspiele; 18 EC-Spiele (u. a. EC-II-Finale 1993).
Assistent, 1) Assistenztrainer, Trainerassistent, zweiter Trainer einer Mannschaft, der dem verantwortl. (Chef-)Trainer bei dessen Arbeit assistiert; z. T. auch ein noch relativ junger und unerfahrener Trainer, der sich an der Seite eines „gestandenen” Trainers profilieren soll. In der Praxis kommt es aber häufig vor, dass der Assistent z. B. bei permanenter Erfolglosigkeit einer Mannschaft kurzfristig („von heute auf morgen”) die alleinige Trainerverantwortung übertragen bekommt (sei es als → Interimstrainer oder für „dauernd”), während der bisherige Trainer „gefeuert” wird. – DFL: Die Assistenten der 36 Profivereine müssen seit Juli 2011 die Stufe 4 (Fußball-Lehrer-Ausbildung und DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz [UEFA-PRO-Lizenz]) nachweisen. – 2) svw. → Schiedsrichterassistent.
| Assistent [1] Assistant Coach [engl.] Adjoint de l’entraîneur [frz.] Entrenador auxiliar [span.] Treinador assistente [port.] Allenatore ausiliare [ital.] |
Assmy, Horst („Hadscha“), dt. Angriffsspieler (Rechtsaußen), * 29. November 1933 Berlin, † 14. Januar 1972 Kassel; bis 1953 VfB bzw. Einheit Pankow, 1953/54 Motor Oberschöneweide, 1954–59 Vorwärts Berlin, 1959–61 Tennis Borussia (1959/60 gesperrt), 1961/62 FC Schalke 04, 1962–65 Hessen Kassel; 91 (DDR-)Oberligaspiele (1954–59; 22 Tore); zwölf Länderspiele für die DDR (1954–59; vier Tore).
Assyriska FF, Schweden: → Södertälje.
Astafjevs, Vitalijs, lett. Mittelfeldspieler, * 3. April 1971 Riga; 1992–96 Skonto Riga, 1996/97 Austria Wien, 1997–2000 Skonto Riga, 2000–03 Bristol Rovers, 2003/04 Admira Wacker Mödling, 2004/05 Rubin Kasan, 2006–08 Skonto Riga, 2009 Olimps Riga, 2009/10 FK Ventspils, 2010/11 Skonto Riga; 167 Länderspiele (1992–2010; 16 Tore); EM-Endrunde 2004; in Lettland Fußballer des Jahres 1995, 1996, 2007.
Astana (1961–92 Zelinograd, 1992–97 Akmola bzw. Aqmola), Hauptstadt von Kasachstan; 1) FK Astana-64 (Futbolnyi Klub Astana 1964), gegr. 1964 als Dinamo Zelinograd, 1975–94 Tselinnik Zelinograd bzw. Tselinnik Akmola, 1994–96 Tsesna Akmola, 1996/97 Tselinnik Akmola, 1998 FK Astana, 1999–2006 FC Zhenis Astana, 2006–09 FK Astana, 2009 FK Nays Astana, seit 2010 FK Astana-64; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Schwarz; Stadion: Kazhimukan Munaitpasov, 13 500 Plätze. – INTERNET: www.fcastana.kz
Spieler (Auswahl): E. Azovskiy – V. Beschastnykh – D. Bogavac – A. Chichulin – D. Kamelov – A. Kuchma – A. Kumisbekov – S. Larin – D. Lorija – A. Mokin – S. Ostapenko – Ratinho – D. Rodionov – S. Smakov – M. Zhalmagambetov. – Trainer (Auswahl): A. Irkhin – V. Ledovskih – A. Samarow – K.-G. Stärk.
| FK Astana-64: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 2000, 2001*, 2006 Landespokal 2001, 2002, 2005 * Mit Kairat Almaty |
2) Lokomotive Astana, eigtl. „FC Lokomotiv Astana (Football Club Lokomotiv Astana), entstand 2009 durch Fusion von FK Almaty (→ Almaty [1]) und MegaSport Almaty sowie dem nachfolgenden Umzug nach Astana; Spielkleidung: Weiß/Blau/Blau; Stadion: Astana-Arena (Kunstrasen), 30 000 Plätze. – INTERNET: www.fc-lokomotiv.kz
Spieler (Auswahl): K. Ashirbekov – M. Baiyzhanov – B. Gyan – A. Karpovich – Z. Kukeev – P. Ovie – M. Samchenko – M. Shatskikh – M. Suyumagambetov – A. Tikhonov – E. Titov. – Trainer (Auswahl): H. Fach – S. Juran.
| Lokomotive Astana: Erfolge (Auswahl) Landespokal 2010 |
Aston, Ken, engl. Schiedsrichter, * 1. September 1915 Colchester, † 23. Oktober 2001 Ilford; führte 1947 in England die signalgelben Fahnen für Linienrichter ein; leitete als Referee bei der WM-Endrunde 1962 das „Skandalspiel“ Chile gegen gegen Italien, danach international suspendiert; nat. „letzter Pfiff“ 1964. Er „erfand“ 1966 als FIFA-Funktionär (Schiedsrichterkommission) die Gelbe Karte und die Rote Karte (beide seit der WM-Endrunde 1970 verbindlich).
| K. Aston Beim Vorrundenspiel Chile gegen Italien (2:0) stellte Aston zwei Italiener vom Platz, doch die nicht minder wild um sich tretenden Chilenen blieben unbehelligt. Dreimal kam das Militär auf den Platz, um Spieler zu trennen und den Unparteiischen, dessen Trikot in Mitleidenschaft geraten war, zu beschützen. |
Aston Villa, England: → Birmingham [1].
Asturien, Spanien: nordwestl. Küstengebirgsregion; Hauptort: Oviedo.
| Asturien: Vereine (Auswahl) Sporting Gijón Real Oviedo |
Asunción, Hauptstadt von Paraguay; 1) Club Cerro Porteño, gegr. am 12. Oktober 1912; Spielkleidung: Rot-Blau/Rot/Blau-Rot; Spielort: Barrio Obrero; Stadion: Estadio General Pablo Rojas („La Olla“), 25 000 Plätze. – INTERNET: www.clubcerro.com
Spieler (Auswahl): E. Barreto – C. Bella – J. dos Santos – C. Gamarra – Geremi – D. Godin – S. Goycoechea – R. Máspoli – F. Mondragón – C. Ré. – Trainer (Auswahl): O. Ardiles – G. Costas – G. Martino – F. Puskás – N. Rossi – J. L. Torrente – P. Troglio.
2) Club Libertad, gegr. am 30. Juli 1905; Spielkleidung: Weiß-Schwarz/Weiß/Weiß; Spielort: Tuyucua; Stadion: Estadio Dr. Nicolás Léoz (“La Huerta”), 10 000 Plätze. – INTERNET: www.clublibertad.com.py
Spieler (Auswahl): F. Álvez – D. Benitez Cáceres – S. Cabañas – N. Cuevas – T. Espinola – S. Fleitas – R. Lopez – E. Morel – M. und P. Rolón – A. Salinas – J. Samudio – J. Villar. – Trainer (Auswahl): S. Markarián – G. Martino – G. Pérez.
3) Olimpia Asunción, eigtl. “Club Olimpia“, gegr. am 25. Juli 1902; Spielkleidung: Weiß; Spielort: Mariscal Lopez; Stadion: Estadio Manuel Ferreira (“El Bosque de Para Uno“), 22 000 Plätze. – INTERNET: www.clubolimpia.com.py
Spieler (Auswahl): R. Acuña – J. Aguero – F. Aguirre – R. Amarilla – C. Ayala – A. Benitez – C. Bonet – D. Caniz – J. Cardozo – N. Cuevas – R. Delgado – A. Gonzáles – S. Goycoechea – J. Nuñes – C. Paredes – Romerito – C. Ruiz – R. Santa Cruz. – Trainer (Auswahl): L. Cubilla – Falcão – S. Markarián – O. Paulin – N. Pumpido – A. Solalinde.
| Olimpia Asunción: Internationale Erfolge (Auswahl) Copa Libertadores de América 1979, 1990, 2002 Weltpokal 1979 Recopa Sudamericana 2003 |
ATB, Abk. für → Arbeiter-Turner-Bund.
Athen, Hauptstadt von Griechenland; 1) AEK Athen (Athlitiki Enosi Konstantinoupolis Athen), gegr. am 1. Januar 1924; Spielkleidung: Schwarz-Gelb/Schwarz-Gelb/Gelb; Spielort: Maroussi; Stadion: Olympiastadion, 66 132 Plätze. – INTERNET: www.aekfc.gr
Spieler (Auswahl): A. Alexandris – K. Andritsos – C. Ardizoglou – D. Bajević – A. Basinas – I. Blanco – C. Bonev – Bruno Alves – D. Chiotis – T. Christidis – T. Dellas – V. Dimitriadis – R. Djebbour – D. Domasov – C. Gamarra – N. Georgeas – L. Kampantais – M. Kapsis – K. Katsouranis – T. Ketsbaia – S. Kyrgiakos – K. Lefter – N. Liberopoulos –J. Macho – T. Mavros – K. und M. Mpaltasis – K. Nestoridis – H. Nielsen – D. Nikolaidis – Y. Okkas – M. Okoński – D. Papaioannou – C. Pappas – J. Pliatsikas – Rivaldo – D. Saravakos – Sokratis – N. V. Tsiartas. – Trainer (Auswahl): D. Bajević – O. Blokhin – Ž. Čajkovski – J. Csaknády – G. Donis – I. Dumitrescu – F. Fadrhonc – A. Fafie – J. Gmoch – K. Górski – V. Halama – M. Jiménez – N. Kostenoglou – B. Nestoridis – F. Puskás – F. Santos – H. Senekowitsch – L. Serra Ferrer – K. Stamatiadis – H. Stessl – T. Zagorakis.
| AEK Athen: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994 Landespokal 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011 |
2) Panathinaikos Athen, eigtl. „Panathinaikos AO“ (Panathinaikos Athlitikos Omilos), gegr. 1908 als PPO Athen, 1910–24 POA Athen, seitdem Panathinaikos AO; Spielkleidung: Grün/Weiß/Weiß; Spielort: Maroussi; Stadion: Olympiastadion, 66 132 Plätze. – INTERNET: www.panathinaikos1908.gr
Spieler (Auswahl): A. Antoniadis – K. Antoniou – E. Apostolakis – A. Asanović – A. Basinas – I. Biscan – D. Boateng – J. Borelli – J. César – G. Charalampidis – D. Cissé – F. Conceição – J. Dentas – C. Dimopoulos – D. Domazos – J. Epalle – P. Fernandes – M. Galakos – M. Galinović – T. Gekas – G. Georgiadis – Gilberto Silva – E. González – I. Goumas – S. Govou – R. Henriksen – R. Houseman – A. Ivanschitz – R. Jarni – A. Kapsis – G. Karagounis – N. Karoulias – K. Katsouranis – J. Kolkka – K. Konstantinidis – M. Konstantinou – J. Kyrastas – S. Kyrgiakos – T. La Ling – N. Liberopoulos – S. Livanthinos – Luis Garcia – E. Mantzios – Manucho – A. Messaris – N. Morris – M. Münch – E. Mykland – C. Nielsen – A. Nikopolidis – M. Nilsson – S. Ninis – N. Nioplias – E. Olisadebe – G. Pantziaras – D. Papadopoulos – M. Papaioannou – G. Papavasilou – M. Paulo Sousa – K. Pflipsen – H. Postiga – M. Pröll – J. Rocha – S. Romero – D. Salpingidis – D. Saravakos – N. Sarganis – G. Seitaridis – A. Seric – H. Sigurdsson – D. Simeonidis – N. Spiropoulos – K. Tarassis – C. Terzanidis – S. Torghelle – A. Tziolis – A. Tzorvas – J. R. Verón – Victor – G. Vlaović – L. Vyntra – K. Warzycha – H.-D. Zahnleiter – V. Zajec. – Trainer (Auswahl): A. Anastasiadis – H. Backe – S. Bobek – C. Bonev – J. Ferreira – J. Gmoch – K. Górski – B. Guttmann – T. Ivić – G. Kirastas – S. Kovács – A. Malesani – S. Markarián – A. Moreira – V. Muñoz – N. Nioplias – I. Osim – P. Packert – J. Peseiro – L. Petropoulos – F. Puskás – F. Santos – H. Senekowitsch – I. Shum – H. ten Cate – J. Velic – V. Zajec.
| Panathinaikos Athen: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 Landespokal 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010 Balkanpokal 1977 |
3) Panionios Athen, eigtl. „Panionios PAE“ (Panionos Podosfeiriki Athlitikos Enosis), gegr. am 1. Januar 1890 im Stadtteil Nea Smyrni als Orfea Smyrna, 1895–22 Panionos GS Smyrna, 1922–96 Panionios Athen, seitdem Panionios PAE; Spielkleidung: Blau/Rot/Rot; Stadion: Nea Smyrni, 11 500 Plätze. – INTERNET: www.panionios.gr
Spieler (Auswahl): N. Anastopoulos – B. Balaban – T. Barzow – S. Berhé – S. Chaitas – N. Chatzopoulos – T. Christiansen – T. Cichon – G. und N. Dedes – J. Drobný – J. Gáspár – F. Goundoulakis – J. Hyka – A. Intzoglou – N. Kakaris – L. Kampantais – O. Kondé – M. König – N. Krupniković – B. Kumordzi – L. Lima – J. Macho – I. Majstorović – E. Mantzios – D. Mavrikis – T. Mavros – D. Nalitzis – K. Nestoridis – M. Pletsch – Á. Recoba – D. und T. Saravagos – E. Šiljak – N. Spyropoulos – F. Strakosha – V. Svěrkoš – L. Tskitishvili – A. Tziolis – D. Zezelj. – Trainer (Auswahl): A. Alefantos – U. Brams – J. Bubenko – J. Gmoch – E. Lienen – I. Netto – H. Senekowitsch – J. Stamatopoulos – N. Stamos – G. Vazakas.
| Panionios Athen: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1979, 1998 |
Äthiopien, Staat in O-Afrika, 1,127 Mio. km², 78,254 Mio. Ew.; Verband: Ethiopian Football Federation, Abk. EFF, gegr. 1943, Sitz: Addis Abeba; Mitglied der FIFA seit 1952, der CAF seit 1957; Spielkleidung: Grün/Gelb/Rot. – Höchste Spielklasse: Ethiopian Premier League (16 Vereine).
| Äthiopien: Erfolge (Auswahl) Afrikameister 1962 |
Atkinson, Ron (“Big Ron”), eigtl. “Ronald Franklin Atkinson”, engl. Trainer, * 18. März 1938 Liverpool; war Mittelfeldspieler: bis 1959 Aston Villa, 1959–71 Oxford United (England). – Später Trainer: 1971–74 Kettering Town (England), 1974–78 Cambridge United (England), 1978–81 West Bromwich Albion, 1981–86 Manchester United (Landespokal 1983, 1985), 1987/88 West Bromwich Albion, 1988/89 Atlético Madrid, 1989–91 Sheffield Wednesday, 1991–94 Aston Villa, 1995/96 Coventry City, 1997/98 Sheffield Wednesday, 1999 Nottingham Forest, 2006 Peterborough United (England).
Atladóttir, Sif, Island: → Eðvaldsson, A.
Atlanta, USA (Hauptstadt des Staates Georgia); Atlanta Beat, Frauen- und Mädchenfußball; gegr. 2001; Spielkleidung: Rot/Schwarz/Rot; Spielort: Kennesaw (südl. von Atlanta); Stadion: KSU Soccer Stadium, 8 300 Plätze.
Spielerinnen (Auswahl): R. Bachmann – K. Butler – M. Dominguez – C. Lloyd – H. Mitts – A. Miyama – K. Parker – C. Pohlers – K. Reynolds – H. Sawa – B. Scurry – H. Solo – Sun Wen – S. Thomson – C. Whitehill. – Trainer (Auswahl): J. Galanis – R. Strout.
Atlante, CF, Mexiko: → Cancún.
Atletico Español, Mexiko: → Necaxa.
Atlético Mineiro, Brasilien: → Belo Horizonte [1].
Atlético Nacional, Kolumbien: → Medellin [1].
„Ato, Nik und Kaz“ [drei computeranimierte Figuren], offizielle → WM-Maskottchen der WM-Endrunde 2002 in Japan/Südkorea.
Atouba, Thimothée, eigtl. „Thimothée Atouba Essama“, kamerun. Abwehrspieler (Linksverteidiger), * 17. Februar 1982 Yaoundé; Cousin von J. → Epalle; bis 1999 Mineduc Yaoundé, 2000 Union Douala, 2000/01 Neuchâtel Xamax, 2002–04 FC Basel, 2004/05 Tottenham Hotspur, 2005–09 Hamburger SV, 2009–11 Ajax Amsterdam; 83 Bundesligaspiele (2005–09; ein Tor); 49 Länderspiele (seit 2003).
ATSB, Abk. für Arbeiter-Turn-und-Sport-Bund (→ Arbeiter-Turner-Bund).
Åtvidaberg, Schweden (Stadt in der Provinz Östergötlands); Åtvidabergs FF (Åtvidabergs Fotboll Förening), gegr. am 1. Juli 1907; Spielkleidung: Blau/Weiß/Rot; Stadion: Kopparvallen, 7 200 Plätze. – INTERNET: www.atvidabergsff.se
Spieler (Auswahl): R. Almqvist – L. Andersson – J. Augustsson – K. Bergström – R. Edström – O. Eklund – B. Gustavsson – M. Haglund – K. Karlsson – A. Ljungberg – B. und R. Magnusson – A. Nyang – J. Olssen – T. Ravelli – R. Sandberg – J. Sundberg – C. Torstensson – T. Wernersson. – Trainer (Auswahl): B. Axberg – T. Carlson – S. Creutz – K. Karlsson – S. Larsson.
| Åtvidabergs FF: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1972, 1973 Landespokal 1970, 1971 |
Atyrau, Kasachstan (Hafenstadt und Hauptort des gleichnamigen Gebiets); FK Atyrau (Futbolnyi Klub Atyrau), gegr. 1978 als Prikaspijez Gurjew, seit 2000 FK Atyrau; Spielkleidung: Grün; Stadion: Munayshy Stadium, 9 000 Plätze. – INTERNET: www.fcatyrau.kz
Spieler (Auswahl): S. Chischnitschenko – G. Cmogorac – M. Croitoru – V. Frunză – T. Gharabaghzjan – A. Grigorenko –S. Khizhnichenko – G. Peikrischwili – K. Pyradkin – D. Rodionow – S. Schabanow – E. Sergienko – R. Usdenow. – Trainer (Auswahl): R. Mammadov – V. Pasulko.
| FK Atyrau: Erfolge (Auswahl) Landespokal 2009 |
Auckland City, Neuseeland (Hauptort der Nordinsel); 1) Auckland City FC (Auckland City Football Club), gegr. 2004; Spielkleidung: Marineblau/Marineblau/Weiß; Spielort: Sandringham; Stadion: Kiwitea Street, 3 000 Plätze. – INTERNET: www.aucklandcityfc.com
Spieler (Auswahl): C. Bunce – K. Jordan – D. Koprivcic – G. Little – R. Nicholson – B. Sigmund – J. Spoonley – N. Sykes – I. Vicelich – G. Young. – Trainer (Auswahl): A. Jones – C. Tuaa.
| Auckland City FC: Internationale Erfolge (Auswahl) OFC Champions Cup 2006, 2009 |
2) New Zealand Knights FC (New Zealand Knights Football Club), gegr. 1999 als Auckland Kingz FC, seit 2004 New Zealand Knights FC, aufgelöst im Januar 2007; Spielkleidung: Schwarz; Spielort: North Shore ( Region Auckland); Stadion: North Harbour Stadium, 25 000 Plätze. – Der Verein nahm von 2005 bis 2007 am Punktspielbetrieb der austral. A-League teil.
Spieler (Auswahl): J. Brockie – R. Bull – Z. Caravella – J. Christie – B. Collett – D. Hay – N. Imaya – G. Moss – W. Rufer – C. Tinkler. – Trainer (Auswahl): R. Herbert – P. Nevin – W. Rufer – I. Vicelich.
„Audi-Cup“, von der Audi AG erstmals 2009 veranstaltetes zweitägiges (Vorbereitungs-)Turnier (wenige Wochen vor Saisonstart) mit drei internat. Spitzenteams und Bayern München als Gastgeber, wird durchgführt in Jahren ohne WM- bzw. EM-Endrunde. Am ersten Tag werden zwei (Halbfinal-)Spiele ausgetragen. Die Sieger spielen am zweiten Tag um den Titel, die Verlierer um Platz drei, wobei es an beiden Tagen keine Verlängerung gibt (Entscheidung durch Strafstoßschießen). Im Unterschied zum → „Liga-total-Cup“ gibt es keine verkürzte Spieldauer. – INTERNET: www.audi.de
| „Audi-Cup“: Sieger | |
| 2009 2011 | Bayern München FC Barcelona |
Aue, Dtl. (Stadt in Sachsen); Erzgebirge Aue, eigtl. „FC Erzgebirge Aue“ (Fußballclub Erzgebirge Aue), gegr. am 4. März 1945 als SG Aue, 1946–49 Pneumatik Aue, 1949–51 Zentra Wismut Aue, 1951–54 BSG Wismut Aue, 1954–63 SC Wismut Karl-Marx-Stadt, 1963–90 BSG Wismut Aue, 1990–92 FC Wismut Aue, seit dem 1. Januar 1993 FC Erzgebirge Aue; DDR-Oberliga 1951–90; Zweite Bundesliga 2003–08, 2010–12; Dritte Liga 2008–10; Spielkleidung: Violett/Weiß/Violett; Spielort: Lößnitztal; Stadion: Sparkassen-Erzgebirgsstadion, 15 700 Plätze (DDR: Otto-Grotewohl-Stadion, 20 000 Plätze). – Die BSG Wismut Aue musste sich von 1954 bis 1963 SC Wismut Karl-Marx-Stadt nennen, obwohl der Verein nicht in Karl-Marx-Stadt, sondern stets in Aue seine Heimspiele austrug. – INTERNET: www.fc-erzgebirge.de
Spieler (Auswahl): E. Agyemang – M. Amadou – A. Barylla – E. Bauer – K. Bittner – T. Bobel – N. Braham – M. Brečko – S. Curri – R. Dostalek – G. Eberlein – U. Ebert – E. Einsiedel – J. Emmerich – D. und H. Erler – J. Escher – A. Feick – H. Freitag – M. Fuchs I und II – T. Geißler – D. Gerber – H. Geuthner – H. Glaser – T. Görke – K. Groß – A. Günther – J. Hahnel – M. Hambeck – P. Heidler – M. Heidrich – S. Helbig – F. Heller – M. Hensel – J. Hochscheidt – A. Juskowiak – M. und S. Kaiser – J. Kaufman – A. Keller – T. Kempe – E. Kern – L. Killermann – M. Kischko – R. Klingbeil – T. Klinka – N. Klotz – S. Köhler – R. König – B. Konik – W. Körner – T. Kos – R. Kraft – S. Krauß – C. Kreul – M. Kurth – A. Lachheb – A. Langer – P. le Beau – J. Löffler – M. Männel – H. Miller – H. Mothes – A. und B. Müller – H. Münch – S. Näcke – H. Neff – A. Nemec – N. Noveski – T. Paulus – S. Persigehl – D. Pohl – A. Ramaj – D. Rangelov – M. Reichel – D. Riemenschneider – M. Sadlo – H. Satrapa – K. Schaller – K. Schlitte – R. Schmalfuß – J. und V. Schmidt – L. Schmiedel – O. Schröder – F. Schüller – D. Schüßler – G. Seinig – K. Shubitidze – D. Siradze – E. Skela – L. Spitzner – K. Steinbach – C. Sträßer – P. Süß – P. Sykora – T. Teubner – K. Thiele – R. Thielemann – D. Toppmöller – R. Trehkopf – W. Tröger – K. Viertel – S. Wachtel – K. Wagner – M. Weikert – H. und J. Weißflog – K. und S. Wolf – F. Yigitusagi – K.-H. Zeidler – D. Zimmer – K. Zink. – Trainer (Auswahl): K. Dittes – H. Erler – J. Escher – H. Fischer – W. Fritzsch – M. Fuchs I und II – F. Gödicke – K. Gogsch – A. Günther – G. Hofmann – G. Horst – H. Jacob – M. Kämpfe – F. Lieberam – L. Lindemann – T. Matheja – H. Meyer – R. Minge – B. Müller – G. Schädlich – K. Schaller – R. Schmitt – U. Schulze – R. Seitz – H. Speth – H.-U. Thomale – K. Toppmöller.
Frauen- und Mädchenfußball: gegr. 1974 in Schlema (heute → Bad Schlema) als BSG Rotation Schlema, 1990 Wechsel nach Aue zum FC Wismut Aue, seit 1993 (wie bei den Männern) FC Erzgebirge Aue.
Spielerinnen (Auswahl): R. Baumann – D. Berisha – K. Hecker – A. Mittag – S. Schult – K. Stiehl – H. Ulmer – A. Viertel – B. Weiß. – Trainer/innen (Auswahl): R. Baumann – H. Le Beau – D. Männel.
| Erzgebirge Aue: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1956, 1957, 1959 Landespokal 1955 (DDR-Liga-)Staffelsieger 1951 (Staffel Süd) (Nord-)Regionalligameister 2003 Sachsenmeister 20081) Sachsenpokal 2000, 20001, 2002 Frauen DFV-Bestenermittlung 19872, 19882 DFV-Pokal 19872), 19892), 1991 Sachsenpokal 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 1) II. Mannschaft. – 2) Rotation Schlema. |
Auer, 1) Benjamin („Benny“), dt. Angriffsspieler, * 11. Januar 1981 Landau in der Pfalz (Rheinl.-Pf.); bis 1988 HSV Landau, 1988–95 FSV Offenbach (Rheinl.-Pf.), 1995–99 1. FC Kaiserslautern, 1999/2000 Karlsruher SC, 2000–02 Borussia Mönchengladbach, 2002–06 1. FSV Mainz 05, 2006 VfL Bochum, 2007 1. FC Kaiserslautern, 2007/08 VfL Bochum, 2008–11 Alemannia Aachen (Torschützenkönig 2009 [16, mit C. → Makiadi und M. → Mintál]); 87 Bundesligaspiele (2001–08; 21 Tore); 188 Zweitligaspiele (seit 1999; 68 Tore). – 2) Karl, dt. Angriffsspieler (Rechtsaußen), * 12. August 1903 Fürth, † 21. Februar 1945 Russland (gefallen); 1917–30 SpVgg Fürth, 1930–33 1. Würzburger FV 1904; drei Länderspiele (1924–26; zwei Tore); spielte repräsentativ für Süddeutschland und Nürnberg/Fürth (Städteauswahl). – Sein Bruder Heinrich Auer (* 1909, † 1983) spielte auf der gleichen Position: 1920–31 SpVgg Fürth, 1931/32 1. FC Nürnberg, 1932–34 1. Würzburger FV 1904.
Auerbach/Vogtl., Dtl. (Stadt in Sachsen); VfB Auerbach (Verein für Bewegungsspiele Auerbach), gegr. am 17. Mai 1906 als Auerbacher FC, 1919–45 VfB Auerbach, 1945 aufgelöst und als SuKK Auerbach neu gegr., 1949–51 BSG KWU Auerbach, 1951 Anschluss an BSG Einheit Auerbach, seit 1991 wieder VfB Auerbach; Spielkleidung: Gelb/Schwarz/Gelb; Stadion: VfB-Stadion, 4 000 Plätze. – INTERNET: www.vfb-auerbach.de
Spieler (Auswahl): R. Berger – R. Bley – M. Boček – D. Fröhlich – R. Gerber – S. Gorschinek – U. Kramer – S. Persigehl – C. Pfoh – M. Saalbach – H. Schmidt – F. Steiniger – M. Wieland. – Trainer (Auswahl): A. Bielau – S. Dünger – L. Emde – U. und V. Kramer – B. Richter – A. Spranger – F. Steiniger.
| VfB Auerbach: Erfolge (Auswahl) Sachsenmeister 2003 |
AUF, Abk. für Asociación Uruguaya de Fútbol, den Fußballverband von → Uruguay.
Aufbauer, schweizer. Bez. für → Mittelfeldspieler.
Aufhauser, René, österr. Mittelfeldspieler, 21. Juni 1976 Voitsberg; bis 1995 ASK Köflach, 1995/96 ASK Voitsberg, 1996–2001 Austria Salzburg, 2001–05 Grazer AK, 2005–10 RB Salzburg, 2010/11 LASK Linz; 58 Länderspiele (seit 2002; zwölf Tore); EM-Endrunde 2008.
Aufsetzer, Ball, der unmittelbar vor dem Tor aufspringt und damit eine für den Torhüter schwer zu berechnende Flugbahn erhält, insbesondere bei wuchtigen Schüssen und glattem Geläuf. Aufsetzer sind deshalb für die Torhüter ein „Albtraum“.
Aufstieg, Wechsel von einer niedrigeren in eine höhere Spielklasse. I. d. R. steigt diejenige Mannschaft auf (evtl. auch die ihr in der Tabelle folgende), die die Meisterschaft in der niedrigeren Klasse errungen hat. Der Aufstieg kann auch in gesonderten Aufstiegsrunden ermittelt werden. Die Mannschaft, die den Aufstieg erreicht hat, heißt Aufsteiger.
„Auf-Zeit-Spielen“, vorsätzliche unsportl. Spielverzögerung, hervorgerufen durch bewusst langatmiges Ausführen von Freistößen, Abstößen, Einwürfen usw., auch durch Vortäuschen von Verletzungen. Damit versucht eine Mannschaft, den momentanen Spielstand bis zum Abpfiff zu halten. Der Schiedsrichter ist dann angehalten, nachspielen zu lassen. – Eine sportl. Spielverzögerung ist dagegen das „Halten des Balles in den eigenen Reihen“, was vom Schiedsrichter nicht zu ahnden ist. S. a. Nachspielen
Augenthaler, Klaus („Auge“), dt. Trainer, * 26. September 1957 Fürstenzell (Niederbayern); war Abwehrspieler (Libero): 1967–75 FC Vilshofen (Niederbayern), 1976–91 Bayern München; 404 Bundesligaspiele (1976–91; 52 Tore); 27 Länderspiele (1983–90); WM-Endrunde 1986, 1990 (Weltmeister). – Später Trainer: 1991–97 Bayern München (bis 1992 B-Junioren, 1992–97 Assistent), 1997–2000 Grazer AK, 2000–03 1. FC Nürnberg (Zweitligameister 2001), 2003–05 Bayer 04 Leverkusen, 2006/07 VfL Wolfsburg, 2010/11 SpVgg Unterhaching.
| K. Augenthaler „Jeder, der heute einen Profivertrag unterschreibt, glaubt, einen Ball stoppen zu können. Das ist ein Irrtum.“ |
Augsburg, Dtl. (Stadt in Bayerisch-Schwaben); 1) FC Augsburg (Fußballclub Augsburg), gegr. am 8. August 1907 als FC Alemannia Augsburg, 1921–69 BC Augsburg (1935 Anschluss von Sportverein Kriegshaben), 1969 Fusion mit TSV 1847 Schwaben Augsburg (→ Augsburg [2]) zu FC Augsburg; Bundesliga 2011/12; Zweite Bundesliga 2006–11; Spielkleidung: Weiß; Spielort: Göggingen; Stadion: SGL-Arena, 30 660 Plätze; früher → Rosenaustadion. – INTERNET: www.fcaugsburg.de
Spieler (Auswahl): R. Aumann – F. Bachl – D. Baier – O. Behner – A. Bellinghausen – R. Benschneider – S. Bertram – A. Beyerle – U. Biesinger – M. Breitkreutz – L. Bunk – J.-I. Callsen-Bracker – M. Coulibaly – L. Davids – M. de Jong – M. Diabang – S. Dreßler – V. Drobný – D. Eckstein – F. Fischer – D. Frey – A. Geltl – H. Gitschier – R. Grahammer – L. Haas – S. Hain – H. Haller – W. Hampel – M. Hdiouad – J. Hegeler – I. Hertzsch – O. Hilner – P. Hlinka – K. Hochstätter – H. Hosogai – K. Hutwelker – S. Jentzsch – D. Kampa – E. Kapllani – V. Khamutouski – F. Kioyo – E. Kirschner – M. Knackmuß – K. Kowarz – H. Lang – S. Langkamp – A. Lawarée – F. Ledezma – M. Leitner – M. Ludwig – I. Mansiz – P. Mayer – T. Meggle – M. Miller – W. Modick – U. Möhrle – S. Mölders – P. Mölzl – G., L. und R. Müller – M. Ndjeng – H. Nettel – S. Neuhaus – G. Niklasch – K. Obermeier – C. Okpala – D. Peitz – G. Platzer – N. Rafael – M. Rama – D. Reinhardt – K. Riedle – G. Sankoh – D. Schatzschneider – F. Scherer – K. Schindler – L. Schlump – O. Schmidt – E. Schneider – B. Schuster – R. Seitz – A. Sinkala – L. Sinkiewicz – W. Sterzik – R. Strauß – A. Strehmel – G. Šukalo – I. Szabics – M. Thorandt – M. Thurk – D. Toppmöller – S. Torghelle – I. Traoré – T. Tuchel – Z. Varga – A. Veh – P. Verhaegh – M. Vorbeck – T. Werner – E. Willimowski – R. Zimmerly. – Trainer (Auswahl): H.-J. Boysen – H. Cieslarczyk – H. Erhardt – H. Fach – S. Franz – W. Hartwig – A. Higl – R. Hörgl – G. Lettieri – R. Loose – J. Luhukay – M. Merkel – E. Middendorp – W. Olk – J. Pöttinger – F. Rebell – R. Reekers – D. Schatzschneider – G. Schwickert – A. Veh – K. Wettberg.
| FC Augsburg: Erfolge (Auswahl) (Süd-)Zweitligameister 1961 (Süd-)Regionalligameister 1974, 2006 Bayerischer Meister 1966, 1973, 1980, 1982, 1994, 2002 |
2) Schwaben Augsburg, eigtl. „TSV Schwaben Augsburg“ (Turn- und Sportverein Schwaben Augsburg), gegr. 1847 als TV 1847 Augsburg, 1924 Ausgliederung der Fußball- u. a. Abteilungen als SV Schwaben Augsburg, 1925 Fusion mit SSV Augsburg zu SSV Schwaben Augsburg, 1941 Fusion mit TV 1847 Augsburg zu TSV 1847 Schwaben Augsburg, 1945 aufgelöst und 1946 wieder als TSV Schwaben Augsburg gegr., 1969 Auflösung der Fußballabteilung (I. Mannschaft) und deren Fusion mit dem BC Augsburg (→ Augsburg [1]) zum FC Augsburg, 1970 Anschluss von FA 1969 Eintracht Augsburg; Spielkleidung: Violett-Weiß/Schwarz/Weiß; Spielort: Hochfeld; Stadion: Ernst-Lehner-Stadion, 6 000 Plätze. – INTERNET: www.tsv-schwaben-augsburg.de
Spieler (Auswahl): U. Biesinger – K. Burger – W. Dziarstek – K. Frisch – K. Grünsteudel – W. Hampel – G. Harlacher – K. Haseneder – G. Lechner – E. Lehner – A. Meßmer – G. Mögele – K. Ostertag – O. Rohr – G. und H. Schmid
– L. Schmuttermair – F. Schneider – W. Struzina – F. Süßmann – A. Veh – N. Wodarzik – R. Zimmerly. – Trainer (Auswahl): K. Förster – H. Greiner – J. Haller – O. Westphal.
Au/Iller, SpVgg, Dtl.: → Illertissen [2].
Aumann, Raimond („Balu“), dt. Torhüter, * 12. Oktober 1963 Augsburg; 1970–76 Stadtwerke Augsburg, 1976–82 FC Augsburg, 1982–94 Bayern München, 1994–96 Beşiktaş JK (Istanbul); 216 Bundesligaspiele (1982–94); vier Länderspiele (1989/90); WM-Endrunde 1990 (nicht eingesetzt).
Aurélio, Mehmet, Türkei: svw. → Mehmet Aurélio.
Aurich, Dtl. (Stadt in Ostfriesland); SpVg Aurich (Sportvereinigung Aurich), gegr. 1911 als SpVg Aurich, 1938 Fusion mit MTV Aurich zu TuS Aurich, seit 1951 wieder SpVg Aurich; Spielkleidung: Rot; Stadion: Ellernfeld, 10 000 Plätze. – INTERNET: www.spvgaurich.de
Spieler (Auswahl): N. Schmäler – S. Baumgart – K. Betten – I. Bollmeyer – H. de Berg – B. Fuchs – P. Knus – M. Kurtic – J. Leonhardt – T. Peplow – N. Schmäler – M. Schühler – M. Schulz – J. Winckler. – Trainer (Auswahl): R. Lange – M. Olbrys – T. Peplow – K. Trautmann.
Ausball, Ball, der auf dem Boden oder in der Luft die Tor- (Ab-, Eckstoß) oder Seitenlinie (Einwurf) mit seinem vollständigen Durchmesser (nicht mit dem Umfang, wie oft fälschlich gesagt) überschritten hat. S. a. Spielregeln [Regel 9].
„ausgebrannt sein“ → Fußballerjargon.
„Ausholfinte“ → Stoßfinte.
Ausländerregelung, Lizenzfußball: in den letzten Jahren wiederholt geänderte Bestimmung der Dt. Fußball-Liga (DFL), die z. B. besagte, dass Klubs maximal vier Spieler verpflichten konnten, die nicht aus dem UEFA-Bereich stammten. Ab dem Spieljahr 2006/07 wurde diese Einschränkung aufgehoben. Einem dt. Spieler gleichgestellt ist ein „Fußballdeutscher“, der – ohne die dt. Staatsbürgerschaft zu besitzen – in den letzten fünf Jahren, davon mindestens drei Jahre als Jugend-/Juniorenspieler, ununterbrochen für dt. Vereine gespielt hat.
Ausscheidungsspiele, svw. → Qualifikationsspiele.
Außem, Ralf, dt. Trainer, * 1. September 1960 Köln; war Abwehrspieler: 1979/80 1. FC Köln, 1980/81 Viktoria Köln, 1981–84 Hannover 96, 1984–91 Fortuna Köln; ein Bundesligaspiele (1980); 318 Zweitligaspiele (1981–91; 23 Tore). – Später Trainer: 2002–04 und 2007 Fortuna Köln, 2007–10 Rot-Weiss Essen (Assistent).
Außenbandriss → Sportmedizin.
Außendecker → Außenverteidiger.
Außenläufer, WM-System: rechter (Rückennummer 4) und linker Läufer (6); sie bildeten mit den beiden → Halbstürmern (8 und 10) das Mittelfeld.
Außenrist, svw. äußerer Fußrücken. Schüsse mit dem Außenrist verleihen dem Ball Effet (als Rechtsschütze nach rechts bzw. als Linksschütze nach links). S. a. Effetstoß
Außenstürmer, WM-System: an den Seitenlinien postierte Angriffsspieler; rechte Seite Rechtsaußen (Rückennummer 7), linke Seite Linksaußen (11).
Außenverteidiger, WM-System: die beiden äußeren Abwehrspieler (Rückennummern 2 und 3), als rechter (Rechtsverteidiger) und linker Verteidiger (Linksverteidiger) bezeichnet. – Heute ist Außenverteidiger die Bez. für die beiden äußeren Spieler einer Viererabwehrreihe (Außendecker).
Ausstiegsklausel, Lizenzfußball: Vertragspassus, der es dem Spieler erlaubt, den Verein unter besonderen Umständen ohne bzw. mit vertraglich festgeschriebener Transfersumme vor Vertragsablauf zu verlassen (z. B. bei Abstieg).
Aust, Jürgen, dt. Schiedsrichter, * 30. Januar 1960 Köln; DFB-Schiedsrichter seit 1984; FIFA-Referee 1995-97; Bundesliga 1990–2003 (160 Spiele); zwei Länderspiele; sechs EC-Spiele; DFB-Pokal-Finale 1999.
Austermühl, Birgitt, dt. Abwehrspielerin, * 8. Oktober 1965 Kassel; 1969–92 TSV Battenberg (Hessen), 1992–94 Jahn Calden, 1994– 96 FSV Frankfurt; 53 Länderspiele (1991–96; zwei Tore); WM-Endrunde 1991, 1995; EM-Endrunde 1993, 1995 (Europameisterin); olymp. Fußballturnier 1996.
Australien, Bundesstaat, der das austral. Festland, Tasmanien und kleinere Inseln umfasst, 7,692 Mio. km², 21,36 Mio. Ew.; Verband: Australian Soccer Association, Abk. ASA, gegr. 1961, seit 2005 Football Federation Australia, Abk. FFA, Sitz: Sydney; Mitglied der FIFA seit 1963, der OFC 1966–2006 (WM-Endrunde) und seitdem der AFC; Spielkleidung: Gold/Grün/Gold. – Höchste Spielklasse: A-League (elf Vereine). Seit 2005 spielt ständig ein neuseeländ. Verein in der A-League. – INTERNET: www.footballaustralia.com.au
| Australien: Erfolge (Auswahl) Ozeanienmeister 1980, 1996, 2000, 2004 Frauen Ozeanienmeister 1994, 1998, 2003 Asienmeister 2010 |
Auswärtstoreregel, Festlegung bei Pokal- oder Entscheidungsspielen, die besagt, dass nach Hin- und Rückspiel bei gleichem Punkt- und Torverhältnis die höhere Anzahl der auswärts erzielten Treffer über den Gesamtsieg entscheidet (Bonifikationssystem); 1969 von H. → Bangerter für alle EC-Wettbewerbe eingeführt und von den meisten Verbänden nat. nachvollzogen. Der oft zitierte Ausspruch „Auswärtstore zählen doppelt“ ist korrekt, insofern er sich nicht auf das jeweilige Ergebnis, sondern ausschl. auf den Vergleich der Auswärtstore bezieht. Eine Mannschaft, die auswärts 2:3 unterliegt, hat demzufolge nicht 4:3 gewonnen. Die Auswärtstoreregel soll eine offensivere Einstellung bei Auswärtsspielen bewirken und damit die Spiele attraktiver gestalten.
| Auswärtstoreregel (Beispiele) A – B 3:1 B – A 4:2 Gesamtsieger: A (zwei Auswärtstore) Unterlegener: B (ein Auswärtstor C – D 2:2 D – C 3:3 Gesamtsieger: C (drei Auswärtstore) Unterlegener: D (zwei Auswärtstore) |
Auswechslung, Austausch von Spielern während des Spiels durch den Trainer. Spieler, die in das Spiel kommen, bezeichnet man als Einwechselspieler, solche, die das Spielfeld verlassen, als ausgewechselte Spieler. Die häufig gebrauchte Bezeichnung Auswechselspieler für die Erstgenannten ist eigtl. unkorrekt, da sie nicht aus-, sondern eingewechselt (es wird „gewechselt“) werden. Es dürfen drei Spieler jeder Mannschaft ausgetauscht werden, in der Junioren-Bundesliga vier. Bei Freundschaftsspielen z. B. kann aber die Zahl der Wechselspieler vorher vereinbart werden. Bereits ausgewechselte Spieler dürfen nicht wieder eingesetzt werden.
Die umgangssprachl. Bezeichnung „Ersatzspieler“ (für Wechselspieler) ist unterklassig immer noch üblich, im Profifußball wird der von B. → Vogts in den 1980er-Jahren geprägte Begriff Ergänzungsspieler zunehmend gebraucht. Die Wechsel- oder Spielerbank ist eine überdachte Sitzbank für (drei bis sieben) Wechselspieler, Trainer, Arzt, Masseur und Betreuer; für jede der beiden Mannschaften links und rechts der Mittellinie (für Gastgeber und Gäste stets gleicher Standort) installiert oder aufgestellt.
| Auswechslung Interchange [engl.] Échange [frz.] Cambio [span.] Substituiçao [port.] Baratto [ital.] |
Ausweichplatz, Anlage, auf der eine Heimmannschaft antreten muss, weil ihr eigener Platz gesperrt ist (z. B. wegen Baumaßnahmen, Unbespielbarkeit); nicht zu verwechseln mit → „neutralem Platz“ bei → Platzsperre.
Auxerre, Frankreich (Stadt in Burgund); AJ Auxerre (Association de la Jeunesse Auxerre), gegr. am 29. Dezember 1905; Spielkleidung: Weiß; Stadion: Abbé-Deschamps, 21 000 Plätze. – INTERNET: www.aja.fr
Spieler (Auswahl): K. Agboh – A. Basso – J. Bats – V. Birsa – L. Blanc – B. Boli – J. Boumsong – É. Cantona – D. Cissé – A. Comisetti – A. Coulibaly – G. Dembélé – B. Dioméde – D. Dudka – P. Garande – S. Grichting – S. Guivarc’h – P. Janas – J.-S. Jaurès – I. Jeleń – T. Kahlenberg – B. Kalou – O. Kapo – T. Klos – J. Klose – K. Kovac – L. Laslandes – S. Marlet – W. Matysik – P. Mexès – V. Munteanu – B. Mwaruwari – M. N’Diaye – D. Niculae – B. Pedretti – A. Roche – G. Roux – B. Sagna – V. Scifo – M. Sissoko – A. Szarmach – T. Tainio – G. Tamas – P. Vahirua – F. Verlaat – T. West – N. Zelić. – Trainer (Auswahl): J. Fernandez – G. Roux – J. Santini.
| AJ Auxerre: Erfolge (Auswahl) Landesmeister 1996 Landespokal 1994, 1996, 2003, 2005 |
AVB, Abk. für Arubaanse Voetbal Bond, den Fußballverband von → Aruba.
Avdić, Denni, schwed. Angriffsspieler (Mittelstürmer), * 5. September 1988 Husqvarna; bis 2004 Husqvarna FF, 2005 Brøndby IF (Kopenhagen), 2006–10 IF Elfsborg, 2011 Werder Bremen; 21 Länderspiele (seit 2009; sieben Tore); U-21-EM-Endrunde 2009 (nicht eingesetzt).
Aveiro, Portugal (Hauptstadt der Region Mitte); SC Beira-Mar (Sport Clube Beira-Mar), gegr. am 1. Januar 1922; Spielkleidung: Gelb; Stadion: Municipal de Aveiro, 30 000 Plätze. – INTERNET: www.beiramar.pt
Spieler (Auswahl): M. Caneira – Darnlei – F. Fary – S. Grahn – M. Jardel – T. Kyuchukov – A. Leão – Marco – Ratinho – P. Ribeiro – Rui Lima – J. Silva – J. Vidigal – Trainer (Auswahl): A. Inácio – F. Soler – A. Sousa.
| SC Beira-Mar: Erfolge (Auswahl) Landespokal 1999 |
Avellaneda, Argentinien (Stadt in der Provinz Buenos Aires); 1) Arsenal de Sarandi, eigtl. „Arsenal FC“ (Arsenal Fútbol Club), gegr. am 11. Januar 1957; Spielkleidung: Blau/Blau/Rot; Spielort: Sarandi; Stadion: Estadio Julio Grondona („El Viaducto“), 16 000 Plätze.
Spieler (Auswahl): P. Aguilar – M. Aguirre – R. Blanco – J. Burruchaga – C. Casteglione – M. Cuenca – G. Denis – G. Esmerado – D. Espinola – S. Hirsig – Ó. Ibáñez – I. Marcone – J. Núñez – I. Sekagya. – Trainer (Auswahl): G. Alfaro – J. Burruchaga – D. Garnero – C. Ruiz.
| Arsenal de Sarandi: Internationale Erfolge (Auswahl) Copa Sudamericana 2007 |
2) CA Independiente (Club Atlético Independiente), gegr. am 1. Januar 1905 als Independiente FC, seit 1908 CA Independiente; Spielkleidung: Rot/Blau/Blau; Spielort: Almirante Cordero; Stadion: Libertadores de América, 52 823 Plätze. – INTERNET: www. caindependiente.com
Spieler (Auswahl): R. Abeledo – D. Acevedo – R. Acuña – S. Agüero – L. Artime – A. Balbuena – F. Bello – R. Bernao – D. Bertoni – R. Bochini – C. Borghi – J. Burruchaga – J. Calderón – E. Cambiasso – N. Clausen – J. Corazzo – O. Cruz – G. Denis – A. Erico – R. Ferreiro – D. Forlán – R. Galván – C. Gamarra – R. Giusti – F. Higuain – F. Insúa – L. Islas – O. Larrosa – G. Milito – F. Mondragón – F. Navarro – J. Olguin – R. Orsi – R. Pagnanini – J. Pastoriza – R. Pavoni – J. Percudani – E. Pereira –M. Raimondo – M. Santoro – C. Semenewicz – A. Silvera – E. Trossero – O. Ustari – J. Varacka – H. Villaverde – H. Yazalde. – Trainer (Auswahl): C. Borghi – J. Burruchaga – J. Corazza – J. Falcioni – R. Ferreiro – C. L. Menotti – J. Pastoriza – O. Ruggeri – C. Silva – J. Solari – E. Trossero.
| CA Independiente: Internationale Erfolge (Auswahl) Weltpokal 1973, 1984 Copa Libertadores de América 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 Copa Interamericana 1972, 1974, 1976 Copa Sudamericana 2010 |
3) RC Avellaneda (Racing Club Avellaneda), gegr. am 25. März 1903; Spielkleidung: Blau-Weiß/Blau/Blau; Spielort: Mozart y Corbatta; Stadion: Juan Domingo Perón, 64 000 Plätze. – INTERNET: www.racingclub.com
Spieler (Auswahl): O. Ardiles – R. Ayala – J. Barbas – A. Bastia – J. Basualdo – O. Belén – G. Campagnuolo – O. Corbatta – D. Crosa – P. Dellacha – E. Fabbri – U. Fillol – S. Goycoechea – D. Killer – C. Ledesma – L. López – P. Manfredini – C. L. Menotti – D. Milito – M. Mirosevic – J. Olarticoechea – J. Pastoriza – F. Paternosta – R. Paz – R. Perfumo – N. Perinetti – H. J. Pinola – S. Romero – F. Sacchi – F. Sava – D. Simeone – R. Sosa – C. Squeo – J. van Tuyne – R. Villa – R. Villanova – E. Wolff – F. Zuculini . – Trainer (Auswahl): A. Basile – L. Cubilla – U. Fillol – R. Merlo – N. Rossi – D. Simeone – C. Vivas.
| RC Avellaneda: Internationale Erfolge (Auswahl) Weltpokal 1967 Copa Libertadores de América 1967 |
Avellino, Italien (Stadt in Kampanien); US Avellino (Unione Sportiva Avellino), gegr. 1912; Spielkleidung: Grün/Weiß/Weiß; Stadion: Partenio, 33 500 Plätze. – INTERNET: www.usavellino.it
Spieler (Auswahl): R. Ametrano – N. Anastopoulos – M. Bacis – D. Bertoni – R. Biancolino – B. Bola – V. Boudianski – D. Cecere – S. Colantuono – F. Colomba – T. Danilevičius – S. De Angelis – F. De Napoli – N. Diliso – G. Dirceu – V. Kutuzov – V. Moretti – F. Ravanelli – W. Schachner – S. Tacconi. – Trainer (Auswahl): Z. Boniek – G. Carboni – F. Colomba – M. Ficcadenti – F. Graziani – T. Ivić – G. Papadopulo – Z. Zeman.
AWD-Arena, Hannover-Ohe: Heimstätte von Hannover 96; 1954–2002 Niedersachsenstadion (86 000 Plätze), umgebaut 2002–05; 49 000 Plätze; WM-Stadion 2006.
AXA Kaiserstuhl-Cup, offizielle Bez. für den → Kaiserstuhl-Cup.
Axams, Österreich (Gemeinde in Tirol); SPG Axams/Götzens, (Spielgemeinschaft Axam-Götzens), gegr. 1951 als SV Axams, seit 2002 Spielgemeinschaft mit SV Götzens (Axams’ Nachbarverein) als SPG Axams/Götzens; Spielkleidung: Blau-Gelb/Blau/Blau; Stadion: Ruifach-Stadion, 1 000 Plätze. – INTERNET: www.spg-axams-goetzens.com
Spieler (Auswahl): G. Bergmann – D. Bierent – B. Foidl – M. und R. Riedl. – Trainer (Auswahl): M. Schnellrieder – W. Schwarz.
| SPG Axams/Götzens: Erfolge (Auswahl) Tiroler Meister 1986*, 1988*, 2000*, 2003 Tiroler Cup 2001*, 2004 * SV Axams |
Axpo Super League, Schweiz: höchste Spielklasse (→ Swiss Football League).
Ayala, 1) Roberto, argentin. Abwehrspieler * 14. April 1973 Paraná; 1992–94 Ferro Carril Oeste (Buenos Aires), 1994/95 CA River Plate (Buenos Aires), 1995–98 SSC Neapel, 1998–2000 AC Mailand, 2000–07 CF Valencia, 2007 FC Villarreal, 2007–09 Real Saragossa, 2010 RC Avellaneda; 115 Länderspiele (1994–2007; sechs Tore); WM-Endrunde 1998, 2002 (nicht eingesetzt), 2006; olymp. Fußballturnier 1996, 2004 (Olympiasieger). – 2) Rubén, eigtl. “Rubén Hugo Ayala Zanabria“, argentin. Angriffsspieler, * 8. Januar 1950 Buenos Aires; 1964–73 San Lorenzo de Almagro (Buenos Aires), 1973–79 Atlético Madrid, 1980/81 CF Atlante (Cancún); 45 Länderspiele (1971–74; elf Tore); WM-Endrunde 1974.
Ayew, 1) André („Dede“), eigtl. „André Morgan Rami Ayew“, ghanaischer Angriffsspieler (auch frz. Staatsbürgerschaft), * 17. Dezember 1989 Lille (Frankreich); Bruder von [3], Neffe von [2] und Sohn von A. → Pelé; 2003–05 FC Nania (Accra), 2005–07 Olympique Marseille, 2008/09 FC Lorient (Frankreich), 2009/10 AC Arles-Avignon, 2010/11 Olympique Marseille; 26 Länderspiele für Ghana (seit 2007; ein Tor); U-20-Weltmeister 2009; WM-Endrunde 2010. – 2) Kwame, ghanaischer Angriffsspieler, * 28. Dezember 1973 Accra; Onkel von [1] und [3] sowie Bruder von A. → Pelé; 1989/90 Africa Sports National (Abidjan), 1990–92 FC Metz, 1992–95 US Lecce, 1995/96 UD Leiria, 1996/97 Vitória Setúbal, 1997/98 Boavista Porto, 1999/2000 Sporting Lissabon, 2000/01 Yimpaş Yozgatspor (Türkei), 2001/02 Kocaelispor (Türkei), 2002/03 Shenyang Haishi (China), 2004–07 Shaanxi Baorong (China; Torschützenkönig 2004 [17]), 2007 Vitória Setúbal; 69 Länderspiele (1992–2001; 36 Tore); olymp. Fußballturnier 1992. – 3) Rahim, eigtl. „Abdul Ibrahim Ayew“, ghanaischer Mittelfeldspieler, * 19. September 1985 Tamele; Bruder von [1], Neffe von [2] und Sohn von A. → Pelé; 2000–02 Adisadel College (Cape Coast [Ghana]), 2002–08 FC Nania (Accra), 2008/09 Sekondi Eleven Wise (Sekondi-Takoradi [Ghana]), 2009–11 Zamalek SC (Kairo); sechs Länderspiele (seit 2009); WM-Endrunde 2010 (nicht eingesetzt).
Aytekin, Deniz, dt. Schiedsrichter türk. Herkunft, * 21. Juli 1978 Oberasbach (Mittelfranken); Verein: TSV Altenberg (Oberasbach); Landesverband: Bayer. Fußballverband (BFV); DFB-Schiedsrichter seit 2004, FIFA-Referee seit 2011; Zweite Bundesliga seit 2006 (33 Spiele); Bundesliga seit 2008 (37 Spiele).
Azaouagh, Mimoun, dt. Mittelfeldspieler marokkan. Herkunft, * 17. November 1982 Benisidel (Marokko); 1988–96 FSV Frankfurt, 1996–99 Eintracht Frankfurt, 2000–04 1. FSV Mainz 05, 2005/06 FC Schalke 04, 2006/07 1. FSV Mainz 05, 2007 FC Schalke 04, 2008–11 VfL Bochum; 105 Bundesligaspiele (2004–10; zehn Tore).
Azizi, Khodadad, iran. Trainer, * 22. Juni 1971 Maschad; war Angriffsspieler: 1988–92 FC Aboomoslem (Maschad), 1992–94 Pas Teheran, 1994–96 Bahman Teheran, 1996/97 Persepolis Teheran, 1997–2000 1. FC Köln, 2000 San José Earthquakes (USA), 2001 Al-Nasr (Dubai), 2001–05 Pas Teheran, 2005 Admira Wacker Mödling, 2005/06 Rah Ahan (Teheran); 20 Bundesligaspiele (1997/98; fünf Tore); 47 Länderspiele (1992–2005; elf Tore); WM-Endrunde 1998; Asiens Fußballer des Jahres 1996; im Iran Fußballer des Jahres 1996, 1997. – Später Trainer: 2006/07 FC Aboomoslem.
Azoren, Portugal: Gruppe von Atlantikinseln; Hauptort: Ponta Delgada (Insel São Miguel).
| Azoren: Vereine (Auswahl) CD Santa Clara |
Aztekenstadion, Mexiko-Coyoacán: Nationalstadion von Mexiko, eröffnet 1966, 114 000 Plätze; WM-Endspielstätte 1970, 1986; Heimstätte des Club América (→ Mexiko-Stadt [2]).
Azzouzi, Rachid, marokkan. Trainer und Funktionär, * 10. Januar 1971 Fès; war Mittelfeldspieler: bis 1986 Hertha Mariadorf (Alsdorf [NRW], 1986–88 Alemannia Mariadorf, 1988/89 1. FC Köln, 1989–95 MSV Duisburg, 1995–97 Fortuna Köln, 1997–2003 SpVgg Greuther Fürth, 2003 Chongqing Lifan (China), 2004 SpVgg Greuther Fürth; 64 Bundesligaspiele (1991–95; drei Tore); 260 Zweitligaspiele (1997–2003; 30 Tore); 37 Länderspiele (1992–98; ein Tor); WM-Endrunde 1994, 1998. – Später Trainer und Funktionär: 2004–11 SpVgg Greuther Fürth (bis 2005 B-Junioren, 2005–08 Teammanager, 2008–11 Manager).
Azzurri(s), kurz für die „Squadra Azzurra“, die ital. Nationalmannschaft.