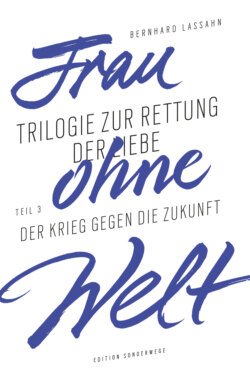Читать книгу Frau ohne Welt. Teil 3: Der Krieg gegen die Zukunft - Bernhard Lassahn - Страница 11
Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose
ОглавлениеWir versuchen, so gut es geht, Distanz zu signalisieren, wenn wir Abstand halten wollen – es geht nicht immer gut. Für viele war die Deutsche Demokratische Republik nicht echt, nicht gültig; manche taten so, als gäbe es sie gar nicht. Sie war nur eine sich fälschlicherweise selbst so bezeichnende »Demokratie«, deshalb wurde DDR bei der Bild-Zeitung in Anführungsstriche gesetzt. Solche Gänsefüße, wie Jean-Paul sie nannte, waren schon im Dritten Reich als ironisierende Anführungsstriche ein verbreitetes propagandistisches Stilmittel. Victor Klemperer erklärt das ausführlich in seinen Tagebüchern und Untersuchungen zur LTI Lingua Tertii Imperii, der Sprache des Dritten Reiches: jüdische »Rechtsanwälte« wurden durch solche Anführungszeichen heruntergestuft zu so genannten Rechtsanwälten; sie waren also keine wirklichen Anwälte, sie wurden nur so genannt.
Heute schreibt man »besorgte Bürger« in Anführungsstrichen, um deutlich zu machen, dass man ihnen die Sorgen nicht abnimmt. Die Tüttelchen sind inzwischen wieder inflationär verbreitet, sie werden sogar pantomimisch eingesetzt, als hätten unsere Gespräche neuerdings Untertitel, die man durch nervöse Fingerzeichen ergänzen muss, um anzuzeigen, dass alles gar nicht so gemeint ist. Wir reden wie listige Kinder mit schlechtem Gewissen, die hinter dem Rücken die Finger kreuzen.
Im Jahr 2012 wurde im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie erstellt, in der die so genannte antifeministische Männerrechtsbewegung untersucht und als besonders gefährlich präsentiert wird. Diese »Studie« (um auch mal solche Zeichen zu verwenden) ist wissenschaftlich ohne jeden Wert, sie wurde nichtsdestoweniger durch den Lehrstuhl für Soziologie, Soziale Ungleichheit und Geschlecht, den Ilse Lenz innehatte, abgesegnet. Wir erfahren nicht, was es mit diesen Männerrechtlern tatsächlich auf sich hat, wir lernen aber, welche Vorwürfe man ihnen macht: Sie denken essentialistisch, also wesentlich. Hinrich Rosenbrock, der Verfasser dieser »Studie«, tut so, als wäre es neuerdings verboten, wesentlich zu sein und als hätte er da einen Verein entdeckt, der sich das berühmte Zitat von Angelus Silesius – »Mensch werde wesentlich« – in die Satzung geschrieben hat. Rosenbrock zeigt auf, dass die von ihm untersuchten Männer ihr Weltbild »essentialistisch« begründen und dass sie »essentialistische Geschlechtsvorstellungen« teilen, sie lassen auch einen »essentialistischen Geschlechterdualismus« erkennen oder sogar »essentialistische Familienvorstellungen«. »Essentialistisch« kommt dermaßen oft vor, dass man den Text gut als Sprachübung für Leute mit einem S-Fehler nutzen könnte. Man fragt sich allerdings, was so »gefährlich« daran sein soll, wenn jemand wesentlich sein will. Das wird nicht zur Diskussion gestellt, es ist vorausgesetzt. Selbstreflexion darf man bei so einer »Studie« nicht erwarten; der theoretische Tiefgang entspricht dem künstlerischen Niveau, das für Bilder gilt, die nach der Methode »Malen nach Zahlen« gefertigt werden.
Warum aber wird ein Essentialismus abgelehnt? Weil jemand, der wesentlich sein will, nicht so leicht davon zu überzeugen ist, dass eine Geschlechterrolle ausschließlich sozial konstruiert ist. Genau das sollen wir aber glauben. Es ist ein zentrales Gebot des Gender-Mainstreaming, das sich so radikal auf soziale Einflüsse verengt, dass alles, was nicht dazugehört; also alles, was zum Wesen, zur Biologie und zur Geschichte eines Menschen gehört, ausgeblendet und ignoriert wird, als existierte es nicht.
Als er noch Markus Ganserer hieß und sich für einen Sitz für die Grünen im Bayrischen Landtag bewarb, war er Vater zweier Kinder und stellte sich »vehement gegen Eingriffe in die Natur«. Ein Naturbursche, ein echter Kerl. Dann wurde gemeldet, dass er sowohl als Mann als auch als Frau lebte. Privat wollte er seine weibliche Identität pflegen, im Landtag aber weiterhin als Mann auftreten und sich für die Rechte von Transgender-Menschen einsetzen. »Es braucht mehr Sichtbarkeit für das Thema und eine breitere Akzeptanz«, meinte er. Nun nennt er sich Tessa Ganserer und verkündete Anfang des Jahres, dass er zukünftig »ausschließlich als Frau« leben und auch bei der politischen Arbeit entsprechend auftreten wolle: »Ich bin Frau, mit jeder Faser meines Körpers. Nun auch Frau Landtagsabgeordnete«.
Er ist der erste Transsexuelle in einem deutschen Landesparlament und wird von einer Woge der Zustimmung getragen. Nur wenige sind noch irritiert, wie ein FDP-Abgeordneter, der Ganserer als »Dragqueen« bezeichnete. Tessa Ganserer, formerly known as Markus Ganserer, wies das sogleich zurück und erklärte, dass das eine Beleidigung sei. »Ich verkleide mich nicht«, stellte der ehemals männliche Abgeordnete fest, der gerade eine Seidenbluse und eine Perücke trug, und fügte kulant hinzu. »Ich bin nicht nachtragend. Das kriegen wir schon hin«.
Es hätte mir auch passieren können. Ich habe schon einige Dragshows gesehen, die, wie ich zu meiner Überraschung bemerkt habe, ausgerechnet in der Südsee besonders beliebt sind. Ich hatte mich meistens gut amüsiert. Mir war sofort klar, dass es nicht etwa Frauen »in echt« sind, sondern welche »mit Batterie«. Doch der Spaß ist vorbei. Daher sollte ich auch nicht mehr so darüber reden. Es gibt schon Fälle, in denen harte Strafen verhängt werden, wenn jemand »mis-gendert«, also eine falsche Bezeichnung für eine Trans-Person verwendet. Welche ist richtig? Das ist nicht klar. Klar ist nur, dass man es leicht falsch machen kann.
Gewünscht und mancherorts bereits vorgeschrieben ist der Gebrauch des Gender-Sternchens oder die Verwendung von als neutral geltenden Formen wie »Elter 1 und 2« statt »Vater« und »Mutter«, damit Rücksicht genommen wird auf alle, die sich unwohl fühlen könnten, wenn sie daran erinnert werden, dass sie nicht wie normale Väter und Mütter sind. Bisher haben wir noch wenige prominente Fälle von Transmenschen, die uns in ihre Probleme mit ihrer Identitätsfindung hineinziehen wollen. Eine Freundin von mir sah eines Morgens so übernächtigt aus, dass sie sich nicht unter Leute traute, es sei denn, so sagte sie, ich würde vorangehen und an alle, die ihr entgegenkommen, Sonnenbrillen verteilen, so dass man sie nur durch getönte Gläser sehen könnte. Es war ein Scherz. Trans-Personen machen keine Scherze. Sie wollen uns vorschreiben, wie wir sie sehen und ansprechen sollen. Wenden wir uns Lann (geborene Antje) Hornscheidt zu. Hornscheidt betrachtet sich selbst als »neutrois«, als »entzweigendernd« und möchte, dass wir ihr neues Selbstverständnis übernehmen und sie nicht mehr mit den Pronomen, die wir üblicherweise verwenden, ansprechen. Hornscheidt bittet ausdrücklich darum, »respektvolle Anreden, die nicht Zweigeschlechtlichkeit aufrufen« zu verwenden und »zweigendernde Ansprachen wie ›Herr‹, ›Frau‹, ›Lieber‹, oder ›Liebe‹ « bei einem Kontakt zu meiden.
Wir sollen nicht einmal den akademischen Titel erwähnen, den sie einst erworben … Oh, schon falsch: »sie« ist unerwünscht … kurz: wir sollen »Professx« (ausgesprochen: Professiks) sagen oder »Profex Drex«, im privaten Rahmen gerne »Lann«, einfach »L« oder »pers«. Professx Hornscheidt meint, dass man, wenn man wirklich ein bewusst nicht-diskriminierendes Sprachhandeln pflegen will, am besten an jedes Subjekt ein »ex« anhängt. Man kann so ein »ex« auch als Pronomen verwenden (Warnung: keine Gewähr, dass es der neueste Stand ist).
Bei der Podiumsdiskussion im Rahmen des Evangelischen Kirchentages unter dem Motto »Für eine sanfte Revolution der Sprache«, bei der es um »einladende Impulse für die Genderdebatte« gehen sollte, durfte ich gegen vier Befürworterinnen und Befürworter der gerechten Sprache mein zartes Stimmchen erheben und saß direkt neben René_Hornstein, als »Vorstand Bundesverband Trans*« angekündigt, der so wie Professx Hornscheidt ebenfalls nicht mit »er« oder »sie« angesprochen werden wollte. Das machte es mir nicht leicht. Er (wie ich jetzt einfach mal sage) war halbseitig rasiert und machte den Vorschlag, dass man seine Kreativität nutzen möge, um eine passende Ansprache zu finden; manche würden ihn einfach »Chérie« nennen. Das ist jedoch kein Pronomen. Dummerweise ist es mir – so wie hier auch – immer wieder unterlaufen, dass ich doch ein »er« oder »ihn« verwendet habe, obwohl ich das nicht mehr tun sollte. Chérie, wie manche zu diesem Menschenwesen sagen, zuckte jedes Mal zusammen, als hätte ich diesem Wesen etwas angetan. Ich wurde aber nicht bestraft.
Im englischen Sprachraum hätte mir das passieren können, da wurden neue Pronomen wie »ze«, »con« und »thon« eingeführt. Zwar gibt es noch keine verbindliche Festlegung, welche davon bei welcher Gelegenheit zum Einsatz kommen sollen, doch es gibt schon Strafen, wenn man es falsch macht. In New York müssen Arbeitgeber, Ärzte oder Vermieter bis zu 250 000 Dollar zahlen, wenn sie ein falsches Pronomen gebrauchen. In Virginia wurde ein Lehrer entlassen. Eine Studentin, die er bisher mit »she« angeredet hatte, wollte plötzlich lieber mit »he« angeredet werden. Das tat er nicht. Zwar übernahm er den neuen Namen, den sie sich ausgedacht hatte, weigerte sich aber, das Pronomen, das er bisher genutzt hatte, zu ändern. Peter Vlaming war Sprachlehrer. Er ist es nicht mehr.
Es handelt sich keinesfalls um Kleinigkeiten – es sind auch gerade die kleinen Dinge, die uns so unwichtig erscheinen, dass wir ihretwegen nicht streiten mögen, die genutzt werden, um unser Ordnungssystem aus den Angeln zu heben. Kleine Dinge sind nicht klein. Wenn wir mit einer elementaren Kategorisierung wie »er«, »sie« und »es« nicht mehr unbefangen umgehen können und sie nicht mehr so nutzen können, wie wir es bisher getan haben, dann sind wir elementar verunsichert. Wenn wir darin eine moralische Frage von elementarer Bedeutung sehen, dann ist unser Moralempfinden elementar gestört.
Jordan Peterson wurde als »professor against political correctness« bekannt, weil er angekündigt hatte, keine gesetzlich verordneten Pronomen für Transgender-Personen zu verwenden. Sein Einwand, dass er sich die vielen neuen Pronomen, die sich jeder selbst ausdenken darf – darunter so originelle wie »wormself«, also »Wurmselbst« – nicht erahnen und sich auch nicht merken könne, wurde weggewischt mit dem Hinweis, er solle sie auf seinem Handy notieren. Als er erklärte, dass er das nicht tun wolle, wurde ihm vorgeworfen, dass er faul sei. Mehr noch: homophob, ein Menschenfeind. Peterson blieb beim Nein. Bei einer Verurteilung würde er keine Geldstrafen akzeptieren und wenn er ins Gefängnis müsste, in den Hungerstreik treten. In Kanada ist die Rechtsprechung besonders streng, da wird nicht nur die große, da wird gleich die größtmögliche Keule geschwungen. Das Gesetz Bill C 16 sieht vor, dass Mis-gendern nicht etwa als Kavaliersdelikt oder Unhöflichkeit gilt, sondern als Menschenrechtsverletzung. Man wird vor ein Menschenrechtstribunal – ein human rights tribunal – zitiert wie einst bei kommunistischen Schauprozessen. Es drohen existenzvernichtende Strafen. So ist es auch für Deutschland vorgesehen. Tessa Ganserer ist darauf vorbereitet: »Ich werde es auf keinen Fall akzeptieren, wenn jemand absichtlich das falsche Pronomen verwendet – oder mich mit ‚Herr‹ anspricht«.
Die Presse steht ungebrochen auf seiner Seite (oder muss es »ihrer« Seite heißen?). Ganserer wird uns in den verschiedenen Darstellungen, die durchgehend wohlwollend sind, als »echte Frau« oder »ganz normale Frau« dargestellt. Ohne Anführungsstriche. Alle machen mit. Wir sollen es auch tun. Wir sollen alte Vorstellungen abstreifen, als könnten wir das einfach so tun. Szenen wie aus dem Raum 101 im Roman 1984 haben wir hinter uns. Da werden dem Helden vier Finger gezeigt und er wird gefragt, wie viele er sieht: Ihm wurde beigebracht, fünf Finger zu sehen. Also sieht er fünf und sagt es laut: Es sind fünf Finger. So sollen auch wir uns belügen und mit Überzeugung sagen: Ja, da ist eine Frau, eine ganz normale Frau.
Da ist womöglich noch eine verzagte innere Stimme, die leise Einspruch erhebt: Ich erkenne da einen Mann in Frauenkleidern. Diese Stimme müssen wir abwürgen. Wir sollen uns sagen: Ich sehe ein, dass mich diese Stimme belügen will. Es ist eine echte Frau. Wenn ich kurzzeitig gemeint habe, da einen Mann zu erkennen, dann nicht etwa, weil ich einer optischen Täuschung erlegen bin, sondern weil da noch ein Restbestand von Irrtum vorliegt, der ausgemerzt werden muss. Es ist ganz allein mein Problem. Ich muss diese Schwäche überwinden, damit ich in dieser Gesellschaft weiterhin als jemand, der dazugehört, unbehelligt leben kann. Alle werden mir zu meiner toleranten Haltung gratulieren. Leute wie Hunt und Peterson sind isolierte Einzelgänger. In ihrem Kollegenkreis hatte niemand zu ihnen gehalten. Sie sind Sonderlinge, die man nicht länger dulden sollte.
Gibt es wirklich niemanden, der es wagt zu widersprechen? Doch. Vielleicht wird es bald schon jemanden geben. In den neuen Lehrmaterialien für einen »Sexualkundeunterricht der Vielfalt« wird bereits Zehnjährigen erklärt, was eine Dragqueen ist. Vielleicht traut sich eines Tages ein braver Schüler, sein neu erworbenes Wissen kundzutun, seine Stimme zu erheben – wie das Kind in dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, das mit der Bemerkung »Aber der König ist ja nackt« das aussprach, was niemand zu sagen wagte – und laut zu verkünden: »Und er verkleidet sich doch. Das habe ich so in der Schule gelernt.«