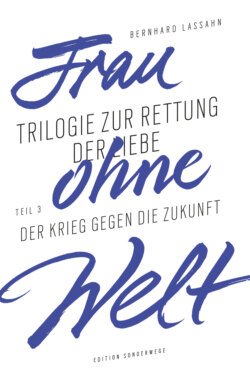Читать книгу Frau ohne Welt. Teil 3: Der Krieg gegen die Zukunft - Bernhard Lassahn - Страница 5
Schlaflose Nächte und Schreie in der Nacht
Оглавление»Sex?! Oh, nein! Sex! Nein, Sex! Ich fasse es nicht!«
»Äh … Sex?«, »Was soll das denn? Sex?«
»Sex! Sex! Sex!«
Eine Bekannte von mir hatte Pech. Sie konnte im Sommer nicht mehr bei offenem Fenster schlafen. Sie wohnte in der Langen Gasse in der Altstadt von Tübingen. Wir schreiben das Jahr 1977, wir schauen ein wenig zurück, um – wie sich Ernst Bloch das vorgestellt hat – die »Zukunft in der Vergangenheit« zu entdecken. Ich beginne mit einem kleinen Rückblick. Ich bitte, die Jahreszahl nicht allzu genau zu nehmen und mir eine gewisse Unschärfe bei der Zeitangabe zuzubilligen, immerhin mache ich eine präzise Ortsangabe.
Ich werde sogar noch großzügiger mit den Zeitangaben verfahren und das Jahr 1977 zu einem regelrechten Schicksalsjahr im Kampf der Geschlechter aufwerten und als das Jahr zeichnen, in dem der Sexismus, von dem damals noch niemand wusste, was man sich darunter vorstellen sollte, Einzug in unser Zusammenleben gehalten, sich wie eine Seuche ausgebreitet und alle Bereiche des Alltagslebens durchdrungen hat. Doch zurück zum genau lokalisierten Ort, der früher einmal still war. Warum konnte meine Bekannte nicht mehr bei offenem Fenster schlafen? Warum ließ ihr der Sex keine Ruhe?
Ihr Zimmer lag im ersten Stock. Im Erdgeschoss hatte neuerdings ein Sexshop eröffnet, ein »Fachgeschäft für Ehehygiene«, wie es im Untertitel hieß – ein Fremdkörper in dem beschaulichen Universitätsstädtchen, eng und buckelig, wie Goethe es beschrieben hatte. Ein zauberhafter Ort. Wenn da ein als Nachtwächter verkleideter Schauspieler mit Hellebarde und Laterne durch die Gassen gezogen wäre, wie das neuerdings als Touristenattraktion inszeniert wird, hätte man den Eindruck gewinnen können, die Zeit wäre tatsächlich stehen geblieben und man hätte mit Franz von Dingelstedts Liedern eines kosmopolitischen Nachtwächters verkünden können: »Die Stunde, die hat nichts geschlagen«.
Nun hatte die Stunde etwas geschlagen. Eine neue Zeit war angebrochen: Es gab einen Sexshop. Er wirkte, als wäre über Nacht ein verirrtes Raumschiff aus einer anderen Zeitzone notgelandet.
In lauen Sommernächten war es besonders schlimm. Nächtliche Spaziergänger, die bis vor kurzem vergleichsweise ruhig durch die Gassen geschlendert oder getorkelt waren, ließen angesichts des neuen Ladens alle Hemmungen fallen; es brach aus ihnen heraus wie eine Urgewalt. Selbst wenn sie ohne Gesprächspartner durch die Nacht schwankten, mussten sie den Namen des Shops laut vorlesen und ihr Leid klagen, wie Hunde es tun, wenn sie den Mond anbellen: »Sex Shop! Sex Shop!« Sie konnten einfach nicht vorübergehen, ohne einen Kommentar abzugeben, als müssten sie den Shop – oder den Sex insgesamt – verfluchen. So wie Babys bei der Geburt schreien, so brüllten die Nachtschwärmer beim Herandämmern der neuen Epoche. Manche lachten künstlich, manche gequält, bei manchen klang es wie ein Hilferuf. Der Laden wirkte auf sie seltsam bedrohlich, er gab sich als Niederlassung einer feindlichen Macht zu erkennen, die schon eine erste Bodenstation errichtet hatte.
Zur selben Zeit – nicht auf den Tag oder Monat genau – hatte in der Nähe vom Zimmertheater ein Laden aufgemacht, für den eine vergleichbare Besonderheit galt. Davon erzählte mir jemand, der im ersten Stock über dem neu eingerichteten Buchladen wohnte und in lauen Sommernächten ebenfalls keinen Schlaf fand. Auch an seiner Adresse unterbrachen Nachtschwärmer ihren Rundgang und konnten es nicht lassen, kräftige Kommentare abzugeben. Auch hier waren es Männerstimmen, die grölten und schimpften und ein Grummeln erzeugten wie bei einem heranziehenden Gewitter. Es ging um Bücher. Genau gesagt um den Laden, in dem sie angeboten und um die besonderen Bedingungen, unter denen sie verkauft wurden. Ursprünglich, so erklärte mir der Schlafgestörte, hätte er keinerlei Sympathien für die Emanzen aus dem Erdgeschoss gehabt, die direkt unter seinem Schlafzimmer den neuen Buchladen »Nur für Frauen« betrieben, doch seit er Nacht für Nacht mit anhören musste, wie Männerstimmen den Laden verfluchten – man habe grundsätzlich nichts gegen die Frauenbewegung, solange sie nur schön rhythmisch wäre –, hatte er sein Herz für die Nachbarinnen entdeckt und grüßte sie freundlich. Den Laden sollte er trotzdem nicht betreten.
Zwei neue Geschäfte, zwei Zeitzeichen, zwei Klagemauern, zwei Verlockungen, zwei Gefahrenstellen, die ahnen ließen, wie eine sexistische Zukunft aussehen würde. Meine Bekannte hatte den Eindruck, dass Männer nicht mit dem »Weltknoten Sexualität« umgehen konnten – das waren nicht ihre Worte; sie meinte wohl, dass Männer ihre Triebe nicht unter Kontrolle hätten – und der Mann, der über dem Frauenbuchladen seine Ruhe haben wollte, konnte hinzufügen, dass sie ebenso wenig wüssten, wie sie mit der neu aufblühenden Frauenbewegung umgehen sollten. Mit der nächtlichen Ruhe war es jedenfalls vorbei. Es hatten sich zwei Abgründe aufgetan. Zwei Risse waren auf dem Tanzboden entstanden, auf dem sich die Geschlechter begegnen konnten. Beide Orte wirkten, als hätten feindliche Truppen erste Brückenköpfe errichtet. Man konnte es ahnen: Gemeinschaften, die bisher zusammengehalten hatten, würden zerfallen; die Liebe, wie man sie bisher kannte, würde einem absehbaren Ende entgegengehen.
Es waren Orte, die man meiden sollte. Ein junges Ehepaar, das sich in der Stiftskirche trauen ließ, würde bestimmt keinen Abstecher in das nahegelegene »Fachgeschäft« machen, um da »Hygieneartikel« für ihre Ehe einzukaufen. Ein Student würde dem Sexshop weder zusammen mit seiner Liebsten einen Besuch abstatten, noch mit Mitbewohnern aus der Wohngemeinschaft, die allgemein WG »Weh geh!« genannt wurde, damit das Weh und Ach des Alleinseins vergehe. Er würde den Laden auch nicht bei einem Spaziergang als neue Attraktion der Altstadt seinen Eltern vorführen, wenn die zu Besuch kämen. Der Sexshop störte die vertikalen und horizontalen Geschlechter-Verhältnisse gleichermaßen.
Der Frauenbuchladen auch. Mit meiner Freundin könnte ich den Laden nicht betreten, ich müsste draußen warten und würde ausgerechnet mit ihr darüber streiten, ob es so einen Laden überhaupt geben sollte. Ich würde mit meinem Vater kopfschüttelnd vor dem Schaufenster stehen und wir würden uns fragen, warum wir nicht hineingehen und Die Scham ist vorbei von Anja Meulenbelt oder Memoiren einer Tochter aus gutem Hause von Simone de Beauvoir kaufen könnten. Man bekam die Bücher auch anderswo, insofern war der Frauenbuchladen keine Bereicherung. Die Besonderheit lag allein darin, dass ein Mann unerwünscht war. Immerhin haben wir noch gestritten und die Köpfe geschüttelt. Tübingen ist Universitätsstadt. Da wurde viel geschwätzt und diskutiert.
Nun hat sich das Klima geändert. Wir sind bis auf die Knochen eingeschüchtert. Wir frösteln und halten uns bedeckt, als wäre Schnee gefallen und hätte sich meterdick über unsere Gespräche gelegt. Die Themen Feminismus und Pornographie berühren wir lieber nicht. Gender auch nicht. Ein wohlmeinendes Kompliment kann heute als sexistischer Angriff interpretiert werden; ein Ausdruck, der gestern noch unverfänglich war, kann heute schon als hate speech gelten. Im Rückblick kommt mir das Tübingen der Siebziger wie ein Naturschutzgebiet vor, in dem noch ein unbefangener Gedankenaustausch möglich war.
Heute werden – damals undenkbar – Professoren wie Gerhard Amendt, Ulrich Kutschera oder Martin van Creveld von aufgebrachten Studenten mit Trillerpfeife, die sich als Schiedsrichter aufspielen, oder von schlecht informierten Gleichstellungsbeauftragten an wissenschaftlichen Vorträgen gehindert, wenn sie im Verdacht stehen, den Feminismus zu kritisieren. Zunehmend trifft es auch Politiker, die als »liberal« gelten. Heute darf man nicht mal mehr sagen: Also, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Harald Schmidt bekennt, dass seine Shows heute nach einer Woche abgesetzt würden. Bei einer Veranstaltung mit dem SPD-Mitglied Thilo Sarrazin in Bremen musste die Polizei mit einem Mannschaftswagen anrücken, bei einer Lesung mit Birgit Kelle mit sechs. Nur jeder sechste Deutsche fühlt sich noch frei, im Internet beziehungsweise in der Öffentlichkeit seine Meinung zu äußern. Das Forschungsinstitut Allensbach hatte nachgefragt, ob man vorsichtig sein müsste. Muss man. Wir haben keine Klimakatastrophe, wir haben eine Meinungsklima-Katastrophe.
»Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«, heißt es bei Ludwig Wittgenstein im Tractatus logico-philosophicus. Der finnische Tango-König M.A. Numminen hat den Satz vertont und trägt ihn mit großer Orchesterbegleitung vor, als wollte er ein Zitat, das Voltaire nachgesagt wird, mit einem Ausrufezeichen versehen: »Was zu dumm ist, um es auszusprechen, das singt man.« Oder man schreit. Damals hatte es noch Aufschrei gegeben, nicht im Internet, sondern in den buckligen Gassen von Tübingen, da konnte man einen letzten Aufschrei in der Nacht hören:
»Oh, nein! Sex!«