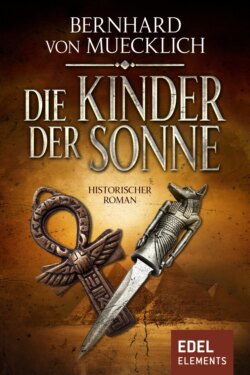Читать книгу Die Kinder der Sonne - Bernhard von Muecklich - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеDie Sonne ist längst untergegangen.
Ich habe auf meiner Terrasse gesessen und beobachtet, wie das Gestirn langsam am Firmament verschwunden ist. Es ist schon lange her, dass ich diesem faszinierenden und erhebenden Ereignis, alleine oder mit meinen Gästen, bewusst und in andächtigem Schweigen beigewohnt habe. Doch heute tat ich es, da ich wissen wollte, ob ich wenigstens bei diesem, von der Natur doch so großartig inszenierten Schauspiel, noch etwas empfinden würde. Rom als riesiger Schattenriss vor dem glutroten Sonnenball! Wahrhaftig, ein grandioser Anblick. Aber so sehr ich mich auch in diesen Anblick zu versenken suchte, meine Gefühle blieben stumm. Um ehrlich zu sein, hatte ich es auch nicht anders erwartet. Wann habe ich das letzte Mal etwas gefühlt oder empfunden? War ich dazu überhaupt je in der Lage? Ich dachte es einmal, aber auch das war wahrscheinlich eine Selbsttäuschung – eine von so vielen, denen ich in meinem Leben erlegen bin. Vielleicht war sogar mein ganzes Leben eine einzige Täuschung, ein ewig währender Tagtraum.
Mit Einbruch der Dunkelheit bin ich wieder ins Haus gegangen und eine Weile ziellos durch das Labyrinth der hohen Räume geirrt. Dabei ist mir erneut bewusst geworden, wie leer und kalt mir dieses Haus trotz der von mir in all den Jahren liebevoll gesammelten Kunstwerke und kostbaren Möbel erscheint. Vielleicht fällt mir das auch nur deshalb so deutlich auf, da ich in mir selbst jene Leere und Kälte verspüre, die mich eigentlich schon seit meiner Jugend des Öfteren berührt, und die nun, da ich mich entschlossen habe, alleine und zurückgezogen mein nahes Lebensende zu erwarten, vollständig von mir Besitz ergriffen hat. Nun, ich habe mich bis zum heutigen Tage recht erfolgreich dagegen wehren können, indem ich in der Vergangenheit ständig die Gesellschaft anderer Menschen gesucht habe. Das ist mir auch nicht sonderlich schwer gefallen, da ich als letzter und einziger Nachkomme einer alten und edlen Familie über schier unerschöpfliche materielle Reichtümer verfüge, die meine Vorfahren über viele Generationen hinweg angehäuft haben.
Der unverhoffte und allzu frühe Tod meiner Eltern – ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst die Feierlichkeiten zur Verleihung meiner Männertoga begangen, als erst mein Vater und kurz darauf auch meine Mutter von dieser Welt gingen – machte mich zum alleinigen Nutznießer dieses ungeheuren Besitzes, über dessen tatsächlichen Umfang ich mir im Übrigen bis heute noch keinen genauen Überblick verschafft habe. Es hat mich, ehrlich gesagt, auch nicht sonderlich interessiert, da ich für Zahlen und sonstige merkantile Dinge keinerlei Gefühl besitze. So habe ich denn eine der wenigen weisen Entscheidungen meines Lebens getroffen und das ererbte Vermögen in die berufeneren Hände einiger meiner Familie treu ergebenen Verwalter gelegt. Ich habe diese Entscheidung bis zum heutigen Tage nie bereuen müssen, da diese Männer meinen Besitz genauso behandelt haben, als wäre es ihr eigener. Verwöhnt, wie ich erzogen wurde, begann ich nun mein Leben in vollen Zügen und frei von materiellen Sorgen zu genießen. Ich war jung, und ich verspürte das dringende Verlangen, in all die fremden Länder zu reisen, von denen mir Kleanthes, mein griechischer Hauslehrer, den ich wie einen Vater zu lieben und achten lernte, so viel Wunderbares zu berichten wusste. Also begab ich mich in seiner Begleitung auf eine Reise, die uns zunächst nach Griechenland, dann nach Kleinasien und zum Schluss nach Ägypten führte und die über mehr als sechs Jahre dauern sollte. Ich studierte die griechische Baukunst in Korinthe und wandelte mit meinem Lehrer auf den Spuren der Sokratiker unter der kühlen, Schatten spendenden Stoa zu Füßen der majestätischen Akropolis von Athen. Dort besuchte ich auch die Ateliers der berühmtesten Bildhauer Griechenlands, deren Genius der göttliche Phidias ist.
An der sonnentrunkenen Küste Kleinasiens verweilten wir in Eilet und Ephesos, um dort den süßen Wein der hellenischen Philosophie und von dem würzigen Brot der ionischen Wissenschaften zu kosten. Und endlich Ägypten! Kremet – das schwarze Land, wie es in ihrer blumigen Sprache heißt! Ich wagte es, meinen Blick zu den Statuen der Gottkönige zu erheben, deren Antlitze in gemeißelter Entrücktheit der Ewigkeit entgegenträten, und ich fühlte ihre zeitlose Präsenz unter den hohen, lastenden Säulenfluchten ihrer Tempel, die in steinerner Erhabenheit an den Ufern des Leben spendenden Flusses in den ewig blauen Himmel ragten. In Sais unterwiesen uns die Priester des Thot in der Kunst der Hieroglyphen, sodass wir bald in der Lage waren, das überaus reiche Schriftgut dieser uralten Zivilisation zu lesen und den ihr innewohnenden Geist wenigstens annähernd zu begreifen. Auch beschäftigten wir uns in dieser Zeit mit der faszinierenden Götterwelt, die dieses Land seit über tausend Jahren in ununterbrochener Tradition beherrscht, und vertieften uns in die Schriften und Mysterien ihres äußerst komplizierten Totenkultes.
In Sais war es auch, wo ich zum ersten Mal erfuhr, dass ich eigentlich gar kein Römer bin, sondern zu einem Volk gehöre, welches schon lange vor dem Eintreffen der trojanischen Flüchtlinge Italien beherrscht und zu einer hohen kulturellen, wenn auch heute weithin vergessenen Blüte geführt hatte. Die Priester in Sais sammeln und hüten nämlich sorgsam seit Jahrhunderten nicht nur das Wissen um die Geschichte Ägyptens, sondern auch das aller übrigen Völker Europas. Ich bemerkte während unseres Aufenthaltes, dass ich von den Priestern im Gegensatz zu den anderen Fremden, wie etwa meine Landsleute oder sogar die als kulturell hochstehend bekannten Griechen, die sich gleich meiner dort aufhielten, um ihr historisches Wissen zu vervollkommnen, äußerst zuvorkommend und nahezu gleichberechtigt den Ägyptern behandelt wurde. Also beschloss ich, Sennofer aufzusuchen, einen der Ältesten des Kollegiums des Thot, um den Grund dafür zu erfahren. Lange schaute er mich darauf schweigend aus seinen dunklen Augen an, aus deren unergründlicher Tiefe die uralte Weisheit des Nillandes in geheimnisvoller Klarheit erglänzte.
»Wer bin ich«, sagte er dann sanft, »dass ich dir Antwort auf eine Frage geben sollte, deren Beantwortung das alleinige und heilige Privileg deiner Eltern wäre? Nun hörte ich allerdings zu meinem Bedauern, dass deine Eltern schon früh den Weg nach Westen beschritten haben und wohl deshalb keine Möglichkeit mehr hatten, dir über deine Vorfahren zu berichten. So werde ich denn, so gut ich es eben kann, ihren Platz einnehmen und dir das weitergeben, was ihnen zu tun verwehrt blieb. Höre also die Geschichte deiner Herkunft.«
Und so erfuhr ich, dass ich ein Rasna bin, also jenem sagenumwobenen Volk angehöre, welches die Römer Tusker nennen, die Griechen Thyrrenoi, die Ägypter aber Turuscha. Staunend vernahm ich, dass die Ägypter einzig sie unter den Völkern des Westens als kulturell ebenbürtig, ja sogar als verwandt erachteten, da die Rasna, gleich den Ägyptern, Kinder der Sonne seien. Die Sonne, belehrte mich Sennofer, trüge nämlich in sich einen weiblichen und einen männlichen Aspekt. Die Völker des Nordens verehrten die Sonne als ihre Mutter, während die Völker des Südens den Sonnengott als ihren Vater betrachteten. Die ursprüngliche Heimat der Rasna sei aber das Gestade des fernen Nordmeeres gewesen, von wo aus sie über Jahrhunderte hinweg die reichen Schätze ihres Landes, Bronze und vor allem den nur dort vorkommenden Bernstein, in den gesamten Mittelmeerraum verhandelten. Sogar bis an den Nil seien ihre Handelsexpeditionen gelangt, denn am Hofe der Pharaonen waren die Tränen der Sonne, wie der Bernstein in Ägypten auch genannt wird, höchst begehrt. Doch dann wurde ihr blühendes Reich wohl von einer fürchterlichen Flutkatastrophe heimgesucht, und ein großer Teil ihres Landes wurde vom Meer verschlungen. Voll Zuversicht seien sie mit ihren Schiffen – aber auch zu Lande – nach Süden aufgebrochen, in der Hoffnung, dort unter der Sonne des Mittags eine neue Heimat zu finden. Auf ihrem Wege trafen sie auf andere seefahrende Völker und verbündeten sich mit ihnen. Unter der Regierung des großen Pharao Ramses, vor über tausend Jahren also, tauchten diese Seevölker mit einer mächtigen Flotte vor der Küste Ägyptens auf und begannen dessen Einwohner mit Krieg zu überziehen. In schweren und verlustreichen Kämpfen gelang es Ramses jedoch, sie in einer großen Seeschlacht vernichtend zu schlagen, und so plötzlich, wie sie gekommen waren, verschwanden sie darauf auch wieder. Sie wandten sich nach Norden und irrten lange Zeit ziellos und angeschlagen über das Meer, bis sie für einige Jahrhunderte Asyl im Reich der Hethiter fanden. Aber dann, wieder erstarkt, bemannten sie aufs Neue ihre Schiffe und fuhren nach Westen, bis sie zu der fruchtbaren Küste Italiens gelangten, wo sie sich endgültig niederließen, den Boden urbar machten und Städte gründeten.
Handel, Kunst und Wissenschaft erlebten bei ihnen bald eine neue, ungeheure Blüte, lange bevor der Same der Kultur Griechenland erreichte. Doch als Rom, welches die Rasna einst vom Dorf zu einer mit wehrhaften Mauern umkränzten Stadt machten und seinen Bewohnern Könige und Gesetze gaben, sich gegen die milde Herrschaft der Tusker erhob, begann der unaufhaltsame Untergang dieser uralten Kultur.
»Du, mein junger Freund«, beendete Sennofer seufzend seine Erzählung, »bist nun der letzte deines Stammes. In dir fließt rein und unverfälscht seit Generationen das Blut der Seekönige der Vorzeit. Und mit dir wird es versiegen!«
Das Letzte sagte er ganz leise, wie zu sich selbst, und aus seinen Augen leuchtete der entrückte Glanz des Sehers.
Ich weiß nicht, wie lange ich bewegungslos auf meinem Schemel verharrt bin, gebannt durch die machtvolle Erzählkunst des Priesters, die mich eintauchen ließ in das unendliche Meer der Zeit. Als der Nebel vor meinen Augen sich endlich auflöste, und ich mich wieder in der Gegenwart fand, sah ich, dass ich allein war und nur das fahle Licht des Mondes in die Kammer schien.
Obwohl mich in den folgenden Tagen tausend Fragen zu dem Gehörten quälten, wagte ich es nicht, mich noch einmal an den alten Mann zu wenden, sondern versuchte vielmehr, einer inneren Eingebung folgend, die Antworten darauf in den Schätzen der Bibliothek zu suchen. Meine Neugier war nunmehr entfacht, und so stürzte ich mich mit Feuereifer in das Studium der zumeist uralten Papyri, die von den Geschehnissen jener Epoche berichteten.
Dabei fiel mir eine Zeichnung in die Hände, die, wie ich aus dem Text erfuhr, eine genaue Kopie eines Freskos war, welches sich in einem Tempel befand, den der Osiris Ramses zur Erinnerung an seinen Sieg über die Seevölker zu Ehren der Götter hatte erbauen lassen.
Dargestellt war die wild bewegte Szene einer Seeschlacht, in der sich Ägypter und die »Barbaren des Nordmeeres« auf das erbittertste bekämpften. Fasziniert betrachtete ich eingehend die Gestalten der nordischen Invasoren sowie deren Schiffe und Ausrüstung. Hoch gewachsene Menschen waren es, die die Ägypter um Haupteslänge überragten. Kronenartige Helme, aber vereinzelt auch einfache, mit zwei Hörnern verzierte Sturmhauben schützten ihre Köpfe, deren Haar zu einem Knoten über dem rechten Ohr geschlungen war. Lange, lanzettförmige Bronzeschwerter, Äxte und runde Schilde vervollständigten ihre Bewaffnung. Im Gegensatz zu den aus Flussschiffen entwickelten Galeeren der Ägypter war die Konstruktion ihrer ruderlosen Schiffe den zumeist stürmischen Verhältnissen ihres heimatlichen Ozeans auf das vortrefflichste angepasst. So wiesen die schmalrümpfigen Bootskörper vorne und achtern jeweils einen steil emporragenden Steven auf. Der Bug war mit einem geschnitzten Vogelkopf geschmückt, während das Heck in einem stilisierten Federsteiß endete. In meiner Fantasie sah ich die Schiffe dann auch, riesigen Seevögeln gleich, wie sie mit gebauschten Segeln und scheinbar schwebender Leichtigkeit die Wellenberge der tückischen Hochsee durchpflügten.
Je länger ich mich so in das Bild vertiefte, desto weniger fremd und weit entfernt erschien es mir. Ja, ich spürte sogar eine seltsame Vertrautheit mit den Bildern in mir aufkeimen, als ob ein vergessener Teil meines Ichs jene Epoche hautnah miterlebt hätte. Auch empfand ich Mitleid mit den heimatlosen Kriegern aus dem kühlen Norden, die, gepeinigt von der ungewohnten Hitze der sengenden Sonne des Südens, ihr Leben auf fremder Erde aushauchten oder von den Kriegern des Pharao unbarmherzig in die Sklaverei verschleppt wurden.
Anfänglich irritierten mich diese Gefühle und Visionen, die mich vordem noch nie heimgesucht hatten, sich aber nun immer häufiger während der Lektüre der alten Schriften zu jenem Thema einstellten. Doch mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und ließ meinen Geist ungehindert die Abgründe der Zeit überwinden, um mir so die Vergangenheit bildhaft vor Augen führen zu können. Auch Sagen und Märchen, die mir meine Eltern am Kindbett erzählten, entrissen sich bruchstückhaft meiner Erinnerung und fügten sich allmählich zu dem Mosaik einer Geschichte, die offenbar untrennbar mit meiner eigenen verknüpft war.
Bald schon musste ich allerdings enttäuscht feststellen, dass die historischen Quellen, die in Saids ansonsten so überreich sprudelten, für diesen Teil der Vergangenheit versiegt waren. Ich wollte jedoch alles über das Schicksal der Rasna wissen, und so begab ich mich zu den Hütern der Bücher und befragte sie, wo ich denn mehr darüber in Erfahrung bringen könnte. Die Priester verwiesen mich an die Bibliothek von Alexandria, die, wie mir Kleanthes bestätigte, als die größte und vollkommenste der bekannten Welt galt.
Dieser Vorschlag ließ mein Herz höher schlagen, hatte ich doch schon so viel Erstaunliches über jene schillernde Stadt im Nildelta gehört, jene Stadt, die von dem vergöttlichten Makedonen vor fast dreihundert Jahren gegründet worden war und seither als der Schmelzpunkt zwischen den Kulturen des Ostens und des Westens angesehen wurde.
Also war es beschlossen, und wir bereiteten freudig unsere Abreise nach Alexandria vor. Als ich mich von Sennofer verabschiedete, ermunterte mich dieser, meinen Forschungen gewissenhaft nachzugehen, und ermahnte mich eindringlich, das Wissen um mein Volk dereinst aufzuschreiben, da es sonst für die Nachwelt unwiederbringlich verloren gehen würde. Die Tage von Sais seien gezählt, verkündete er düster, und mit den Priestern würden auch die Bücher sterben. Auch würde all das, was ich in der Bibliothek von Alexandria noch vorfinden würde, in nächster Zukunft zu Asche werden. Die Prophezeiung des alten Mannes sollte sich zum Unglück für die Menschheit späterhin tatsächlich erfüllen, denn die Bibliothek fiel samt dem größten Anteil ihres unersetzlichen und unschätzbaren Inventars der fürchterlichen Feuersbrunst zum Opfer, die während der Kämpfe zwischen den Legionären des göttlichen Cäsar und den Söldnern des ptolemäischen Usurpators im Hafen der Deltametropole entfacht wurde.
Mir jedoch war das Glück beschieden, meinen Wissensdurst an den kostbaren Schätzen der alten Bibliothek uneingeschränkt stillen zu dürfen. Oh, hätte ich doch damals nur diese einmalige Gelegenheit bis zur Neige ausgekostet! Um wie viel reicher an Erfahrung und Wissen wäre ich heute! Gewiss, zu Beginn unseres Aufenthaltes befolgte ich die Mahnungen Sennofers und Kleanthes und begab mich täglich in die Bibliothek, um dort bis spät in die Nacht meine Studien zu betreiben. Mein anfänglicher Eifer wurde auch belohnt, denn ich erfuhr nicht wenig Aufschlussreiches über die Geschichte und Kultur meines Volkes. Doch dann – die Götter mögen dem unreifen Jüngling, der ich damals war, noch heute verzeihen – erlag ich den weltlichen Reizen und Vergnügungen, die diese Stadt in prallem Übermaß zu bieten hatte. Rom wirkt auf mich übrigens bis heute im Vergleich zu dieser leichtlebigen Perle des Hellenismus geradezu eng und provinziell.
Es fügte sich nämlich, dass ich mich mit Ktesippos anfreundete, einem lebensfrohen jungen Alexandriner, der wie ich täglich die Lesesäle aufsuchte, um die Geschichte Ägyptens zu studieren. Ktesippos entstammte einer der angesehensten Familien der Stadt, und es ließ nicht lange auf sich warten, da lud er mich zu einem Gastmahl ins Haus seiner Eltern. Dort lernte ich seine Freunde kennen, die mich, den Römer, mit offenen Armen in ihrem Kreis willkommen hießen. Nachdem ich ihnen erzählt hatte, weshalb ich mich in Alexandria aufhalten würde, nannten sie mich lachend einen törichten Bücherwurm und forderten mich auf, sie bei ihren nächtlichen Streifzügen durch die Stadt zu begleiten. Ich sollte Athene abschwören und vielmehr dem Dionysos opfern. Für die Erforschung der Vergangenheit bliebe noch genug Zeit im Alter, sagten sie, das Jetzt aber gehöre der Jugend. Ich ließ mich allzu bereitwillig von ihren verführerischen Reden überzeugen, zumal sie mir gleichzeitig all die Zerstreuungen und Lustbarkeiten, die diese Stadt einem reichen und verwöhnten jungen Mann, wie ich es war, zu bieten hatte, auf das verlockendste anpriesen. Schnell hatte ich so meine ernsten Vorsätze, mich um das Erbe meines Volkes zu kümmern, vergessen und traf mich stattdessen tagtäglich mit meinen neuen Freunden, mit denen ich nach und nach die sichtbaren, aber vor allem die verborgenen Reize dieser sinnenfrohen Metropole kennen lernte. Ohne Wirkung blieb der strenge Tadel des besorgten Kleanthes, der mir bei jeder Gelegenheit die Pflichtvergessenheit meinen Ahnen gegenüber vorwarf. Ich schlug seine Ermahnungen in den Wind, schalt ihn gar einen vergreisten Narren und verbrachte meine Tage weiterhin unverdrossen in der weinseligen Euphorie des Augenblicks. Kein Tag verging, ohne dass ich zu einem festlichen Gastmahl oder zu einem ausgedehnten Symposion eingeladen wurde – oder selbst dazu einlud, da ich mir schon in den ersten Wochen unseres Aufenthaltes eine schmucke Villa im feinsten Stadtteil von Alexandria gekauft hatte. Ich nippte nicht nur vom süßen Trunke des weltstädtischen Lebens, ich schüttete ihn geradezu gierig in mich hinein. Wohl wissend, dass ich mir um die nötigen Geldmittel keine Sorgen zu machen brauchte, gab ich mich in vollen Zügen all den Genüssen hin, die in Rom bis heute als lasterhaft und dekadent verschrien werden, während sie in Alexandria zum festen Bestandteil der mondänen Gesellschaft gehören. So verkehrte ich zwanglos in den Häusern der schönsten Hetären, die nicht nur in den exquisitesten Praktiken der körperlichen Liebe bewandert waren, sondern dazu noch die exklusiven Gäste mit ihrer glänzenden Bildung und ihrem sapphischen Intellekt unterhielten. Auch lernte ich mich der schwärmerischen Erotik samthäutiger und glutäugiger ägyptischer Knaben wollüstig hinzugeben. In allem was ich tat, trachtete ich dem luxuriösen Lebenswandel meiner Gefährten nachzueifern, oder sie gar hierin zu übertreffen. Zurückschauend kann ich unumwunden zugeben, dass ich mir diesen freizügigen Lebensstil, den ich mir während der drei Jahre, die ich in Alexandria verbrachte, zu Eigen gemacht hatte, bis heute nicht nur beibehalten, sondern ihn, trotz aller Verunglimpfungen, die ich deshalb durch die ehrenwerte römische Gesellschaft insgeheim ertragen musste, noch ständig verfeinert habe. Aber noch etwas anderes, Höheres als diese doch eher dem Weltlichen zugetanen Erfahrungen, prägte damals nachhaltig den Jüngling, der sich trotz der unzähligen materiellen und fleischlichen Gelüste, denen er zu jener Zeit nicht unfreiwillig ausgesetzt war, einen Weg in die Welt des Geistes und dessen Ideale ebnen wollte. Es war die Kunst, jene schönste, vollkommenste und wertvollste unter all den Gaben, welche die Menschheit seit ihrem Entstehen von den Unsterblichen verliehen bekommen hat. Als Knabe vermochte ich wohl die zarte Knospe in mir zu erahnen, doch in Alexandria erblühte mir die Rose des Apoll in all ihrer vielblättrigen Pracht, und ihr betäubender Duft entfesselte meine Leidenschaft, der ich bis zu diesem Tage in brennender Ergebenheit verfallen bin. Nirgendwo sonst auf dieser Welt sollte ich einen Ort finden, an dem die Musen eine glanzvollere Heimstätte gefunden hätten als zu Füßen der Feuer des Pharos. In der gleichen Vollendung, in der sich Theater, Dichtung und Musik der Hellenen mit den uralten Mysterienspielen des Ostens zu einer kristallenen Harmonie emporschwangen, leuchteten die pastellenen Fresken, die allenthalben die Räume der Villen und Tempel schmückten, in fast überirdischer Durchsichtigkeit. Auch die erhabenen Werke der Bildhauer zeugten mit ihrer marmornen Ästhetik von dem hohen Schaffensgeist ihrer Schöpfer, der in zwei Welten zu Hause war.
Ich hatte mich so sehr an das lichtvolle Leben dieser Stadt gewöhnt, dass ich beschlossen hatte, meinen Wohnsitz dort für immer einzurichten, als mich beunruhigende Nachrichten aus Rom erreichten und mich jäh aus meinen elfenbeinernen Träumen rissen. Polytes, mein alter getreuer Verwalter, dessen unschätzbare Dienste schon mein Vater zu würdigen wusste, war verstorben. Beigefügt war ein amtliches Schreiben des göttlichen Cäsar, der zu jener Zeit allerdings nur den eher profanen Titel eines Ädilen führte, dessen Inhalt mir in hartem Latein klar und eindeutig zu verstehen gab, mich unverzüglich nach Rom zu begeben, um meine Vermögensverhältnisse zu regeln und sie dem Zensus zwecks Neueinstufung meiner Steuerlast detailliert vorzulegen. Andernfalls, hieß es weiter, würde der Staat seine Hand während meiner Abwesenheit auf mein Vermögen legen. Die harte Realität hatte mich wieder eingeholt, und ich besaß wenigstens noch so viel Verstand, um dieser unmissverständlichen Aufforderung augenblicklich Folge zu leisten. Ich buchte die nächste freie Schiffspassage nach Rom, nicht ohne zuvor Ktesippos mit dem Verkauf meines Hauses samt dessen Inventar zu betrauen und ihn zu bitten, mir den Erlös zu überweisen.
Nachdem ich nach Rom zurückgekehrt und meinen Verpflichtungen dem Staat, den ich, nach allem, was ich über die traurige Geschichte meines Volkes gelernt hatte, nicht länger mehr als den meinen ansah, gebührend nachgekommen war, zog ich mich völlig ins Privatleben zurück und führte meinen alexandrinischen Lebensstil ungeachtet der prüden römischen Gesellschaftsnorm unbekümmert weiter fort. Wie um mir die hellen, glücklichen und fruchtbaren Tage meiner Jugend für immer zu bewahren, versammelte ich nach und nach einen Kreis junger Künstler und Intellektueller um mich, denen ich in meinem Hause die Gelegenheit bot, ihrem Genius und ihrer Schaffenskraft unbeschwert von materiellen Sorgen freien Lauf zu lassen. Zu diesem Zwecke ließ ich mein Elternhaus, welches meine Vorfahren vor Generationen auf dem bis heute spärlich besiedelten Esquilin errichtet hatten, von Grund auf renovieren und für diese Belange großzügig umbauen. Das für die herkömmlichen Verhältnisse in Rom schon sehr weitläufig angelegte Anwesen verfügte zwar über eine beträchtliche Anzahl von Räumen, die aber, bedingt durch den völlig überalterten Baustil, insgesamt viel zu klein und niedrig geschnitten waren, sodass das ganze Haus eng und bedrückend düster wirkte. Ich beauftragte den besten Architekten Roms – natürlich war es ein Grieche –, das Haus derart auszubauen, dass hohe, lichtdurchflutete Räume entstünden. Dazu kaufte ich einige umliegende Grundstücke auf, teils um auf ihnen die dafür notwendigen Gebäudeerweiterungen durchzuführen, teils um sie in fantasievolle Gärten zu verwandeln. Während des Umbaues brachte ich nicht nur meine eigenen geschmacklichen Vorstellungen ein, sondern ließ auch einigen meiner Künstlerfreunde bei der Gestaltung der Räumlichkeiten freie Hand, sich mit ihrem individuellen Stil zu verwirklichen. Für die Bildhauer ließ ich dazu eigens ein Atelier in Form eines kleinen, runden Pavillons errichten, welcher sich harmonisch in die zum Teil exotische Ästhetik der neu entstandenen Gartenlandschaft, die vor allem die Fantasie der Dichter und die Gedanken der Philosophen beflügeln sollte, einfügte. Auch ein kleines Odeum ließ ich nach meinen Vorstellungen in den Gärten erbauen, das an warmen Sommerabenden zum Schauplatz von Theaterstücken und der später von der Gesellschaft so hoch gelobten Dichterlesungen wurde.
So pflanzte ich abseits des grauen römischen Alltagslebens einen zarten Schössling jenes strahlenden Baumes der Kunst, von dessen süßen Früchten ich in Alexandria gekostet hatte, in die raue Erde am Ufer des Tibers.
Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, dass all das, was sich hinter den weißen Mauern meines nunmehr zu einer stattlichen Größe angewachsenen Besitzes tat, in den Mittelpunkt des misstrauischen Interesses der römischen Gesellschaft rückte. War es zunächst der unkonventionelle Baustil meines Hauses, der in seiner Vollendung mit jeder bis dahin in Rom vorherrschenden traditionellen Architektur brach, an dem sich die Gemüter erhitzten, so machten alsbald auch die wildesten Gerüchte um die angeblich zügellose Lebensweise seiner Bewohner die Runde.
Zuerst hinter vorgehaltener Hand, dann ganz offen, wurde von ausschweifenden Orgien gesprochen, die allnächtlich in meinem Hause stattfänden, während denen fremden, dämonischen Gottheiten in obszönen Ritualen gehuldigt würde. Das gipfelte zuletzt sogar darin, dass man mir und meinen Freunden unterstellte, im Geheimen mit diesem Tun die althergebrachten Tugenden Roms zu verhöhnen und damit sogar in umstürzlerischer Weise an den Grundfesten des Staates zu rütteln. Gerade Letzteres war nun nicht ganz ungefährlich für mich, gingen doch seit den Zeiten eines Marius oder Cinnas Menschen auf der Basis weit weniger brisanter Anschuldigungen ihres Lebens und ihres Besitzes verlustig. Diese bedrohliche Entwicklung im Denken meiner Mitbürger machte sich vor allem in ihrem Verhalten meiner Person gegenüber bemerkbar, wenn ich mich, was nicht allzu oft geschah, in der Öffentlichkeit zeigte. Waren es zu Anfang nur verständnislose oder auch oft missliebige Blicke, die mir, wann immer ich mich in meinen farbenfrohen und nach neuester alexandrinischer Mode geschnittenen Gewändern durch die Straßen der Stadt tragen ließ, zugeworfen wurden, so traf mich alsbald schon so mancher harte Kiesel, den man mir, begleitet vom gröhlenden Beifall der aufgebrachten Menge, entgegenschleuderte.
Durch diese wenig erfreuliche Wendung der Dinge sah ich mich vor die missliche Wahl gestellt, entweder Rom zu verlassen oder meine ursprüngliche Absicht, mein Leben in Muße und Beschaulichkeit zu genießen, fallen zu lassen und mein Haus der feinen römischen Gesellschaft zu öffnen. Ersteres wäre einer Flucht gleichgekommen, und mein nunmehr wieder erwachter etruskischer Stolz gegenüber den römischen Emporkömmlingen ließ mich diese Möglichkeit auch sofort verwerfen. Ich empfand es im Gegenteil geradezu als mein natürliches Recht, in dieser Stadt, an deren Entstehung und Aufstieg mein Volk nicht unmaßgeblich beteiligt war, zu leben. Also entschloss ich mich, den Sprung nach vorne zu wagen und meine Hand in den Rachen der Wölfin – welche im Übrigen ursprünglich ein etruskisches Staatssymbol war – zu legen. Ich begann damit, in meinem Haus prunkvolle Gastmähler auszurichten, zu denen ich nach und nach die Reichen und Mächtigen Roms einlud. Dabei rechnete ich mit der sensationslüsternen Neugier, die dieser Gesellschaft schon immer zu Eigen war, und selbstverständlich mit der magischen Anziehungskraft, die meine skandalumwitterte Person übrigens bis heute auf jene Kreise ausübt. Meine damals schon sehr ausgeprägte Erfahrung mit den Abgründen der menschlichen Seele ließ mich auch nicht im Stich, denn alles, was Rang und Namen hatte, fand sich bei mir ein: Crassus, Pompeius oder Lucullus, sie alle beehrten mein Haus mit ihrer erlauchten Anwesenheit, um dort, wie sie hofften, von der süßlichen Lasterhaftigkeit des Orients zu kosten und so für eine Weile Ablenkung von ihrem catonischen Alltag und ihren vestalisch tugendhaften Ehefrauen zu finden. Und ich tat das meinige, sie hierin nicht zu enttäuschen. Ich erquickte ihre Sinne mit den erlesensten Gaumenfreuden und den edelsten Weinen und erfreute sie mit den lasziven Darbietungen meiner alexandrinischen Tänzerinnen. Fraglos begründete ich damals meinen bis zu diesem Tage fortbestehenden Ruf, ein dekadenter, in sich verderbter und lasterhafter Mensch zu sein, der so gar nichts mit den cincinnatischen Idealen eines echten Römers gemeinsam hatte. Auch späterhin, als ich längst als der ernste Förderer und Wegbereiter der schönen Künste, die bis dahin in dieser Stadt als eher anrüchig und zersetzend betrachtet wurden, angesehen war, blieb mir dieser Ruf erhalten. Immerhin gelang es mir aber dadurch zu beweisen, dass meine Lebensweise bar jeder politischen Ambition war, und man ließ mich fortan weitgehend unbehelligt in meiner Welt leben. Anfangs dachte ich, dass ich für sie die Rolle eines Narren verkörpern würde, dessen Spiegel ihnen immer wieder mahnend vor Augen führen sollte, was ein ausschweifendes Leben in Luxus und Völlerei aus einem Menschen machen kann. Doch in Wahrheit wurde ich eher zu ihrem schlechten Gewissen, welches man ja bekanntlich braucht, um sich seines guten bewusst zu werden. Ich meine das weniger auf meinen verruchten Lebenswandel bezogen als auf die Tatsache, dass ich ein Tusker bin, dessen bloße Existenz sie immer wieder peinlich daran erinnerte, wie unrühmlich sie sich diesem Volk gegenüber, dem sie letztendlich ihre Stadt und ihre Kultur zu verdanken haben, über die Jahrhunderte hinweg verhalten hatten.
Tatsächlich vermied man es tunlichst, in meiner Gegenwart dieses heikle Thema auch nur annäherungsweise zu berühren.
Rückschauend betrachtet, war das aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Grund, warum die meisten von ihnen mich bis zu diesem Tage nie wirklich als einen der Ihren angesehen haben, so sehr ich mich anfänglich auch darum bemühte. Nicht dass ich deshalb gemieden wurde, im Gegenteil, mit den Jahren gehörte es geradezu zum guten Ton, in meinem Hause zu verkehren, ja, man buhlte förmlich danach, zu meinen viel gerühmten Gastmählern eingeladen zu werden. Zu Anfang schmeichelte mir das ungemein, bis mir irgendwann schmerzlich bewusst wurde, dass das Interesse meiner illustren Gäste weniger meiner Person galt als vielmehr meinem Reichtum, von dem sie auf diese Weise auf das angenehmste profitierten, ohne selber ihren Geldbeutel strapazieren zu müssen. Wussten sie doch, dass ich zum einen mein Haus nur äußerst ungern verließ, und waren sie doch zum anderen allzu bereitwillig der Meinung, eine Einladung ihrerseits könne, gemessen an dem exotischen Luxus, der sie bei den von mir ausgerichteten Festlichkeiten immer wieder in bewunderndes Erstaunen versetzte, nur eine Beschämung meiner Person darstellen. In gewisser Weise hatten sie damit sogar Recht, denn in der Tat wirkten die wenigen Einladungen, denen ich Folge leistete, eher bemüht auf mich und zeugten leider häufig von der protzigen Geschmacklosigkeit der zumeist neureichen Gastgeber, zumal der künstlerisch intellektuelle Aspekt, auf den ich großen Wert lege, hierbei kaum zur Geltung kam.
Mit der klaren Gewissheit dieser Erkenntnis begann ich also von da an nach außen die Rolle des skurrilen Gecken zu spielen, dessen materielle und intellektuelle Extravaganzen von der feinen römischen Gesellschaft zwar, wie um ihre aus provinzieller Engstirnigkeit geborene Missgunst zu ummänteln, mit überschwänglichen Lobeshymnen toleriert wurden, dem man aber letztendlich, als einem Fremden in ihrer Mitte, echte menschliche Wärme versagte.
Natürlich erfuhr ich von all den Künstlern, wie etwa Horaz, Sallust oder dem unglückseligen Ovid, deren Förderung ihrer göttlichen Begabungen ich zu meinem Lebensinhalt gemacht hatte, eine tiefe, fast kindlich liebende Dankbarkeit, aber nur mit einem Menschen verbindet mich eine bis zu diesem Tage andauernde und von beiden Seiten als innig empfundene Freundschaft. Es ist Oktavian, den sie heute Augustus nennen. Ich kann mich sehr genau an den Tag erinnern, an dem ich ihm das erste Mal begegnet bin. Es war ein Jahr vor der Ermordung seines Adoptivvaters, des vergöttlichten Cäsar, und Oktavian war damals ein blasser, pickliger Jüngling, der gerade erst achtzehn Jahre alt geworden war. An diesem lauen Frühsommerabend veranstaltete ich eine Dichterlesung in meinem Auditorium, zu der ich der Form halber auch Cäsar einlud, der sich zu diesem Zeitpunkt, was selten der Fall war, in Rom aufhielt. Ich rechnete überhaupt nicht mit seinem Kommen, da der Göttliche bisher nie auf meine Einladungen reagiert hatte, weil seine mannigfaltigen Pflichten dem Staat gegenüber ihm kaum Zeit zu solchen Zerstreuungen ließen. Wie erstaunt war ich deshalb, als der Göttliche in Begleitung seiner Frau Calpurnia und seines jüngst adoptierten Zöglings ganz unvermutet dann doch in meinem Haus erschien und, ohne viel Aufhebens um seine Person zu machen, zwischen meinen Gästen Platz nahm. Ich muss gestehen, dass ich in dem Maße, wie ich im ersten Moment vor dem Charisma der Macht, das den Julier umgab, erschauerte, im weiteren Verlauf des Abends von dem mondänen Charme dieses Mannes überrascht und völlig in Bann geschlagen wurde. Bei Oktavian indes, der sich anfänglich äußerst zurückhaltend, ja geradezu scheu zeigte, faszinierte mich bald schon der für sein Alter ungewöhnlich wache und scharfe Verstand, den er während eines philosophischen Disputs über Platons Politeia, der sich zu vorgerückter Stunde zwischen einigen meiner Gäste entspann, an den Tag legte. Selbst Cicero, der an diesem Abend ebenfalls in meinem Hause weilte und sich an dem Disput beteiligte, zollte den klugen, aber in achtungsvoller Bescheidenheit vorgebrachten Kommentaren des Jünglings zu diesem doch recht anspruchsvollen Thema seinen anerkennenden Beifall. Kurz bevor er sich von mir verabschiedete, bat mich Cäsar, ihm und den Seinen mein Haus und meine Kunstsammlung zu zeigen, von der er schon so viel Rühmenswertes gehört hätte.
Während ich ihn also, begleitet von Calpurnia und Oktavian, durch mein Haus führte, konnte ich zu meiner freudigen Überraschung feststellen, dass der Göttliche meine kostbaren Sammlerstücke mit einem feinsinnigen Kunstverstand betrachtete, der weit über dem stand, was ich sonst von meinen römischen Mitbürgern gewöhnt war. Danach bedankten sie sich ausgesprochen herzlich ob der ihnen von mir so reichlich gewährten Gastfreundschaft und schickten sich gerade an, mein Haus zu verlassen, als Oktavian mich unvermittelt fragte, ob er nicht öfter zu mir kommen dürfte, da er meinen Lebensstil bewunderte und von der lichten Atmosphäre, die in meinem Hause herrschte, ganz verzaubert sei. Nur zu gerne entsprach ich seiner Bitte, denn mir gefiel die liebenswürdige und lautere Art, die seinem Wesen noch heute innewohnt. Natürlich fragte ich Cäsar nach seiner Zustimmung, die er auch ohne zu zögern gab. »Geh nur oft zu diesem Etrusker, mein Sohn! Hier kannst du vieles Schöne und Gute für dein Leben lernen!«, ermunterte er ihn noch lachend, dann gingen sie. Von diesem Tag an besuchte er mich fast täglich, und so wurde ich mit den Jahren nicht nur zu seinem Mentor, sondern vor allem zu seinem Freund. Auch als er später in den Wirren des Bürgerkrieges damit beschäftigt war, das Erbe seines Vaters zu verteidigen und danach zum ersten Bürger des Staates wurde, vergaß er es nie, mich, so oft es seine wahrlich knapp bemessene Zeit zuließ, aufzusuchen, um sich bei mir verwöhnen zu lassen oder sich mit mir über anstehende politische Entscheidungen zu beraten. Letzteres war ihm besonders deshalb wichtig, da er um meine neutrale Haltung dem Staat gegenüber wusste. Bisweilen übertrug er mir auch heikle diplomatische Missionen, weil ich der Einzige in seiner nächsten Umgebung war, dem er freundschaftlich verbunden war und der deswegen sein uneingeschränktes Vertrauen genoss, von seiner Frau Livia einmal abgesehen. Auch war ich der Einzige, den er an seinem nach außen sorgsam abgeschirmten Familienleben teilhaben ließ. Und er ist der einzige Mensch, der mich jetzt, da ich alt geworden bin und mein Körper langsam in einem zehrenden Siechtum verfällt, fast täglich besucht, um mich mein Leiden und meine innere Leere und Kälte in der vertrauten Heiterkeit unserer Gespräche wenigstens für ein paar Stunden vergessen zu lassen. All die anderen, die unter meinem Dach gefeiert, meine Großzügigkeit gepriesen und mich fortwährend ihrer dankbaren Freundschaft versichert haben, sie alle blieben meinen Einladungen in den letzten zwei Jahren immer zahlreicher mit zum Teil äußerst fadenscheinigen Entschuldigungen fern und vermieden es geflissentlich, dem kranken alten Prasser und Knabenschänder, für den sie mich im Grunde ihres Herzens immer gehalten haben, angesichts meiner immer deutlicher zu Tage tretenden schwärenden Krankheit nun ihrerseits ihr Haus zu öffnen. Vielleicht, dass sie in ihrer Häme meine Leiden als gerechte Strafe der Götter für meinen verderbten Lebenswandel ansahen. Wie muss es sie allerdings im Nachhinein beschämen, dass ausgerechnet ihr Princeps, ihr Augustus mich nicht hat fallen lassen!
Aber er ist es auch, der mich seit geraumer Zeit bestürmt, die Geschichte meines Volkes aufzuschreiben, was ich seit jenen fernen Tagen in Alexandria trotz der Ermahnung Sennofers bisher so sträflich verabsäumt habe. So mögen die Götter meiner Vorfahren nunmehr meinem Geist und meiner Hand Kraft verleihen, um während der Zeit, die mir vielleicht von ihnen noch vergönnt ist, all das niederzuschreiben, was ich einst darüber erfahren habe, damit das Andenken an den Ursprung und das Erbe der Rasna nicht der Vergessenheit anheim fällt.
So erfülle ich, Kaie Kilnie Maeknas, aus dem Geschlecht des Tarchun Rumach, den die Römer Maecenas den Glücklichen nennen, den Eid, den ich einst nach dem Tod meiner Eltern geschworen hatte.