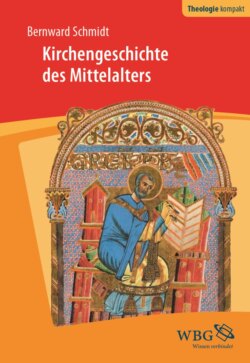Читать книгу Kirchengeschichte des Mittelalters - Bernward Schmidt - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die britischen Inseln
ОглавлениеIrland war immer an der Peripherie des Römischen Reiches gelegen. Die Quellen lassen zwar Rückschlüsse zu, dass es bereits im 4. Jahrhundert eine gewisse christliche Struktur auf der Insel gegeben haben muss, doch ist erst das Wirken des Nationalheiligen Patrick im 5. Jahrhundert in den Quellen einigermaßen zu fassen. Patrick stammte – eigenen Angaben zufolge – aus einer christlichen Familie in Britannien, sein Großvater war Presbyter, sein Vater Diakon gewesen. Nachdem er mit 15 Jahren nach Irland verschleppt worden war und dort als Viehhirt gearbeitet hatte, gelang ihm die Flucht in die Heimat, wo er sich wohl seiner Berufung zur Mission in Irland klar wurde. Ob Patrick selbst Bischof war, ist unklar, doch wird er in der Hagiographie des 6. Jahrhunderts zum eigentlichen Missionar Irlands.
Besonderheiten der irischen Kirche
In jedem Fall entwickelte die frühmittelalterliche irische Kirche einige Besonderheiten, die durch ihre Missionare auch auf den Kontinent gebracht werden sollten. Aufgrund der kleinteiligen Herrschaftsstruktur Irlands mit rund 150 Kleinkönigtümern, aus denen sich allmählich fünf größere Herrschaftsgebiete herausbildeten, war die irische Kirche nicht um städtische Bischofssitze, sondern um Klöster herum strukturiert und wurde letztlich von deren Äbten geleitet. Das Bischofsamt verlor dagegen an Autorität, so dass letztlich ein dem Abt unterstellter Mönch des jeweiligen Klosters diese Funktion bekleidete. Bedeutung hatten die Klöster sowohl als regionale Wirtschaftszentren, die über eine große Zahl an Arbeitskräften verfügten und so zur Kultivierung des Landes beitrugen, als auch durch ihr Bildungsmonopol und ihre hochwertige Handschriftenproduktion. Zu den Sonderbräuchen der irischen Kirche gehörte ferner ein abweichender Ostertermin, der erst im 8. Jahrhundert zugunsten des andernorts eingehaltenen römischen Termins abgeschafft wurde oder eine eigene Bußpraxis. Buße war für die Iren eine beliebig wiederholbare Leistung, wobei eine der Verfehlung möglichst exakt entsprechende Buße auferlegt wurde. Um diese „Tarifbuße“ zu ermöglichen, wurden in Bußbüchern Vergehen und Strafen aufgelistet und abgewogen.
Quelle
Aus dem Bußbuch des Bischofs Halitgar von Cambrai, um 830
Hermann Josef Schmitz, Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren. Nach handschriftlichen Quellen dargestellt, Düsseldorf 1898, ND Graz 1958, S. 294–400.
1 Wenn ein Kleriker jemanden tötet, soll er zehn Jahre büßen, davon drei bei Wasser und Brot. Ein Laie soll drei Jahre büßen, davon eines bei Wasser und Brot. 29 Wenn ein Kleriker einen Meineid leistet, soll er sieben Jahre büßen, davon drei bei Wasser und Brot; ein Kleriker drei, ein Subdiakon sechs, ein Diakon sieben, ein Priester zehn, ein Bischof zwölf Jahre.
32 Wenn ein Laie Liebeszauber betreibt und niemand zu Schaden kommt, soll er ein halbes Jahr büßen; wenn es ein Kleriker ist, ein Jahr bei Wasser und Brot; ein Diakon drei Jahre, davon eines bei Wasser und Brot; ein Priester fünf Jahre, davon zwei bei Wasser und Brot.
90 Wenn jemand ein Pferd oder ein Rind […] oder Kleinvieh, das eine ganze Familie ernährt, stiehlt, soll er vier Wochen fasten.
Dauerhaft wirksam aber wurde die wiederholbare Privatbeichte, die durch die irischen Missionare ihren Weg aus dem Mönchtum in die kirchliche Praxis nahm. Sie wurde demzufolge nicht als Übung zur Besserung aufgefasst, sondern als Strafe, die der begangenen Tat zu entsprechen hatte. Fragen nach der Absicht des Sünders bei der Handlung oder nach der Reue traten gegenüber der Quantifizierung in den Hintergrund. Mit der Quantifizierung der Buße hängt die Zählbarkeit von Frömmigkeit bzw. frommer Leistung eng zusammen (vgl. Kap. X). Diese Gedanken wurden durch die irischen Missionare auch auf dem Kontinent verbreitet und gingen so in das westliche christliche Erbe ein. Buße und das Bemühen um zunehmende Christus-Ähnlichkeit lagen dem Gedanken der peregrinatio propter Christum (Wanderschaft um Christi willen) zugrunde, aufgrund dessen irische Mönche nach Schottland und auf den Kontinent zogen. Columba (d. Ä.) etwa gründete im 6. Jahrhundert das Kloster Iona und missionierte von dort Schottland; Columban (d. J.) wurde zum bedeutendsten irischen Missionar im fränkischen Reich.
Britannien
Für Britannien ist ein dreifacher Ursprung des Christentums anzunehmen: Romanische Bevölkerungsgruppen dürften das Christentum auch in den Wanderungen der Angeln, Sachsen und Jüten bewahrt haben; Gleiches gilt für die keltische Bevölkerung, wo sich ebenfalls das von den Romanen übernommene Christentum weiterentwickelte. Schließlich erfuhr das Christentum durch die von Papst Gregor I. (590–604) initiierte Mission neuen Aufschwung.
Die Ausgangslage dafür war insofern günstig, als der heidnische König Aethelbert von Kent mit der fränkischen Königstochter Bertha verheiratet war, einer Christin. Die Mission in Britannien diente indirekt also auch der engeren Bindung des fränkischen Reiches an Rom. Zum Leiter der Mission ernannte Gregor den Mönch Augustinus, dessen Auftrag sich auf das „Volk der Angeln“ bezog, womit wohl die neu geordneten Herrschaftsgebiete in Britannien gemeint waren. Durch den päpstlichen Auftrag, aber auch die Briefe, die Augustinus nach Rom schrieb, wurde seine Mission eng an das Papsttum gebunden. Zugleich band Augustinus seine 597 begonnene Arbeit an die jeweiligen Herrscher, besonders König Aethelbert, deren Unterstützung für die Mission von essentieller Bedeutung war. Um die Wichtigkeit der Taufe Aethelberts zu unterstreichen, verglich Papst Gregor ihn mit Kaiser Konstantin – sicherlich ein Topos, aber signifikant. Zugleich nutzten Aethelbert und andere Oberkönige die Mission für politische Zwecke. Indem sie als Taufpaten anderer Adliger auftraten, schufen sie eine geistliche Verwandtschaft, festigten ähnlich wie bei Heiraten Beziehungen oder bekräftigten Abhängigkeitsverhältnisse. Das Christentum bot darüber hinaus die Möglichkeit zur Vernetzung mit den fränkischen Herrschern und dem Papsttum. Andererseits konnte auch der in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts noch starke Widerstand gegen das Christentum politisch motiviert sein.
Versammlung von Whitby
Nach Augustinus’ Tod (605) übernahm sein Mitarbeiter Paulinus die Aufgabe der Mission und dehnte zugleich das Missionsgebiet weiter nach Norden aus. In Northumbria entstand mit York der zweite englische Erzbischofssitz nach Canterbury. Gleichzeitig entwickelten sich im Norden Konflikte durch die Präsenz der vom Kloster Iona ausgehenden irischen Mission. Nachdem das Christentum um 660 in den Hegemonien Britanniens fest verankert war, versammelte das Königshaus von Northumbria Vertreter beider Richtungen zu einem Streitgespräch in Whitby (667), als dessen Ergebnis die römische Richtung bestätigt wurde. Auf diese Weise wurde nicht nur die Einheitlichkeit des Christentums im Norden Britanniens hergestellt, sondern auch die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau kirchlicher Strukturen unter Erzbischof Theodor von Canterbury (669–690) geschaffen. Canterbury entwickelte sich unter Theodor zum organisatorischen und – aufgrund der Einrichtung einer Schule – intellektuellen Zentrum der britischen Kirche, dessen enge Rombindung erhalten blieb.