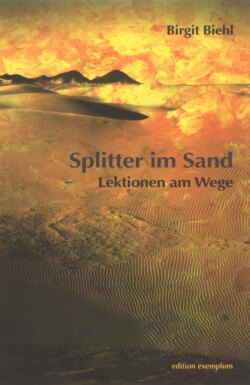Читать книгу Splitter im Sand - Birgit Biehl - Страница 3
Fortbewegungen I
Оглавление»Wenn der eigene Richtungssinn dem Kompaß widersprechen sollte, wiederholt man lieber die Messung. Daß der Kompaß mehr Vertrauen verdient als das Gefühl, merkt man überzeugend, wenn man einem Weg folgt, der sich unmerklich krümmt …« Wolfgang Linke, Orientierung mit Karte, Kompaß, GPS
Nach Tagen quälender Schwüle gottlob ein kühlerer Morgen, ein Aufbruch zitternd vor Neugier, mit viel zuviel Gepäck, wie immer weiß ich, dass es sich schon in nächster Zeit wundersam reduzieren wird. Mann und Sohn sind nicht glücklich, haben sich lediglich abgefunden. Entschlossene Umarmung am Bahnhof, hinter den guten Wünschen kommt keine Trauer auf, nur Spannung. Der ›Traumpfad‹ beginnt mit den entscheidenden fünf Minuten Verspätung, beim Umsteigen in Viersen ist es schon passiert, der Zug nach Venlo fährt an, eine Stunde Wartezeit. Am Nachmittag in Antwerpen entscheide ich mich schnell für ein billiges Hotel im Zentrum, noch ungewohnt ist die Last auf dem Rücken, ›Hôtel Billard‹ an Astrid Plein, na ja. Im Schritttempo ist die Stadt lebendig, mitteilsam, gelassen. Ausmeldung am Hafenamt, schauerlich die fratzenhaften Steckbriefe von gesuchten Arabern auf den Plakaten, noch einmal richtig mosselen essen, dann los mit dem Taxi an Kai 738, ich habe noch nie einen so großen Hafen gesehen. 15 Uhr: keine ›MV Kaduna‹, Anruf bei der Reederei: Sie kommt erst morgen Abend, also zurück, ›Hôtel Billard‹, umso besser, Antwerpen feiert van Dyck.
Zwischen Museum und St. Pauluskirche die Mannschaften englischer und griechischer Kriegsschiffe, überall sieht man in kleinen Gruppen Matrosen mit Sony-Kartons unter dem Arm durch die Stadt laufen, friedliche Zeiten. Im Paulus-Viertel überraschen schon vormittags die Nutten hinter den kleinen Fenstern, eine von ihnen mit einer breiten Laufmasche in ihrem schwarzen Strumpf. Überall Musik auf den Plätzen, ich habe viel Durst und kein belgisches Geld, stoße auf den kleinen Trinkwasserbrunnen vor dem Rubens-Haus, ein gutes Omen. Ganz langsam wächst es heran, keine Bleibe, kein Geld, sofort wachsen dem Überlebenswillen Flügel, bei C&A finde ich, Einkauf mimend, eine Toilette und eine neue Plastiktüte, ich weiß, so fängt alles an. Immer wieder treffe ich auf Monsieur Moussa in seinem farbigen Boubou, Dauergast im ›Hôtel Billard‹, nicht einmal der einarmige Rezeptionist weiß etwas über ihn. Um 21 Uhr an Pier 738 kein Schiff, niemand an den Kränen weiß Bescheid, zu allem entschlossen lege ich mich im Schlafsack unter einen Kran. Gegen zehn erscheint ein Lastwagen aus Hamburg mit Material für ›MV Kaduna‹, gemeinsam warten wir im Führerhaus. In der anbrechenden Dunkelheit legt riesengroß das Containerschiff an der Pier an, ich stapfe im Dunkeln die schwankende Gangway hoch, ein Steward zeigt mir meine Kammer, owner’s appartment direkt unter der Brücke mit überwältigender Aussicht. Die ganze Nacht durch wird im Akkord ent- und beladen, eineinhalb Schichten lang. Über den Containern wird eine Lage Gebrauchtwagen verladen und verzurrt, viele Mercedes 200 D, etliche schrottreif, einige offensichtlich geklaut, die meisten für Nouakchott, faszinierend ist die schnelle, präzise Arbeit mit den mobilen Kränen. Am nächsten Abend legen wir ab, drehen mit Schlepperhilfe im Hafenbecken, dann mit slow ahead in die Schleuse, verheißungsvoll das gleichmäßige Maschinengeräusch unter mir. Im kleinen Salon nebenan finde ich einen Martha Grimes, den ich noch nicht kenne.
›MV Kaduna‹, benannt nach der Stadt, dem Fluss, der Provinz in Nigeria, Schiffsregister CCNI Anakena, Kvaerner Warnow 1995, Reederei Transeste, im regelmäßigen Westafrika-Dienst, in der Mannschaftsliste werde ich als stewardess geführt. In der Nacht verlassen wir die Scheldemündung, fahren am Morgen mit 17 Knoten durch die Straße von Dover, Hovercraft und P&O-Fähren kreuzen den Kurs, in der Morgensonne glänzen die Kreidefelsen, an Backbord die Fähre von Roscoff. Ich habe mich im Brückeneck eingerichtet und mir einen souveränen Arbeitsplatz für die nächsten 11 Tage geschaffen. Die See ist glatt, sehr blau, ich erarbeite mir das Kapitel ›Orientierung‹ für Karten- und Kompassstudium. Die nächsten Tage bringen Arbeit im Office, an Telefon und Telex, Schulungsmaterial ist zu kopieren, englische Berichte von Schiffsunfällen sind zu übersetzen, für den Master arabische Standardsätze für die Kommunikation mit Zoll, Polizei und Hafenbehörde in Mauretanien zu erarbeiten, wir üben die Aussprache ein. Während der langen Brückenwachen kreisen die Geschichten: Vor sechs Monaten hat es auf dem Schiff eine Meuterei gegeben, ein Seegerichtsprozess steht an. 1998 sind weltweit 57 deutsche Seeleute auf Schiffen ermordet worden … An Bord hört man auf allen Stationen unsägliches englisches Kauderwelsch, in der Mannschaft ist kein Deutscher mehr, so entstehen erhebliche Verständigungsprobleme. Leicht rollende See, ich erarbeite die Unterlagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie über Missweisungen in West-Afrika, das Wiegen wird zum Lebensgefühl. Immer wieder die Treppen, poop deck, 2nd bridge deck, boat deck, superstructure deck, klar ist diese Welt der Schiffe, unabweisbar die Hierarchie, geregelt die Konflikte fern der Welt an Land, hier gibt es Muße, sich selbst in den Blick zu nehmen. Arbeit mit dem Kompass, Orientierung am Kreuz des Südens, noch ist es Übung, noch ist es Spiel. Den ganzen Tag begleiten uns Walschulen, die Atemfontänen sprühen dicht neben dem Schiff. 12 Uhr La Rochelle, Kurs 202, 15 Uhr Bordeaux, ein großes Segelschulschiff an Backbord, Radio Finisterre meldet sich, 19 Uhr La Coruña, Kurs 209.
Dienstag, Kurs 198, seit Stunden außer uns kein Schiff mehr, ich erledige Übersetzungen von Prozessfällen, schreibe am Computer. 10 Uhr Peniche, die Berlengas! 1973 haben wir hier, kurz vor der Revolution, Urlaub gemacht, seltsam der Blick von See aus. Der chief engineer und ein philippinischer Matrose haben Geburtstag, am Nachmittag zaubert der Steward eine schauerlich süße Nutellatorte, abends gibt der Master für jeden zwei Flaschen Bier aus, tatsächlich Holsten Edel, Alkohol ist streng unter Verschluss, dann Party in der Mannschaftsmesse, das bedeutet Karaoke aus 15 Filipinokehlen.
Kurs 198, seit gestern keinerlei Schiffsbegegnung mehr, gegen Mittag ein leerer Tanker Richtung Libyen, Sturmtief 9–10 über dem Atlantik, wir sind gerade aus der Zone heraus, sehr ruhige See, warm, 18 Knoten. Herrlich das Baden im pool, einem aufgeschnittenen Container, vier Züge hin, vier Züge zurück. Casablanca! Der chief engineer nimmt mich mit in die Maschine, vier Decks tief bis zur Nockenwelle, eine heiße, laute Konstruktion, die täglich 350 l Schmieröl frisst, faszinierend Kessel, Pumpen, Generatoren, Wasserentsalzung, Schmutzwasseraufbereitung, Computerkontrollprogramme für Maschinen und Elektrik. Nachmittags Rost kratzen, schleifen, schmirgeln, reinigen, fegen als Vorbereitung für das Streichen, Kopieren von Zollpapieren; Kompass-Übungen, als ich mit allem fertig bin, magnetisch-Nord, geographisch-Nord, Seekarten-Nord.
Donnerstag, den ganzen Tag nur zwei Schiffe gesehen, Zeit zum Erzählen von Schauergeschichten. Alle waren sie dabei, der Master, der chief engineer, Cuba während der Revolution, Kneipen am Amazonas, Brutalitäten in Nigeria. Wilder arabischer Seefunk aus dem Lautsprecher, ein Fax aus London über die Seegerichtsverhandlung. 4 Uhr früh: Ich habe mir den Wecker gestellt, um die Durchfahrt durch die Canaren zu sehen, nach all der Einsamkeit lange Lichterketten auf beiden Seiten mitten im Meer. Verdrängte Bilder tauchen auf, mein Vater bei seiner Verhaftung wegen Beihilfe zum Mord an Juden, um 4 Uhr morgens in unserer Wohnung in Hamburg, auf der Toilette bewacht von einem dunklen bleichen jungen Mann, das Hosenträgerkreuz auf dem Rücken meines Vaters, der bei offener Tür vor der Toilettenschüssel steht, ich, 16-jährig, entsetzt in der Tür meines Zimmers gegenüber. Jahrzehntelang habe ich dieses Bild vergraben, ich muss es zulassen, damit es vergehen kann.
Den ganzen folgenden Tag arbeiten wir daran, das Schiff von außen unzugänglich zu machen, die Außentreppe zur Brücke wird abgeschraubt und hochgezogen, Piraten haben in diesen Breiten Schiffe geentert. Ich bekomme Order, die Fenster in meiner Kammer zu schließen und unter keinen Umständen die Tür zu öffnen. Mittags ad-Dahla, Kurs 192, erheblicher Schwell, das Schiff rollt deutlich, wir fahren full speed, um bis 18 Uhr im Hafen von Nouakchott zu sein, da wir nur bei Flut die nötigen 55 cm unter dem Kiel haben werden. Da liegt das Fischerdorf Tiouilît, vor einem Jahr habe ich hier am Strand gestanden und auf die See geschaut. Die Schwüle der Regenzeit ist spürbar, das Schiff hat einige Krängung, wir wirbeln schon Sandbänke auf. Nouakchott ist nur als weiße Dünenlinie zu ahnen, wir müssen bis morgen im stand by vor der Küste treiben, an die Mole passen nur zwei größere Schiffe, einige Frachter sind vor uns dran. Starkes Rollen, manchmal schlägt das Schiff auf, die Filipinos haben Angeln ausgeworfen. Beim Abendessen in der Messe erzählen Master und chief engineer von in starker Strömung hier an den Kai gesetzten Schiffen, die Risse gingen bis zu den Hauptkabelsträngen, von einem im Dock explodierten Tanker, dessen Hauptdeck wie ein Dosendeckel hochgeklappt wurde, morgen könne ich mir das Wrack ansehen.
Samstag, wir dümpeln noch immer vor der Mole, dann die Meldung des chinesischen pilot, alle Maschinenmanöver werden getestet. Als der Lotse endlich kommt, fahren wir in die Bucht ein, das Anlegemanöver mit den Bugstrahlrudern ist bei diesem Wellendruck spannend, der Master schreit den Lotsen, der den Charakter der ›Kaduna‹ nicht kennen kann, an, als wir in allzu steilem Winkel auf den Kai zufahren. Liegezeit 24 Stunden, drei Schiffe warten auf unseren Platz. Polizei, Zoll, Einwanderungsbehörde, der Agent der Reederei strömen auf das Schiff, jeder bekommt eine Fanta, Pralinen und eine Stange Zigaretten. Ich wandere über Mole und Strand zu dem grausam explodierten, jetzt mit Rostbeulen bedeckten Schiff, das quer über den Strand liegt. Es ist heiß, der Sand tief und weich, verstreut liegen Korallen und angeschwemmte Kugelfische. Am nächsten Morgen verlaufe ich mich auf der anderen Seite der Bucht in ein Militärareal, fotografiere in aller Unschuld, das ist die erste von zahlreichen Verhaftungen, ich rede mich heraus, je ne pouvais pas le savoir.
Nun rückt Dakar wirklich näher, Ausgangspunkt meines Wegs durch Afrika, auf den ich mich noch einmal habe vorbereiten können, Kompassberechnungen mit dem Master und dem 1. Offizier, es erscheint mir als gutes Omen, Orientierung in der Wüste beherrschen, Missweisungen kalkulieren zu können, als seien Wege durch die Wüste wirklich berechenbar. Wir kreuzen einen Zug von Hunderten von Delphinen, die unbeirrbar ihren Weg zum Kreuz des Südens finden, lange begleiten sie uns springend und spielend, dann weicht unser Kurs ab.
Montag, ich sitze allein im Brückeneck, bin zu aufgeregt, als dass ich schlafen könnte, bin aufgenommen in den Sternenhimmel. Kaffee für den Master und mich auf der dunklen Brücke, fahles Licht nur vom Kartentisch, um 2 Uhr kommt Cap Vert in Sicht, Yoff, N’Gor, Cap Manuel, das Panorama des nächtlichen Dakar, Schleichfahrt in den Hafen, 3.45 Uhr vessel in position. Nach herzlichem Abschied von der Mannschaft fährt mich der Agent in die rue Félix Faure.