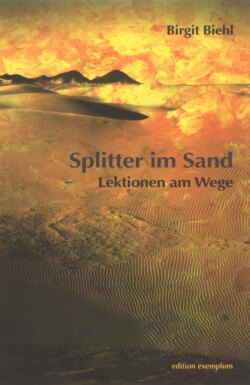Читать книгу Splitter im Sand - Birgit Biehl - Страница 5
Fortbewegungen III
ОглавлениеAuch hier eine neue Facette, Entwürfe eines Lebens auf diesem ›Traumpfad‹, ernsthafte, gut vorbereitete Entwürfe, die gelebt sein wollen in dem Drang, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, keine Lügen, ein Spiel der Splitter im Kaleidoskop, Gier nach 1001 Leben, auch das ist Überleben
Passkontrolle, Einwanderersteuer, Eintragen in das große Buch der immigrants, dann die Devisenerklärung, mangels Formularen wird sie auf einen fettigen Zettel geschrieben. Eine alte Pappe wird auf den Sand gelegt, alle Männer der Umgebung bilden einen Kreis um den Zöllner und mich, und nun muss ich alle meine Zahlungsmittel ausbreiten. Der Zöllner hat die größte Mühe, die Summen zu addieren, die Männer stehen staunend, murmeln, das haben sie noch nicht gesehen. Billige Unterkunft gibt es im Obergeschoss des ›Restaurant du Fleuve‹, als ich in dem Zimmer stehe, bin ich doch erschrocken. Drei durchlöcherte Matratzen mit dem immer gleichen mauretanischen Muster liegen auf dem unglaublich schmutzigen Boden, die Fensterscheiben sind zerbrochen, die am Draht aus der Decke hängende Glühbirne ist kaputt, das Bad besteht nur noch aus Keramikbruchstücken und einer stinkenden Kloschüssel, immerhin handele ich den Preis um die Hälfte herunter, in Rosso gibt es kaum Alternativen. Der Ort riecht nach Krankheit und Verwesung, überall liegen tote Tiere am Straßenrand, Schafe, Ziegen, auch Pferde. In einem Geschäft mit Tischen und Stühlen gibt es Früchte und Milch, abstrus in diesem Elend ein großes Marlboro-Plakat mit seinem lonesome cowboy. Wie immer scharen sich die jungen Leute um mich und mein kleines Notebook, ich erkläre es ihnen auf arabisch, sie dürfen ihren Namen eingeben, sind verwirrt, dass man ihn speichern kann, suchen den Speicher. Aus einem Radio klingt maurische Musik, alle singen mit.
Bei der Abfahrt des Wagens Richtung Nouakchott betet der Fahrer laut, alle fallen ein, la allah illa allah. Die Männer sind neugierig, hier bin ich die Archäologin, die über die Geschichte der Mauren arbeitet, beifälliges, stolzerfülltes Gemurmel, alles gehört für sie dazu, der Rucksack, das Notebook, die Lesebrille, die Männerhosen. Die Fahrt ist die Hölle, 23 Menschen sitzen auf einer 15 cm tiefen Bank mit 8 Plätzen, ich weiß nicht wohin mit den Beinen. Penibel sind die vielen Militärkontrollen, nur ich werde immer aus dem Wagen herausgeholt. Vor Nouakchott liegt in der Lehmhütte am Straßenrand der Offizier neben der Straßensperre auf einer Matratze malerisch ausgestreckt, um ihn herum Essensreste, Teegeschirre, ein Feuerchen, er genießt die Gelegenheit, seine Willkür auszuleben, strahlt mich während des ausgiebigen Verhörs an. Der Sand wechselt seine Farbe von rot in ocker, vor Nouakchott ist er fast weiß, mir stockt der Atem angesichts der Kamelherden, der hellen maurischen Zelte mit den blauen Ornamenten.
Im knöcheltiefen Sand der Hauptstadt schlage ich mich durch zur ›Auberge de Jeunesse‹ im Zentrum. Vor der kleinen Herberge verspricht ein freundlicher junger Mann einen hohen Geldumtauschkurs mit offizieller Devisenbestätigung. Wir gehen in den Grand Marché, er gibt sich sehr verschwörerisch, nimmt meine 1.500 FF und verschwindet. Nach einigen Minuten kommt er tatsächlich mit Bündeln von Ugiyya wieder, versucht, den Kurs zu drücken, das aber nicht mit mir, dann verlange ich das Wichtigste, die Devisenerklärung. Er schreibt meinen Namen auf, verschwindet wieder, sein Freund bleibt bei mir, beruhigt mich, tatsächlich kommt er auch diesmal wieder, das Papier sieht echt aus, stellt sich später als Fotokopie eines amtlichen Formulars heraus, der Stempel als Phantasieprodukt. Wohin jetzt mit dieser monströsen Geldrolle? Die Beiden verschwinden sofort in den Winkeln des Marktes, gottlob kenne ich den marché noch gut und finde wieder heraus, rette den Packen Geld in die Herberge und ziehe Bilanz.
In Nouakchott will ich die erste Ladung meiner Fundstücke nach Hause schicken und gehe mit einer prall gefüllten Plastiktüte zur Post. An einem der Schalter zeige ich meine Tüte und frage die runde freundliche Angestellte, ob es Kartons gebe, sie verneint, winkt mich nach draußen, ich solle dort zwei Briefumschläge kaufen. Sie geht mit rollendem Hintern in ihrem herrlichen weißen Boubou in einen der hinteren Räume der Post und kehrt mit einer Kleberolle zurück, schneidet liebevoll die beiden Umschläge auf, knuddelt meine Stoffe mit den zwischen ihnen verstauten Steinen, Muscheln und neolithischen Fundstücken auf die Hälfte zusammen und beginnt ruhig und hingebungsvoll mit der Klebearbeit. Ganz beiläufig beginnt sie ein Gespräch, wie es bei mir zu Hause aussieht, wie ich lebe, was ich tue, es endet damit, dass sie sich bei mir für ihre nächsten Ferien einlädt. Inzwischen bildet sich eine Schlange am Schalter. Einem, der auch keinen Karton hat, fährt sie ins Gesicht, er solle das gefälligst zuhause vorbereiten. Bei soviel Kleberei ist die maurische Kleberolle schnell alle, majestätisch erhebt sie sich wieder und rollt erneut hinaus, fünf Minuten vergehen, sie erscheint mit einer neuen Kleberolle. Da es jetzt um die Befestigung der Seitenteile geht, hänge ich mich zur Hälfte über den Tresen und halte mit den Fingern die Ecken fest. Ein ungeduldiger Kunde bittet, sie könne doch mal eben sein Einschreiben, sie unterbricht ihn, er könne sich ja auf ihren Arbeitsplatz setzen, alles lacht, er auch. Nun wird der zweite Briefumschlag gefaltet und zugeschnitten, noch einmal alles halten und kleben, dazwischen zischelt sie, ich solle ihr meine Adresse aufschreiben. Als das rundherum verklebte Päckchen fertig ist, entschwebt sie wieder, am Schalter wartet friedlich die geduldige Schlange, ganz Amtswürde erscheint sie mit einem kleinen Postzettel, gibt mir ihre Adresse, ich ihr meine. Sie winkt mich an eine andere, jetzt leere Schalterstelle, beugt sich über den Tresen und fragt, wann ich wieder nach Hause führe, ich schildere ihr meinen Reiseweg, sie reißt die Augen hinter der dicken Brille auf und flüstert beschwörend: ›Du wirst mir eine Postkarte von jeder Etappe schreiben!‹ Wir küssen uns, Aissata Diop, meine Freundin.
Ich frage mich durch zum weit entfernten Nationalmuseum, um die neolithischen Exponate zu sehen, bin schockiert. Es ist eine schöne und reichhaltige Sammlung, ein herrliches steinernes Mahlbecken, viele Stücke der gleichen Art, viele Scherben mit Ornamenten, aber keine vollständigen Gefäße, wie ich im letzten Jahr eines in der Wüste südlich von Chinguetti gefunden und ganz legal mit nach Hause genommen habe. Da packt mich das Gewissen, schnell ist der Entschluss gefasst, das große Gefäß zurückzugeben. Ich frage im Museum nach einem Verantwortlichen, ein Mann stellt sich als der Konservator des Museums von Ouâdane vor, fragt, ob ich das Gefäß nicht seinem Museum überlassen könne. Wir diskutieren, wie dies zu bewerkstelligen sei, da nimmt er mich an die Hand, wir gehen den langen heißen Weg zum Wirtschaftsministerium, dort ist sein Bruder Commissaire Général für die Expo in Hannover. Also beschließen wir die Übergabe mit einem kleinen Festakt am Nationentag Mauretaniens in Hannover, Ould Abidine Sidi ist glücklich, ich bin erleichtert.
Nouakchotts Schönheit erschließt sich nur bei vollem körperlichen Einsatz in Hitze und Sand, sehr schöne Viertel mit interessanter Architektur, viel Leben auf dem Markt, die Menschen haben strahlende Augen. Auf dem Handwerkermarkt ist die Moschee nur durch ihre Richtung Osten in den Sand gezeichnete Form erkennbar, am Abend gehen die Männer durch den markierten Eingang, knien sich in den Sand und beten.
Die ›Route de l’Espoir‹, die ›Straße der Hoffnung‹, diesmal will ich bis an ihr Ende fahren. Eine Großfamilie nimmt mich sofort auf, im großen Peugeot geht es durch die Lehmhüttenvorstädte von Nouakchott, bis Boutilimît bezaubern die vielfältigen Dünengestaltungen, die Farben, die Sicheldünen. Jeder Verkehr erstirbt, Kamele, einige Zelte, nichts mehr. Ab Aleg wird die Straße deutlich schlechter, dann vollends unpassierbar, etwa 300 km lang sucht der Fahrer neben der Straße eine brauchbare Piste, das Wasser in den sonst trockenen oueds strömt über die Fahrbahn, hat sie unterspült, die ursprüngliche Fahrbahndecke ist zerbröckelt oder in großen Stücken hochgedrückt. Über der Wüste liegt jetzt ein Hauch von Grün, Tiere grasen. Wir durchqueren die Flüsse barfuß, tragen alles Gepäck hinüber, Schafe, Reissäcke, kehren um, schieben den Wagen durch das knietiefe Wasser, nur langsam fließt es wieder aus dem Fahrzeug.
Nur zehn Personen sind diesmal im Wagen, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, richtig sitzen zu können. Neben mir eine Frau meines Alters, die ein winziges verdorrtes Wesen unter einem großen Tuch in das Auto gesetzt hat, das sichtlich dem Tode nahe ist. Alle hatten auf die Frau eingeredet, ihre Mutter doch in Nouakchott zu lassen, sie werde die lange und anstrengende Fahrt nicht überstehen können. Als wir losfahren, hat die Frau unter dem Tuch grauenvolle Bronchitis-Anfälle, würgend presst sie die Luft aus den Lungen, entlädt röchelnd Mengen von Schleim in einen Plastiktrinkbecher, den die Tochter ab und zu auf den Wagenboden neben meine Füße kippt. In schwerer Atemnot sackt sie bisweilen wie tot zusammen, wir sind entsetzt, schauen ständig nach ihr, mir wird speiübel, ich sehe betont zur anderen Seite auf die Sicheldünen, fühle mich ausgeliefert, hasse die Frauen, die diese widerliche Situation herbeigeführt haben. Vierzehn Stunden lang sehe ich, wie die Tochter in der Enge des Fahrzeugs es schafft, in ihren Sitz gekrümmt die Mutter umarmt zu halten, ihr ständig den Becher vor den Mund zu führen, ihr mit einer Hand die Stirn zu kühlen, ihr ständig ein wenig Flüssigkeit einzuflößen, sie auf die Gebete vorzubereiten, ihr beim Pinkeln zu helfen, sie zu waschen, ihr beim Sonnenuntergang vorzusingen, ihr die Hände zu entkrampfen und zu reiben, ihr immer wieder das im Fahrtwind verrutschende Kopftuch zu richten, das die Würde der Wüstenfrau wahrt. Ich schäme mich sehr.
Wir erreichen ein wildes Bergmassiv, auf der Passhöhe im Sonnenuntergang ein Blick zurück in die zartgrüne Ebene voller Sträucher und Akazien, jetzt haben sie kleine Blätter, noch sind die Seen nicht versickert. Dreimal machen wir Pause, alle waschen sich vor dem Gebet mit Sand, blicken fordernd zu mir herüber. Als ich erkläre, ich sei Christin, drängen sie mich, schnell Muslima zu werden, sonst sei ich bald verloren. Ich verspreche, darüber nachzudenken. Wo wir anhalten, wird schnell ein Schaf geschlachtet, gehäutet, zerteilt, die Gedärme auf die Straße geworfen, wo durchfahrende Fahrzeuge sie zermatschen, Knochen und Felle liegen überall herum, alle stehen oder sitzen im blutigen Sand, es stinkt unerträglich. Das Fleisch ist nicht abgehangen, nicht gewürzt, wird auf Holzkohle sofort gegrillt, ich weigere mich standhaft zu essen, schiebe Krankheit vor. Die Dorfbewohner reden mich mit ›monsieur‹ an.
Spät in der Nacht erreichen wir Kiffa, ganz schnell zerstreuen sich die Mitreisenden in ihre Häuser, auf der Suche nach einer Bleibe treffe ich auf ein winziges Restaurant mit einem Tisch und einem Stuhl, und so lande ich auf einer Matratze im Hinterhof bei den Schafen und Ziegen in einer Art offenem Abstellraum. Davor liegt auf dem Boden ein großer dicker nackter Schwarzer, der seine Habe auf einer Decke ausgebreitet hat. Im Raum gibt es zahllose Ungeziefer, so lege ich mein Zelt auf die Matratze, stelle alles Gepäck hinein, so dass sich ein kleiner Hohlraum über dem Kopf ergibt, liege nun schwitzend wach, auf jedes Geräusch von draußen lauschend, neben mir stöhnt ein Schaf, der patron hat mir einen Rest von seinem kalten couscous hingestellt.
Im ersten Morgengrauen jagt er mich davon, da das Vermieten von Räumen verboten ist, noch im Dunkeln versuche ich meine Sachen zu packen, ziehe angewidert dieselben versauten Sachen an, wenigstens die Zähne aus der Hand putzen. In der Nähe gibt es Fahrzeuge für die Weiterfahrt durch eine englische Parklandschaft, gemächlich ziehen Kamele und kleine Rinderherden über saftige Weiden mit Baumgruppen und kleinen Seen. Der Fahrer überfährt einen wilden Hund, dann rennt im Moment, als wir vorbeifahren, ein erschrockenes Kalb in den Wagen, es knallt fürchterlich, der Fahrer ist entsetzt, den ganzen Tag muss er darüber reden, in jedem Dorf erklärt er den Männern, wie das passiert ist. Wieder müssen wir strömende oueds durchwaten, den Wagen ausräumen, schieben, als ich meine Hose über die Knie rolle, schauen alle Männer entsetzt weg, ich schiebe nach Kräften mit, was mir immerhin ihre Anerkennung verschafft. Der Wagen ist voller Wasser, im Kofferraum ächzen die vier Schafe. In jeder Ansiedlung hält der Fahrer an, die Männer halten ein Schwätzchen mit den Bewohnern, machen kleine Geschäfte.
Aioûn al-Atroûs ist erstaunlich schön mit seinen verputzten Feldsteinhäusern mit Arkadenumläufen für kleine Märkte, mehrere Hilfsorganisationen haben ihre Schilder hinterlassen. Ich finde einen Schneider mit traditionellen Stoffen, als ich meinen Wunsch, die Form eines Männergewandes mit einem oben angesetzten Schleier für Frauen, in den Sand zeichne, brechen alle Männer in Gelächter aus, die Reaktion, die ich schon kenne, wenn ich irgendetwas äußere, was auch nur geringfügig von der maurischen Tradition abweicht. Nach einiger Diskussion ist der Schneider bereit, das Kleid bis zum Abend zu nähen, eigentlich findet er die Variante toll. Vor der Tür warten schon die Jungen und Mädchen auf mich, »monsieur ou madame?« Entgegen dem Augenschein nennen sie mich monsieur, weil es nicht wahr sein kann, dass eine Frau Hosen und einen shesh trägt. Ich erkläre ihnen genau, wie ich reise, wie notwendig für mich diese Kleidung ist, sie nicken, sagen wieder monsieur, undenkbar ist, dass eine Frau so etwas tut, noch dazu allein. Eine Gruppe großer Mädchen kommt dazu, sie zeigen voller Verachtung auf meine Stiefel und die Hose, das sei nichts, gar nichts, sie machen wegwerfende Handbewegungen und spucken vor mir aus. Ich führe ihnen vor, wie ich wandere, klettere, sie verstehen überhaupt nicht.
An der Strecke nach Néma – hier ist die Straße besser, sicherlich haben die Hilfsorganisationen für Infrastruktur gesorgt – sitzt plötzlich am Straßenrand eine völlig nackte dunkelhäutige Familie, mehrere Mütter mit kleinen Kindern auf dem Arm, die offenbar schwerkrank sind. Wir halten an, können überhaupt nichts tun, fahren weiter. Woher sind sie gekommen, wie weit mögen sie gelaufen sein bis zur rettenden Straße, worauf warten sie, wenn nicht auf den Tod … Meine Mitreisenden sehen mir beim Schreiben zu, wollen es mir nachtun. Die mageren Hirten und Händler in ihrem blauen Gewand freuen sich wie kleine Kinder über die restlichen Filzstifte und malen mit verkrampfter Hand auf Papierfetzen Kringel und Striche. Ich bin froh, dass wir nur kurz in Timbedgha halten, der durchdringende Geruch von frisch geschlachteten Tieren verursacht Übelkeit, weiter, nur weiter Richtung Néma, auffallend viele Raubvögel kreisen in der Luft. An der überspülten Straße müssen wir durch den Fluss mit allem Gepäck, hüfthoch reißt das Wasser, wir müssen den Wagen zurücklassen, nach einiger Zeit kommt ein Buschtaxi aus Richtung Osten.
In Néma, am Ende der ›Straße der Hoffnung‹, packt mich Entsetzen, alle Wege und Marktstände sind unter Wasser, verlassen, voll aufgeweichten Unrats, es stinkt nach Scheiße, nach Blut, nach verdorbenem Fleisch, dazu ein dunkelgrauer Wolkenhimmel und ein fast schwarzer Gerölluntergrund wie am düsteren Amogjar-Pass. Die wenigen Menschen haben sich in die Unterstände der Häuser verkrochen, die Arme um die Schultern geschlungen, die Augen bei meinem Anblick geweitet. Nirgends gibt es etwas zu essen, die wenigen Geschäfte sind leer, in den Auslagen nur dieses stinkende Hammelfleisch. Einige jüngere Männer rufen mir zu, ich muss ihnen in meiner verdreckten, aber doch hellen Kleidung wie eine Lichtgestalt erscheinen, die sie aus ihrem Elend reißt. Ich will sofort weiter nach Oualâta, höre, der Ort sei völlig abgeschnitten, es würde Tage dauern, dorthin zu kommen, gerade heute morgen habe sich schon ein Wagen aufgemacht, ich müsse erst einmal in Néma bleiben. Der Gedanke ist schrecklich, in dieser Nässe gibt es keine richtige Unterkunft. Ich gebe meinen Plan auf, in drei Stunden geht ein Wagen zurück nach Timbedgha, ich will die Oase erkunden und dann umkehren, für das Tuareg-Gebiet östlich von Néma bekäme ich zur Zeit sowieso keine Genehmigung wegen der dortigen Unruhen. Und so kommt es dann doch noch zu einem hinreißenden Kindernachmittag in Néma und Umgebung, eine ganze Bande Jungen begleitet mich überall hin, sie erzählen von ihrer Schule, bringen mich zu dem winzigen Krankenhaus aus Lehm, das eine österreichische Ärztin aufgebaut hat. Mit Ehrfurcht sprechen alle von ›Helga‹.
Auf der Rückfahrt nach Timbedgha im Sonnenuntergang diskutieren die Männer im Wagen, nachdem sie mich gehört haben, über Frauen und Reisen. Sie verstehen, dass ich so reise, verstehen nicht, warum, vor allem nicht, wie mein Mann mich allein gehen lassen konnte, wieso er nicht die Verantwortung für mich übernommen hat. Wieder müssen wir durch das oued, einen Wagen, der die Durchfahrt riskiert hatte, hat es in der Mitte erwischt. Timbedgha erscheint als beunruhigend notwendiger Zwischenstopp, meine Mitreisenden beruhigen mich, am Markt sei ein mata‘am mit Palaverhütte, dort könne ich bleiben. Unter dem Strohdach baue ich mein Zelt in der hinteren Ecke, richte es mit einer Schnur an den Dachbalken auf. Im Dunkeln füllt mir Sahra eine Schüssel mit Nudeln in Hammelfett, wir verbringen die Nacht auf der Matte unter den Sternen im Gespräch mit Händlern, die es hier zur Übernachtung zwingt. Sahra zeigt mir ihre geschwollenen Knie, will Heilung, alle erwarten etwas von mir, mein Nachbar wegen Unterernährung, sein Freund wegen seiner Erschöpfungszustände, die Mütter zeigen mir ihre Kinder, »Weshalb bist du gekommen?« Zusammengerollt in meiner Zelthaut liege ich beim Feuer im Gemurmel und leisen Gelächter der Mauren, spüre Kröten und Ziegen an meinem Körper. Im Morgengrauen sehe ich mich in einer Runde klapperdürrer Männer, sie haben ihre Tücher eng um sich geschlungen und liegen auf der Seite wie die knochigen Kamele, bei denen ich in der Karawane geschlafen habe, die Linie ihrer Hüften und Oberschenkel deckt sich mit der ihrer Tiere. Wasser und Brot stehen bereit, ein jeder hat Anrecht auf einen Schlafplatz, auf Wasser und Brot, wenn er als Reisender in den Ort kommt. Ich schaffe es, mich aus meinem Trinkbecher zu waschen, hinter einem Autowrack zu pinkeln.
Im Ort gibt es nichts außer Brot, das im Sand in Form gerollt wird, Hammel- und Kamelfleisch, in den Lagern stehen Zuckersäcke aus Polen, Tee aus China, Reis aus Thailand und Nudeln aus Italien. Beim Händler hinter meinem Zelt finde ich einen offenen Toyota, der nach Nara in Mali fahren soll, die einzige befahrbare Piste in der Regenzeit, leiste mir für die nächste Fahrt einen Platz neben dem Chauffeur. Schon morgens wird der erste Hammel neben meinem Zelt geschlachtet, nur hier ist ein trockener Flecken. Ich treffe den Händler wieder, mit dem ich von Néma gekommen bin, er erzählt mir die Geschichte des Ortes. In seinem Geschäft liegen Salzbrocken aus Tichît, noch immer gehen Karawanen durch die Wüste nach Norden.
Ein über und über mit Matsch bedeckter, verbeulter Pick-up kommt an, schmutzige, apathische Männer fallen fast herunter, gehen gebeugt heim. Zwei Männer, die noch weiter müssen, berichten, sie seien von Nara gekommen, hätten für diese Strecke von etwa 160 km vier Tage und drei Nächte gebraucht. Sie sind zu Tode erschöpft, die Kleidung ist zerrissen. So kaufe ich Brot und Wasser als Vorrat, das Brot fällt den Händlern ständig in den Sand und in die Tierexkremente, was soll’s. Ein Schwerlaster, beladen mit Reissäcken, fährt Richtung Néma, ein Allrad-Jeep der UNO, auf einem Eselskarren werden blutige Kamelteile zu den Geschäften gebracht. Ich muss warten, bis sich genügend Passagiere für Nara melden, bis jetzt sind wir fünf. Neben mir spielen die Männer schon seit dem Morgen Karten, es gibt für sie nichts zu tun, nichts zu arbeiten. Die Kinder einigen sich auf die Anrede ›monsieurmadame‹, ich bin einverstanden. Auf der Südseite des Ortes an einem See der Regenzeit ist Viehmarkt, rundherum auffallend schöne alte Lehmarchitektur, direkt über dem Boden die halbrunden Fensternischen, die Fassaden der kastenförmigen Häuser sind schmucklos glatt verputzt, über die obere Kante ragen Regenabläufe. Auf dem Viehmarkt legen mir viele Männer nahe, Muslima zu werden. Ein Vierzehnjähriger fragt: »Kennst du Gott?« Ich sage ja.
Die zweite Nacht in Timbedgha ist vergangen, vor Hunger und Nährstoffmangel greife ich zur ersten mineralischen Notration in meinem Rucksack, setze mich an die Straße, warte, nichts. Die anderen Mitreisenden wollen bis Abidjan oder Brazzaville, sie treiben Kleinhandel, Transporte von Waren, verdienen gerade das Überleben mit der unsäglichen Mühe dieser Verkehrswege. Plötzlich tut sich etwas, ein anderes Auto soll fahren, jetzt wird verhandelt, Tee trinken, Geduld. Wieder nichts. Warten, es fehlen immer noch sechs Leute. Ich spiele mit den Kindern, der ganze Ort kennt mich jetzt, ausruhen in der Palaverhütte, dort werden gerade Hammelköpfe verzehrt, man saugt lautstark die Augenhöhlen aus, ich flüchte. Um kleine Feuer gibt es überall Männerrunden im Gespräch, man winkt mich hinzu, sie können überhaupt nicht verstehen, warum die Männer bei uns nicht mehrere Frauen heiraten dürfen. Überall Kartenspiel, so eine Art Maumau. Warten. Ich spüre, wie aus den fauligen Tümpeln um uns herum stinkend die Krankheit wächst, das Atmen fällt schwer.
Der Peugeot aus Nouakchott kommt an, es erscheint Dinesh, Inder, etwa 35, als Händler mit allen Wassern gewaschen, Profi mit einer köstlichen Mischung aus indischem Englisch, Straßenköterfranzösisch und Marktweiberarabisch, völlig unverständlich, aber genialisch. Wir werden ein wunderbares Team, ich habe die Vorschläge und die nötige Gelassenheit, er den Sinn für Realitäten unter den unmöglichsten Bedingungen, und so bringen wir in dem unfassbaren Dreck auf dem Boden hinter dem Tresen unseres Händlerfreundes tatsächlich ein Essen zuwege aus Erbsen, Zwiebeln und Maggi-Sauce, mein erstes Essen seit drei Tagen, auf dem Boden hockend langen wir mit unseren schmutzigen Händen in die Pfanne. Ich habe zu lange nichts zu mir genommen und erbreche hinter alte Autoteile.
Gemeinsam lernen wir die Verhältnisse in diesem kranken Ort kennen, beobachten, mit welcher Härte die Menschen miteinander umgehen oder ihre Tiere behandeln, fassen es nicht, welchem Elend sie ihre Kinder aussetzen. »Die Kinder sind unser Reichtum«, sagen sie und beuten die Arbeitskraft Heranwachsender bis in die Nacht aus. Die tragen die schwersten Lasten, singen und lachen noch dazu, essen und trinken fast nichts. Es ist empörend, den ganzen Tag sitzen die Väter da, trinken Tee und spielen Karten, schwätzen, sind faul und arrogant, Dinesh hat sein Urteil gefällt. Das faulende Wasser im Ort, all der Unrat könnten innerhalb von drei Tagen gemeinschaftlich bereinigt sein, stattdessen finden wir in den Gehöften abseits der Straße kranke Kinder und Frauen, die keine Milch für ihre Säuglinge haben, offensichtliche Malariafälle, die Familie hockt verzweifelt auf der von fauligem Wasser umgebenen Terrasse des Hauses, die Kranken sind völlig apathisch. Wir kaufen in der Ortsapotheke Tabletten, dazu Essen und sauberes Wasser, behandeln die Familie, es ist schwer, ihnen den notwendigen Rhythmus für die Einnahme des Medikaments einzuprägen, eine halbe Tablette morgen, eine ganze in genau einer Woche. Am nächsten Morgen geht es ihnen viel besser, sie haben gegessen, die Familie lacht, ist dankbar.
Da wir einander nun gut kennen, laden mich die Männer zum Kartenspiel in die Palaverhütte ein, das ist schon eine hohe Anerkennung. Das Schreckliche geschieht, ich gewinne, schließlich macht mir bei Maumau keiner was vor, Schweigen in der Hütte. Dann natürlich wieder Tee, Brot, Hammel, Maccaroni mit Kamelfett, Tee, sonst nichts. Dann das Gebet, wieder Tee, schwätzen, beten, schwätzen, schlafen, alles am Rande der Straße, es gibt keine Möglichkeit sich zurückzuziehen. Sie wollen unbedingt den Brief sehen, den Ould Abidine Sidi mir für seinen Freund mitgegeben hat. Da mehrere Männer mich sofort heiraten wollen, sind sie seit der Ankunft von Dinesh eifersüchtig und fragen ständig, ob ich ihn nun heiraten wolle, da wir ja zusammen gegessen hätten. Sie wollen mich von meinem Mann loskaufen, schließlich habe er mich ja reisen lassen, was sie denn geben sollten? Einer bietet mehrere Schafe, ein anderer überbietet, ich werfe ein, dass ich gar nicht heiraten wolle und zudem mein Mann sicherlich eine unerfüllbar hohe Forderung stellen würde. Das löst lautes Durcheinander aus, was denn, ja was denn? Vierzig Ziegen bietet jemand, ich sage, keine Gegenstände, mein Mann liebt mich, auch wenn ich auf Reisen bin, ich liebe ihn, wir würden einander nicht verlassen. Schweigen, sie verstehen nicht, einer bietet noch einmal seine ganze Herde, großes Gelächter, sie akzeptieren.
Da in der Nacht noch vier Leute für Nara angekommen sind, soll es nun heute früh losgehen. Um 10 Uhr beginnt man erst einmal die Reifen zu wechseln, den Motor zu warten. Irgendwann wird das Gepäck aufgeladen, auf der etwa 5 m² großen Ladefläche festgestampft, mit einem Netz gesichert. Die Waren der Händler, die zum Markt nach Nara wollen, werden rundherum angehängt. Ousmane, der Zerbrechliches über Bamako an die Elfenbeinküste transportiert, hält alles fest im Arm. Die Ladung geht schon über den Rand des Geländers, eine Plane wird darüber gelegt, die Fläche mit einem Netz verzurrt. Dann bricht der Sturm los, 23 Männer und eine schwarz verschleierte Frau kämpfen um die Plätze auf dieser winzigen Fläche. Dinesh und Ousmane haben sich das Dach des Führerhauses erobert, sind nun Wind und Wetter ausgesetzt. Ich sitze neben dem Fahrer mit einem dicken marokkanischen Juden, der unentwegt frisst, daher immer Durst hat und im Laufe der Fahrt dem Fahrer und mir Wasser klaut, ständig rülpst, niemals hilft.
Gegen Mittag biegen wir hinter Timbedgha auf die Piste, der Fahrer fährt derartig ruppig, dass Leute herunterfallen und sich erheblich verletzen. Gerade gewöhnen wir uns an das Schaukeln und Stoßen, da geht im ersten Tiefsand die Schaltung kaputt, wir schleichen zum letzten Gehöft zurück, bleiben dort in der Palaverhütte. Sofort wird Tee gekocht, Fahrer Mohammed und Gehilfe Natu fahren zurück, um ein anderes Auto zu holen und das Gepäck umzuladen. Die maurische Frau sitzt abseits unter einem Baum, sie darf nicht in die Hütte zu den Männern. Wieder entwickelt sich ein Gespräch über den Glauben, wieder fordern die Männer, ich solle Muslima werden. Ich bemühe mich, ihnen zu erklären, dass ihr Glaube nicht der einzig mögliche ist. Da sie nichts wissen, schlage ich vor, es ihnen zu zeigen. Alle rücken um mich herum, starren mich an, alle haben meinen Namen behalten, viele stellen Zwischenfragen, das ist härteste Anforderung an mein Arabisch, und so hocke ich, die vor 20 Jahren aus der Kirche Ausgetretene, denn also in der Mitte, gehe im Wüstensand auf die Knie, schlage das Kreuz, falte die Hände und singe, da mir im Moment nichts Anderes einfällt, »Ein feste Burg ist unser Gott«, übersetze diesen Vers, alles nickt beifällig, fasziniertes Schweigen, dann Gemurmel, du machst das so, wir machen das anders, Gott schütze uns alle.
An den folgenden Tagen werde ich mit äußerster Hochachtung behandelt, mit einer für Mauren ungewöhnlichen Zartheit, bekomme als erste Hammel und Tee angeboten, sie akzeptieren, dass ich das Fleisch nicht esse, machen für mich den Tee extra etwas schwächer. Sie unterstützen meine Reisemission, wo sie nur können, zeigen mir ihre Bräuche, weisen mich in den wenigen Dörfern unterwegs auf die Moscheen hin, erlauben nach schneller Diskussion auf Hassaniyya, dass ich fotografiere. Schluss ist da, wo ich wissen will, was in den kleinen Flaschen war, die sie alle vor der Abfahrt in Timbedgha ausgetrunken haben. Als auch ich eine kaufe und so tue, als wolle ich sie austrinken, schreien sie auf, das dürfe ich nicht, das sei ›afrikanisches Geheimnis für Männer‹, sicherlich eine Droge, um die kommenden Strapazen überstehen zu können.
Ein neuer Pritschenwagen kommt gefahren, hörbar stärker als der alte, zunächst geht es über trockenen Sand, bis wir in einem Wasserloch, das zwischen hohen Gräsern nicht zu sehen war, auf einen vollkommen überladenen Pkw stoßen, der bis über die Achsen eingesunken ist. Ein Franzose will mit seiner kleinen schwarzen Tochter bis nach Togo fahren, hat einen Führer angeheuert, der ihn durch dieses gefährliche Gelände lotsen sollte. Seit gestern haben sie auf Hilfe gewartet, das Kind hockt verängstigt unter einem Strauch.
Nach zwei Tagen Fahrt will ich aufgeben, mich nur noch fallen lassen. Alle 50 m muss der Wagen freigegraben, mit untergelegtem Schaufelblatt und Wagenheber angehoben werden, damit ein Blech untergeschoben werden kann. Immer wieder vorauslaufen, durch die strömenden oueds waten, manchmal kilometerlang durch Matsch, um das Gewicht des Wagens zu reduzieren, immer wieder bis zur Erschöpfung schieben, begleitet von lautem Geschrei, intensivem Gebet, wenn es durch tiefes Wasser geht. Der Fahrer wird angefeuert, Spähtrupps werden ausgesandt, um den besten Weg zu finden, einmal haben sie meinen Vorschlag gewählt. Da ich Hosen und Stiefel trage, mein Tuch wie einen maurischen shesh um den Kopf geschlungen habe, ist es für die Männer selbstverständlich, dass ich mitarbeite, die maurische Frau bleibt auf dem Wagen sitzen. Wenn sie mal muss, darf nur ich sie berühren, damit sie absteigen kann, also schleppe ich die von vielen Geburten unförmige Frau auf dem Rücken durch den Matsch auf trockenes Gras und wieder zurück, sie ist so dankbar. Natu, noch keine 18, schmal und mager, liegt jedes Mal, völlig vom Matsch bedeckt, unter dem Wagen und gräbt mit den bloßen Händen den Schlamm unter den Reifen hervor. Wenn er es wieder einmal geschafft hat, bittet er uns um Essen und sauberes Wasser.
Am Nachmittag kommen wir an einem liegengebliebenen Geländewagen vorbei, etwa 15 Leute, Händler wie unsere Männer, warten seit drei Tagen auf Hilfe, ein Reifen ist abmontiert, der Motor kaputt, das Auto bis zur Achse im Schlamm. Die Männer liegen im Schatten unter einem Dornenstrauch, die Matten im feuchten Boden zerdrückt. Sie sind apathisch, trinken das Pfützenwasser, haben nichts mehr zu essen, die Knochen eines Hammels liegen in der Asche. Da wir noch mehr als die Hälfte des Weges vor uns haben, geben wir ihnen nichts von unseren verbliebenen Vorräten. Natu nimmt die Knochen des Hammels aus der Asche, kratzt die Sehnenreste ab und kaut sie während des ganzen folgenden Tages. Keiner von unseren Männern gibt noch einen Pfifferling auf die Gestrandeten. Wir nehmen einen jungen Mann mit nach Nara, er muss vorn auf der Motorhaube sitzen, in Nara soll er Reparatur und Ersatzteile organisieren, die vielleicht aus Bamako kommen müssen, wie lange das dauern mag … Ich versuche nicht daran zu denken, dass auch uns das passieren kann, Mohammed ist ein sehr guter Fahrer. Als ich ihm das sage, gerät sein pokerface aus den Fugen, er muss lächeln, von dem Moment an hat er mir viel gezeigt, Pflanzen, Vögel, Brunnen.
Am Abend ist mehr als die Hälfte des Weges geschafft, wir bleiben in einer winzigen Siedlung von Hirtennomaden, schlafen auf den Matten im Freien. Glühend rot geht die Sonne über der grün schimmernden Wüste unter, der Vollmond ist so groß, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Um uns herum die schweren Buckelrinder, Ziegen und Schafe, wilde Hunde, Esel. Die Hirten kommen in stolzer Haltung auf Pferden ins Lager geritten, würdigen uns keines Blickes, wir sind die mit dem Auto. Unsere Männer kaufen den Nomaden einen Hammel ab, immer kaufen und schlachten die Mauren, laden dann alle übrigen zum Essen ein. Sie töten das Tier vor meinen Augen, ein Stich, ein kurzer Schrei, dann knirschen die Knochen. Ich habe keinen Hunger, bin zu erschöpft, habe nur mein Kopftuch als Mückenschutz, nehme von Ousmane, der im Wind auf der Fahrerkabine sehr gefroren hat, meinen Anorak zurück, in der Nacht sind 30 Grad Temperatursturz. Ich klappere mit den Zähnen, der Boden ist feucht, an Schlaf ist nicht zu denken. Um uns herum die Geräusche der Tiere, die nie auf uns treten, am Feuer singen die Hirtenjungen, die Mauren kochen im Licht meiner Taschenlampe Tee. Im ersten Morgengrauen brechen wir nach dem Gebet auf, ich bin steif vor Kälte und zerstochen.
Die vor uns liegende Strecke ist noch schwerer, unser Glück ist, dass es nicht noch zusätzlich regnet. Die Grenze zwischen Mauretanien und Mali zeigt sich in der Ebene als ein runder, ganz glatt gearbeiteter Brunnenrand mit hölzernem Schwengel für den Sack aus Ziegenleder. Im ersten Dorf, bewohnt von Sarakolé, machen wir Rast zwischen den kleinen runden blitzsauberen Gehöften mit strohgedeckten Rundhütten. Auf dem Dorfplatz steht die kleine Moschee im malischen Djenné-Stil, Trampelpfade führen zu den Weideplätzen, abseits des Dorfes ist ein großer, wasserreicher Brunnen gebaut, eine junge Frau zieht den schweren Ledersack bestimmt 15 m hoch. Die Frauen sind schön mit ihrem goldenen Nasenring, sehr freundlich, aus den Gehöften klingt ihr kehliger Gesang, sie stampfen Hirse, um mich herum die kleinen nackten Kinder in stummer Neugier.
Ich verstehe die Sprache der Frauen am Brunnen nicht, aber wir verständigen uns. Eine Frau schüttelt eine Brust, deutet auf mich, guckt mich fragend an, ich nicke, zeige drei Finger. Sie lächelt bedauernd, schüttelt die andere Brust, deutet auf sich und streckt acht Finger aus, ich zeige höchste Anerkennung, wir lachen. Ich verweise auf den Fotoapparat, bitte, ein Foto machen zu dürfen, sie freuen sich, stellen sich auf. Die erste Frau zeigt mit der Hand auf den Apparat, dann auf die Piste, macht das Zeichen für den Rückweg, weist auf den Apparat, dann auf sich und die anderen Frauen hin. Ich nicke, dreimal diese Bestätigung. Ich schäme mich, wie soll ich das bewerkstelligen, wie kommt jemals Post hierher? Etwas abseits des Dorfes steht ein neues kleines Schulhaus mit zwei Klassenräumen, die Kinder erzählen auf arabisch von der Schule und ihrem Lehrer, freuen sich über meine Stifte. Der Abschied von diesem Paradies fällt schwer. Im Wegfahren zeigt mir ein kleiner Junge seinen offenen Fuß, ein alter Mann seine blinden, vereiterten Augen.
Kurz vor Nara wäscht Natu seine Kleidung und seinen vom Schlamm verkrusteten Körper in einem oued, kommt zu mir, bläst sich auf, reibt sich die Schultern und das Gesicht. Ich verstehe, alle Männer haben mich immer verstohlen beobachtet, wie ich mich eingecremt habe, also reibe ich ihn zart ein, er aalt sich wonnevoll, es riecht ein bisschen gut, er stolziert zu den anderen. Arbeit, Wasser, Brot, ab und zu ein paar Biscuits, einmal Nivea Soft.