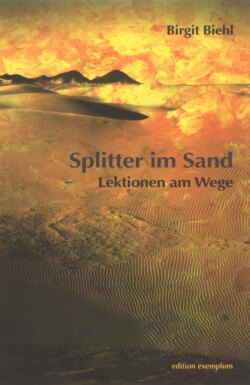Читать книгу Splitter im Sand - Birgit Biehl - Страница 4
Fortbewegungen II
ОглавлениеAuf der Suche nach den Vätern, der Mutter
Dakar Plateau, wieder kann ich hier wohnen, wieder besticht der Zauber der alten Viertel mit ihren niedrigen Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Handwerker, Schneider, Antiquare leben hier. In den kleinen Werkstatträumen stehen die Leitern, auf denen man in den einzigen winzigen Wohnraum gelangt. Zahllose Restaurants mit einem oder zwei Tischen bieten ihre Hausspeise an, in den Innenhöfen gibt es Obst, Gemüse, frischen Fisch aus dem nahen Hafen, in den unüberschaubaren Winkeln leben große Familien in überlieferter Ordnung um die Brunnen herum, Frauen singen bei der Zubereitung der Mahlzeiten, Kinder eilen schwer beladen umher, bringen Vätern, Onkeln, Brüdern Material, tragen die fertigen Waren aus. Alle Bücher, mit denen ich mich auf dem Schiff noch einmal beschäftigt habe, schicke ich nach Hause, will mich nur noch auf mich selbst verlassen, ich fühle mich entlastet, die Nabelschnur ist durchgetrennt. Am Rond Point de l’Indépendance, dem geschäftigen Viertel der Banken und Hotels, muss ich Francs CFA eintauschen, die Automaten verweigern die Visa-Karte, also Barumtausch, auch das eine Abnabelung. Einige Stunden Fußmarsch durch die Stadt machen wieder heimisch in den Vierteln der afrikanischen Fischer und Händler, am Abend kann ich Ahmadou, den Freund, wiedersehen, die ersehnten Jeans passen genau.
Ich muss wieder nach Gorée, ein Jahr lang hat mich zuhause das Bild von der großen Tafel im Salon des Sklavenhauses verfolgt, genau über den mit Menschen vollgepferchten Zellen im Untergeschoss, die Schreie müssen bis zu den Gelagen der Händler durchgedrungen sein, die Ein- und Verkäufe von Menschen bei einem guten Mahl zu feiern pflegten; die Öffnung im Boden eines abgesonderten Teils, die den jungen Mädchen als Toilette diente, sie sollten ihre Unschuld behalten, um so erheblich höhere Preise zu erzielen; die Maueröffnung auf der Meeresseite, durch die rebellische Gefangene den Fischen zum Fraß vorgeworfen wurden. Um 10 Uhr geht an der embarcadère das kleine Schiff nach Gorée, bringt Wasser und Lebensmittel zur Insel, ein kurzer Regen kühlt die schwüle Luft etwas ab. Ich nehme mir Zeit für jedes Haus, das ›Institut du Soudan zur Förderung der Demokratie in Afrika‹, die Malteser-Mission, die kleine Koranschule, aus der lauter Kindergesang über die Insel schallt. Auf dem Weg zum Fort finde ich Ahmadou Dieng wieder, immer noch arbeitet er seine wilden Collagen aus Erde und Stoffresten auf irgendwelche alten Matten oder Tücher, Farben und Leinwand kann er sich nicht kaufen. Diesmal erstehe ich eine kraftstrotzende Gestaltung auf einem alten Badevorleger, den kann ich vorsichtig rollen und schicken.
Noch habe ich Monsieur Omar nicht entdeckt, meinen afrikanischen Vater, über siebzig, er hat mir im letzten Jahr das Sklavenhaus gezeigt, konnte noch von seinem Großvater erzählen, dass mir die Tränen kamen. »Wir haben selbst Schuld daran, wir haben uns nicht gewehrt«. Ich war mein Leben lang auf der Suche nach Vätern, hatte einen heißgeliebten französischen Vater, der kleine krumme Alte aus der Medersa Ben Youssef in Fès ist mein arabischer, Monsieur Omar mein schwarzer Vater. Schon als Kind habe ich in Hamburg Männer angesprochen, ob sie nicht mein Vater werden wollten, einer, ein Kriegsversehrter mit Krücken, ist zum Entsetzen meiner Mutter in unsere Wohnung gekommen. Jetzt sehe ich ihn kommen, er hat früher in Hamburg als Matrose gearbeitet, freut sich sehr, Hamburg ist ein wunderbarer Stoff für uns beide. Die chaloupe aus Dakar ist zurückgekommen, um das Schiff herum tauchen die Jungen nach Münzen, die die wenigen Touristen ins Wasser werfen.
Viel Zeit gehört dem Musée IFAN mit seiner Sammlung von Masken, Statuen, Instrumenten, ganzen Ritualszenen. Besonders spannend ist das große Buschtelefon, ein hochsensibler ausgehöhlter Stamm von etwa einem Meter Durchmesser mit dem Code der hohen Töne für Hochzeiten und, auf der anderen Seite des Schlitzes, dem der tiefen Töne für Trauerfeiern. Etwa 25 km weit reichen die Nachrichten, intensiv darf ich das Instrument ausprobieren. Manchmal schwankt noch der Schiffsboden unter mir.
An der gare routière Pompier, dem chaotischen Sammelplatz für die taxis brousse, die Buschtaxis, ist es schwierig, unter all den gleichartigen Wagen den nach Ndangane im Mündungsgebiet des Sine-Saloum herauszufinden. Alle jungen Männer stürzen sich auf die einzige Fremde, mit viel Geschrei wird der richtige Wagen gefunden, das kostet eine Apfelsine und eine Banane. Erst drei Stunden später ist das taxi voll, 45° im Schatten, ich stinke wie alle, die mit mir Wartenden laden mich in ihr Dorf ein. Nach undurchschaubaren Prozeduren geht es so langsam los, dass wir nicht mehr vor Sonnenuntergang ankommen können. Fünf Stunden Fahrt mit sechs Menschen auf drei Plätzen, das Gepäck auf den Füßen, Haut klebt an Haut, Savannenlandschaft mit Baobabs und Fromagers zieht vorüber. Sehr plötzlich fällt die Nacht, Gewitter kommen auf, das Buschtaxi hält unvermittelt an, das Dachgepäck wird in das Wageninnere gestopft, dann fällt ein Regen, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Nichts ist mehr zu sehen, der Fahrer behält seine Geschwindigkeit bei, fällt in tiefe Schlaglöcher, die Autoscheinwerfer sind kaputt, von unserem Schweiß beschlägt die vielfach gerissene Frontscheibe. Da die Hälfte der Fenster kein Glas mehr hat, die Fahrertür nicht schließt, strömt das Wasser in den Wagen. Nach einer halben Stunde ist das Unwetter vorüber, die drückende Hitze gewichen. Zwischen Baobabs und Schweineherden werden die Reisenden abgesetzt, für mich hält der Fahrer mitten in der Nacht in Ndangane vor einem beleuchteten Hotel, das ich jetzt akzeptieren muss, eine langweilige Touristenanlage, aber ein Essen, eine Dusche und die Möglichkeit, die versaute Wäsche zu waschen.
Viel schöner als im pool des Hotels ist das Bad im Flussdelta, schon morgens hat das Wasser 28°. An der embarcadère von Ndangane warten die Piroguen, an der sandigen Hauptstraße treffe ich auf Mustafa und Ali in der Dorfbibliothek, sie bewachen 30 Bände, ich verspreche, später Bücher zu schicken. Die Entdeckung am Strand ist das afrikanische campement Fouta Toro mit einigen strohgedeckten Rundhütten ohne Wasser und Strom, Amye und ihre Familie nehmen mich sofort auf, beteiligen mich am Fischfang. Zum Schutz vor den Mücken am Wasser ist Erfindungsgabe gefordert, ich befestige mein Moskitozelt mit Seilen an den Deckenbalken der Hütte, ein Reißverschluss ist hin, also Wäscheklammern. Um die Hütte tummeln sich Hühner, Schafe, wilde Hunde, Esel. Als ein Gewitter heranzieht, kommen alle Kinder der Umgebung gelaufen, die Frauen waschen sie mit lautem Geschrei im Regen, selbst die großen Mädchen reinigen sich ungeniert vor den Männern. Die Großfamilie versammelt sich unter dem Strohdach der Palaverhütte, ein Säugling schläft auf dem Esstisch zwischen den Schüsseln. Diengaba erzählt, jahrelang sind die Mädchen zur Schule gegangen, doch können sie nicht lesen, nicht schreiben. In meiner Hütte herrscht mörderische Schwüle, stundenlang schreien die großen Frösche in den Sümpfen der Regenzeit. Am nächsten Morgen klemmt die verzogene Tür, die Klinke ist herausgebrochen, Dialo muss mich befreien. 6. August, heute ist der Geburtstag meiner Mutter, es gelingt mir, ihn beiseite zu schieben.
An der Anlegestelle wartet Mohammadou mit der Pirogue, wir fahren durch die bolongs des Saloum-Deltas zu den Vogelinseln, zum bois sacré, den Heiligen Bäumen, zu den Buschtelefonen, hier ist niemand, Pelikane, Kormorane, Reiher, ein Paradies. Als wir die kleine Insel Mar Lodj streifen, beschließe ich zu bleiben. Im Anfang schuf Gott Mar Lodj, diese wilde Insel voller kleiner bunter Vögel, die in den in allen Farben blühenden Bäumen singen, am mangrovenbestandenen Ufer säubert der Fischer die großen Barracudas und Capitaines. Nur in den winzigen Buchten, die die Mangroven freigelassen haben, kann man der reißenden Strömung in der Regenzeit standhalten. Sophie und Marion, zwei Französinnen, hat es einen Tag vor mir hierher verschlagen, wir durchstöbern die Insel, entdecken das kleine Dorf in der Mitte mit seiner winzigen katholischen Missionsstation, der kleinen Schule, der Kirche rund wie die Hütten auch, der Moschee daneben, dem alles überragenden alten Heiligen Baum der Animisten. Stolz zeigt mir Josephe die Hütten, packt mich plötzlich am Arm und reißt mich zurück, auf dem Holzstoß neben mir liegt eine lange Baumschlange mit aufregend gelbem Kopf.
Ahmadou hat mir in Dakar die Adresse von Kurt gegeben, der sich auf Mar Lodj niedergelassen hat, wir waten durch die Priele und Schwemmsände zu seinem campement am anderen Ende der Insel, vorsichtshalber notiere ich drei Kompasspunkte. Kurts Gefährtin Awwa bereitet uns einen Mussolini genannten Fisch zu, es ist mir ein besonderes Vergnügen, mit Messer und Gabel das brutale Profil des Fisches mit seiner bulligen Stirn und dem starken Kinn zu zerteilen. Schwierig ist der Rückweg unter sternklarem Himmel, wie Seidengewänder von Elfen schwebt die Milchstraße dicht über uns. Kurt schickt uns seinen Schäferhund mit, der begleitet uns bis zur Statue der Schwarzen Madonna, von dort aus finden wir allein zurück.
Heftig schwankt das flache Boot im Wind, als wir mit einer Pirogue den breiten Saloum aufwärts nach Foundiougne weiterfahren. Hier betreibt das Militär eine Fähre. Aus den kleinen Küchen in den Höfen der Fischerhäuser am Hafen dringen Wohlgerüche, köstlich ist der Reis mit Yassa-Sauce. Lange laufe ich flussabwärts, niemand ist hier, Vögel, zahlreiche Termitenbauten sind wie mahnende Hände gen Himmel gerichtet. Schon der frühe Morgen ist sehr heiß, wir brechen auf zu den Dörfern in den Erdnussfeldern voller Baobabs, lilienartiger Blumen und gewaltiger Kapok-Bäume. Überrascht, toubabs, Weiße, zu sehen, versammelt sich überall die Dorfbevölkerung. Maguette, ein feinsinniger Junge, der bald sein Abitur machen wird, begleitet uns den ganzen Tag, erzählt von den Problemen in der Schule, Sophie übernimmt es, ihm die fehlenden Bücher zu schicken. Er führt uns die Karren-Piste entlang zu dem in den Hirsefeldern versteckten Dorf Soum. Ein großer Empfang wird uns auch hier bereitet auf dem kleinen Markt mit der großen Moschee, der Missionsstation, der Palaverhütte voller neugieriger alter Männer und dem Heiligen Baum mit der blutigen Opferstätte darunter. Maguette beschreibt das Dorf als sehr groß, weil sich hier nicht mehr alle mit Namen kennen, hier möchte er nicht wohnen. Lachend und schreiend umringt uns eine große Kinderschar, als wir zum Fluss wandern und unter einem alten Baobab gegenüber dem Heiligen Wald rasten, in dem alle Religionen der Umgebung die großen Feste gemeinsam feiern. Jugendliche schwingen im Rhythmus ihres Gesangs die einfachen Hacken zur Vorbereitung der Reisfelder, für die Feldarbeit gibt es drei Monate Schulferien.
Am nächsten Morgen nehmen wir die Fähre in Foundiougne und setzen über den Fluss, von beiden Ufern hört man die Trommeln aus den Fischerdörfern, wie ein Rausch ist es weiterzuziehen … An dem alten Militärponton sind rechts und links Flusspionierboote befestigt, in denen je zwei bewaffnete Soldaten sitzen, die nur mit Mühe gegen die Strömung ansteuern können. Am anderen Ufer heißt es warten auf eine Fahrgelegenheit, der Fahrer eines Kühllasters will uns hinten zwischen den tropfenden Fischen mitnehmen, wir warten. Hinter den Fischerhütten stehen zwei riesige Kanonen auf drehbaren Podesten, auf das gegenüberliegende Flussufer gerichtet, niemand weiß, gegen wen. Tatsächlich kommt nach einer Stunde ein taxi brousse ans Ufer gefahren, pfercht uns alle zusammen, wir schlingern durch die Sände, über die Strände und Sumpfpisten Richtung Fatick, von oben tropft Fischwasser durch das verrostete Dach, die Piste ist schwer, die Fahrt eine Qual überleben, das heißt auch den Schmerz leben über den Verlust, wie soll ich meine Mutter überleben, sie ist gestorben und ich habe sie allein gelassen, leben konnte sie nicht, aber dafür bin nicht ich verantwortlich. In Fatick wartet schon ein taxi brousse nach Süden, Sophie und Marion fahren nach Dakar zurück.
Durch fruchtbare Feuchtsavanne, durch Erdnuss-, Hirse- und Maisfelder geht es über Kaolack nach Farafenni, die Grenzstation nach Gambia. Es heißt, ein campement gebe es nur in einiger Entfernung, ich müsse auf dem Pferdewagen mitfahren. Alles Gepäck wird auf eine Pritsche geworfen, die Bauern legen sich darüber, das Pferd holpert in großem Bogen um den Ort herum durch die Felder. Festkrallen muss man sich, um nicht herabzufallen, stumm in ihrem Leid heben einige magere Frauen nicht den Blick, der Anblick des dürren Pferdes mit den vielen offenen Wunden im Fell verursacht Übelkeit. Nach einer Stunde Fahrt liefert man mich, seitlich wieder in den Ort einfahrend, tatsächlich vor ›Eddy’s Hotel‹ ab, einem herrschaftlichen Kolonialbau mit palmenbestandenem Innenhof. Bei dem Rundgang durch Farafenni fällt die aufdringliche Wegelagerermentalität der Jugendlichen an den Kreuzungen auf, überall englische Aufschriften, plötzlich mitten im Ort die Grenzschranke, ich bin auf der falschen Seite in The Gambia mit seinem merkwürdigen Englisch, bin mit der charrette über die grüne Grenze geraten und ahne die morgigen Probleme. Das Immigration Office ist schon geschlossen, die Polizei empfiehlt mir, um 6 Uhr an der Grenze zu erscheinen, ich bin nicht beunruhigt.
In Anbetracht der Mücken baue ich im Zimmer eine geniale Konstruktion mit meinem Zelt um einen Nagel herum über den Draht der nackten Glühbirne, trotz des Ventilators ist die nächtliche Schwüle mörderisch, an Schlafen kaum zu denken. Am Morgen gibt es wie üblich weder Wasser noch Strom, trotz der nun häufiger auftretenden Durchfälle muss es mir egal sein, wie ich den Ort verlasse.
Im Dunkeln an der Grenzstation kommt nach einer guten Stunde ein Minibus mit einem einzigen Platz nach Ziguinchor in der Casamance. Ich werfe meinen Rucksack hinten unter eine Bank und will schnell zusteigen, als der Immigration Officer auf mich zukommt, den Pass sehen will und nun ein Riesenspektakel veranstaltet. Da fährt mit meinem Gepäck der Bus ab, zurück bleibt der Kassierjunge, der meint, wir würden den Bus schon wieder einholen. Immer wieder erkläre ich meinen ›illegalen Grenzübertritt‹, beschreibe den Weg mit der charrette, drei Offiziere sehen ihre Stunde gekommen. In meinem kleinen Rucksack habe ich Papiere und alles Geld bei mir, überschlage den Verlust des großen Rucksacks und beschließe, zumal der ranghöchste Offizier auf das Ergötzlichste mit den Augen rollt und mich der Lachreiz packt, mich zu wehren und stark zu bleiben. Nach langer Beratung im Ortsdialekt beschließt man, mich in den Senegal zurückzuschicken. Ich beschreie mein verlorenes Gepäck, erneute Diskussion endet mit dem Beschluss, mir 50.000 FCFA für den nachträglich zu erteilenden Einreisestempel abzunehmen. Entgegen der Wahrheit behaupte ich, mein Geld befände sich in dem großen Gepäck. Erregte Debatte, plötzlich greift der Officer den Stempel, knallt ihn in den Pass, von mir ist nichts zu holen, jetzt schnell hinter dem Gepäck her. Wir halten eines der vorbeifahrenden taxis brousse an, laufen nach 10 km auf die Schlange vor der Fähre über den Gambia-Fluss auf. Obwohl alle Buschtaxis gleich aussehen, finde ich meines wieder, natürlich ist mein Rucksack noch da.
Im tief in rotem Matsch versunkenen Marktflecken am Flussufer herrschen schlimme Zustände, überall Ungeziefer in dieser feuchten Hitze, die Garküchen bieten oft schon verdorbenes Essen an, das Atmen fällt schwer in diesem elenden Gestank. Auf einem verrosteten Ponton geht es über den Fluss, es sind so viele Menschen an Bord, dass man sich nicht rühren kann, die Maschinen kreischen. Die einzige Straße durch Gambia führt in eine schwüle Regenwaldlandschaft, sie ist mit Schlaglöchern übersät, in eine Schlammpiste verwandelt. Schnell ist das Land durchquert.
Beim erneuten Grenzübertritt in den Süden des Senegal, die Casamance, tauchen zahlreiche Soldaten auf, die intensive Kontrollen vornehmen. Die Straße ist kilometerlang mit Wellblechwänden gegen die Rebellen aus den dichten Wäldern gesichert, alle 10 km haben Posten Sperren aufgestellt, ständig überholen uns Armeetransporte. Brüsk treten Soldaten mit Automatikpistolen aus Gebüschen und kontrollieren, ob Rebellen im Wagen versteckt sind, Panzer sind hinter Baumgruppen versteckt. Zwei dicke mamans haben mich in ihre Obhut genommen, die Kinder klammern sich an ihre Mütter, eines hat offensichtlich die Pocken. Die Frauen erzählen mir, wie brutal die Dörfer nach aufständischen Diola durchsucht werden. Nach Stunden erreichen wir Ziguinchor, ich bin so fertig und hungrig, dass ich mit meinen von Schweiß und rotem Matsch durchtränkten Sachen ein richtiges Hotel brauche.
Wunderbar ist die Stadt mit ihrem alten Kern in portugiesischem Kolonialstil, breit sind die Alleen durch die großen Palmenparks, im Verfall wird die vergangene Größe spürbar. In den Straßen am Hafen sieht man die helleren Nachfahren der Portugiesen. Gegen Abend ist die Stadt voller Störche, Pelikane, Reiher, Libellen, selbst Adler ziehen über dem angeschwollenen Fluss ihre Kreise. Gefühl völliger Verlassenheit. Noch nach fünf Jahren werde ich die Schuld nicht los, meine Mutter am Ende allein gelassen zu haben, sie in den letzten Jahren, als sie Bilanz gezogen hat, nicht genügend begleitet zu haben. Ich kämpfe mit den Tränen, kann sie einfach nicht gehen lassen. Mein Wecker ist auf den Steinboden gefallen, wie gut, dieses überflüssige Relikt beseitigen zu können.
An der gare routière bin ich schon früh Nummer 5 in einem alten Peugeot mit 7 Plätzen, kurz danach rasen wir mit beängstigendem Tempo durch den Regenwald mit Kapokbäumen, Mangobäumen schwer von Früchten, durch Reisfelder, auf denen Kinder und Jugendliche arbeiten, Richtung Elinkine im Mündungsdelta des Casamance, aufgehalten nur durch die Soldaten auf ihren Panzerwagen.
In Elinkine lädt mich der Diola Mamadou in sein selbst gebautes Impluviumhaus ein, ich bewundere die typische Bauweise. Durch den Versammlungsraum der großen runden Lehmhütte mit strohgedecktem Dach gelangt man in einen runden Innenhof. Das nach innen gewölbte Dach ist offen, das Regenwasser wird in ein Bassin gelenkt. Hier steht eine große Bananenstaude, die fast schon Dachhöhe erreicht hat, an ihrem Stamm spielen kleine Schildkröten. Um diese Öffnung herum führt ein durch Bambusträger abgestützter Rundgang, von dem die Räume abgehen. Beruhigend trommelt der Regen in das innere Becken, von dem aus ein Überlauf zum Brunnen draußen führt. So ist die erste Nacht in der Hängematte im Rundgang vor dem Regen sicher, und doch schlafe ich unter den Sternen, dicht über mir steht Orion.
Wegen des immer wieder aufflammenden Krieges haben sich viele Diola hierher an die Mündung des Casamance geflüchtet, so ist Elinkine, ein Bauerndorf mit wenigen Fischerfamilien, nun voller Fischer. Sie bringen viel zu viel Fisch, den sie auf großen Holzgerüsten zum Trocknen auslegen müssen, Haie, Rochen, Capitaines, Hechte. Die Lehm- und Strohhütten sind gegen die Waldtiere mit Bambuszäunen geschützt, überall laufen kleine dunkle Schweine herum, Ziegen und Schafe, zahllose kleine Kinder spielen im Sand zwischen den Tieren. Die Schwestern von Mamadou klagen ihr Leid, »Merkst du, wie das Dorf nun stinkt?« Auf dem Dorfplatz steht ein großes handgemaltes Schild: »Défense de chier«, Scheißen verboten, mit drastischer Zeichnung für die Analphabeten, die Choleragefahr ist allgegenwärtig.
Plötzlich lautes Geschrei, zwei gepanzerte Wagen mit Maschinengewehren und etwa 20 Soldaten kommen auf den Dorfplatz am Wasser gerast, verteilen sich überall, durchsuchen die Hütten nach Rebellen. Ich verstecke mich hinter einem Gebüsch, sehe die Möglichkeit, diese Szene zu fotografieren, vergesse den zugeschalteten Automatikblitz, bin sehr erschrocken. Kein Soldat hat den Funken gesehen, später macht mir Mamadous Familie heftige Vorwürfe, ich dürfe sie nicht gefährden, ich schäme mich sehr für meine Naivität. Als die Soldaten abfahren, klingen die Trommeln wieder, Frauen bringen die großen Obstkörbe unter den Mangobaum am Ufer, lachen und tanzen. Nebenan werden die Piroguen gebaut, im Rhythmus der Axtschläge feuern die Männer einander an, schwer ist die Arbeit an den meterdicken Stämmen.
Am Abend findet bei Mamadou eine große Versammlung statt, die Männer beraten, wie sie die Lage des Dorfes verbessern können. Sie gehen fair miteinander um, alle haben gleiches Rederecht. Da der Dialekt mit viel Französisch durchsetzt ist, verstehe ich eine Menge von den Problemen der Flüchtlinge.
Die Mückenplage am Wasser ist schlimm, zudem habe ich, sicherlich vom Brunnenwasser, nun schwere Durchfälle. Mamadous Impluviumhaus hat einen Toilettenanbau aus Lehm, in der Mitte des Raumes ist ein kleines Loch im Boden, darunter ist die Erde ausgehoben, eine kleine Plastikkanne mit Wasser steht neben dem Loch, Licht gibt es nicht, so sieht es denn dort aus und stinkt, wie es aussehen und stinken muss, ich stehe mit den Schuhen in der Scheiße, die Exkremente von Jahren bewegen sich, da sie ein intensives Leben von Ungeziefer enthalten, in kleinen Wellen. Mitten in der Nacht versuche ich, mit einem Eimer aus dem Brunnen Wasser zu schöpfen und das Schlimmste in eine Ecke zu spülen.
Der Weg in das Dorf Mlomp führt durch die Felder in den Regenwald, alte Kapokbäume umgeben den Ort, ihre Wurzeln greifen um sich wie die Schwänze riesiger Saurier, die spielenden Kinder verschwinden in ihren Windungen, eine urzeitliche Landschaft von brodelnder Fruchtbarkeit. Das kleine Krankenhaus St. Josephe wird von den Nonnen geführt, sie haben am Rande des Waldes große Schilder aufgestellt. Die Darstellung, wie jemand sein Bedürfnis im Wald erledigt, ist rot durchgestrichen, daneben sitzt jemand strahlend auf einer Toilette in einem Holzhäuschen, in großen Lettern die Warnung vor der Choleragefahr. Daneben der Hinweis auf die Zahnklinik mit dem drastischen Bild eines Zahnausreißers. Tief im Wald erreiche ich die Versuchsanstalt für Frauen in der Landwirtschaft, in langen Zügen kreuzen große rote Ameisen den Pfad. Lange muss ich am Rande der Piste auf eine Rückfahrmöglichkeit warten wie ein Kind sitze ich da und denke an meine Mutter, kämpfe wieder mit den Tränen, wie konnte sie mich nur verlassen.
Die Jungen, die in den Feldern am Straßenrand arbeiten, spielen Rebellen, jetzt haben sie die Straße mit Ästen blockiert und verschwinden im Busch. Bei Mamadou treffe ich Bamba, einen Offizier der Marinebasis, wir diskutieren über die Rolle der senegalesischen Armee, die laut Bamba völlig in die Bevölkerung, in Erziehungs- und Gesundheitswesen etwa, integriert ist, er leugnet jegliches Feindbild, aber Freundin Emilie und ich sind uns einig, dass sein Revolver nicht aus Kaugummi ist und wir keine Männer sein wollen. Dennoch lädt mich Bamba ein, das Haus seiner Mutter zu besuchen.
Am folgenden Vormittag treffen sich etwa 25 Männer des Ortes zum großen Freitagsgebet in der kleinen Moschee gegenüber, 50 Pantoffeln liegen im Matsch vor dem Eingang durcheinander, bunte Plastikkannen mit Wasser dienen der Reinigung, in einem Fensterrahmen liegen einige Bücher mit von der Feuchtigkeit aufgerollten Seiten, im Vorhof suhlen sich die schwarzen Schweine. Auch Mamadou geht beten, vorsichtshalber trägt er ein gris-gris, ein Amulett in Scarabäus-Form, um den Hals. Seine Frau schickt er zur Missionsstation nach Mlomp, man könne schließlich nie wissen. Als die Kinder krank waren, ist er selbst zur Kirche gegangen, auch zum bois sacré, dem Heiligen Wald, einer von all diesen Göttern werde immer helfen.
Die Marktfrauen fahren heute mit einer Pirogue zur Insel Karabane und nehmen mich mit, sehr herzlich ist der Abschied von Elinkine. Aus dem bolong fährt das Boot auf den Casamance hinaus, dessen anderes Ufer in der Regenzeit kaum zu erkennen ist. Uns begegnen in Einbäumen einzelne Fischer, die sich mit Kraft und Eleganz in der Strömung halten. Auf Karabane kann ich bei Amath im ›Barracuda‹ unterkommen, habe eine Hütte für mich, die in den tropisch wuchernden Blumen fast verschwindet, Wasser, eine Dusche, eine Toilette mit Spülung. Die Insel zu erobern bedarf des Kampfes durch die Vegetation mit einem starken Messer. Ich stoße auf eine fast verfallene bretonische Kirche, auf den von der ständigen Feuchtigkeit halb verrotteten Kirchenbänken ruhen sich die Ziegen aus. Bisweilen hält hier der Priester von Mlomp Gottesdienste ab. Ein Trampelpfad führt zu einem französischen Sklavenhaus des frühen 19. Jahrhunderts, einer ›école spéciale‹, in der unbotmäßige Sklaven durch Folter gefügig gemacht wurden, und zu den Ruinen einer portugiesischen Faktorei, vorbei an den kleinen Gehöften der Reisbauern, deren Felder im Süden der Insel liegen.
Die Ausrüstung des dépositaire médical, der kleinen Krankenstation, ist erbärmlich, ich darf bleiben, als ein alter Fischer kommt, dessen Daumen vom ›Biss eines Katzenfisches‹ dick vereitert ist. Der Pfleger schneidet den Daumen ohne Betäubung mit einer Schere auf, dickflüssig rinnt der Eiter auf den Boden. Den ganzen folgenden Tag lang schreibt er mir eine Liste der dringend benötigten Medikamente auf.
Das Fischerdorf auf der Ostseite der Insel ist besonders gefährdet, die Hütten sind häufig unter Wasser, der Boden ständig matschig und voller Ungeziefer. Um das Feuer zu schützen und gleichzeitig die Mückenplage einzudämmen, sind die Feuerstellen in die Hütten verlegt, schwelen ständig, die Kinder, Ziegen, Schweine, die Fische, die ganze Umgebung ist voller Rauch. Die freundliche Einladung kann ich nicht annehmen, kann nicht atmen. Gegenüber ist in einem Steinhaus die Maternité, die Entbindungsstation, untergebracht, die Nonne zeigt mir den Kreißsaal, die Zimmer für Mütter mit Kind, die Kinder- und Müttersterblichkeit ist stark zurückgegangen. Um die Beine der bonne sœur spielt ein kleiner Junge, sie legt mir die Versorgung des Waisenkindes nahe, sie will ihn in einer der Inselfamilien unterbringen, aber jemand müsse sich um seine scolarité kümmern, die Schule sei teuer.
Am Westzipfel der Insel kämpfe ich mich durch Unterholz und entdecke den Friedhof der alten französischen Handelsstation. Das Grab eines Capitaine in Obeliskform von 1836 erinnert an Napoleon, rundherum verfallene Eisenkreuze, blühende Schlingpflanzen überwuchern die Gräber.
Das Leben der Insel spielt sich am Strand unter den Palmen ab, hier gibt es einige campements, große und kleine Kinder spielen den ganzen Tag, drei junge Männer haben sich eine Strohhütte gebaut, kochen Essen für die wenigen Gäste, versuchen ihr Leben zu verdienen mit ihrer erlesenen Trommelmusik. Als die Sonne über dem Casamance untergeht und die Bucht rot färbt, machen sich die Krabbenfischer auf, ziehen Grundnetze durch die flache Bucht, haben sich Körbe umgebunden, in die sie den Fang schütten. Die ganze Nacht durch hört man die Trommeln, es ist heiß und voller Mücken.
Vor der Hütte am Strand wird heute l’Assomption, Mariä Himmelfahrt, vorbereitet, alle Religionen feiern gemeinsam, ein Festessen ist angesagt. Überall liegen, an Stangen festgebunden, Schweine zum Abtransport nach Elinkine bereit, sie wehren sich schreiend. Eine große Zahl Piroguen ist zu dem kleinen Markt am Strand gekommen, ein Flussboot der Marine mit Maschinengewehr beobachtet das Geschehen. Am Vormittag kommt die ›Joola‹ mit starker Schlagseite den Casamance heraufgestampft, ankert in 500 m Entfernung vor der Insel. Dann bricht das Chaos aus, die Piroguen werden mit äußerster Kraft zum Schiff gefahren, jeder will als erster seine Ware abliefern. An der Seite wird eine Ladeplattform heruntergelassen, Händler und Fischer klettern, in den Wellenbewegungen übereinander stolpernd, die Schiffswand hoch, die Säcke werden hineingeworfen, nach einer Stunde bewegt sich die ›Joola‹ mit noch mehr Schlagseite gemächlich flussaufwärts Richtung Ziguinchor. Amath schickt einen Jungen mit meinem Pass zur Marinebasis, um meine Überfahrt genehmigen zu lassen. In der Nacht steigt bei ›Helena‹ am Strand das Fest, Trommeln, Gesang und Tanz bis zum Morgengrauen, Mariä Himmelfahrt auf Karabane, unterbrochen nur von einem Wolkenbruch.
Der Regen hat den Strand abgeschwemmt, an diesem sonnigen Morgen warte ich am Ufer mit einem frischen ›Gazelle‹-Bier auf das Schiff. Die Fischer kommen mit dem Fang zurück, Amath hat einen Capitaine von etwa 25 kg im Boot. An den Enden der Bucht fischen Männer in ihren Einbäumen, im Hintergrund Trommeln, die Leute von Karabane begrüßen mich mit meinem Namen. Am Mittag taucht am Horizont die ›Joola‹ wieder auf, wie aus dem Nichts wimmelt es nun wieder von Piroguen von allen umliegenden Inseln, die Fisch, Obst und Fleisch nach Dakar verkaufen. Pünktlich ist die Marine zur Stelle, durchsucht die Insel. Moudou begleitet mich zu den Soldaten, an ihrem Stand am Strand lösen wir die Fahrkarte gegen den Pass ein. Moudou ist einer der Schätze, die die Welt an dieser Stelle bereit hält, uneigennützig, hingebungsvoll helfend, sie geben mit Selbstverständlichkeit, uneingedenk eines ökonomischen Wertes ihres Handelns. Etienne zieht mich einfach mit sich, mit seiner Pirogue fahren wir zum Schiff hinaus, dann bin ich wirklich gefordert. Ist die Pirogue in einem Wellental, schwebt die Plattform des Schiffes einige Meter über uns; auf dem Wellenberg habe ich eine Chance, klammere mich an die glitschige Leiter, vorn einen Rucksack, hinten einen Rucksack, und springe beim dritten Mal auf die nasse Metallfläche, rutsche aus und fliege in einen Korb mit lebenden Barracudas.
Nach 10 Jahren schon ist das Schiff völlig heruntergekommen, verdreckt und verrostet, die Schlagseite ist ein Konstruktionsfehler. Durch stinkende Fischbrühe im Schiffsinneren, in dem sich schon viele Frauen mit Kindern niedergelassen haben, denn hier kostet die Überfahrt nichts, quälen wir uns durch die dicht gedrängte Menge die enge Treppe hoch zu einem Aufenthaltsraum mit Schlafsesseln, das Gepäck kommt auf einen großen Haufen in die Obhut der Armee. Im Chaos der mehrfach belegten Sessel entsteht eine friedliche Ess- und Trinkszene, alles wird geteilt. Ich bin schrecklich zerstochen, auf dem Boden laufen seltsame Ungeziefer, über der Mündung des Flusses donnern Gewitter, Regen peitscht auf die undichten Fenster des Schiffes, auf dem Boden überall Rinnsale, an Schlaf ist nicht zu denken auf diesem schwül-heißen Sklavenschiff. Der Gang zur Toilette wird zur Mutprobe, die Türen sind herausgerissen, die Kabinen voller Exkremente, die Wasserpumpen funktionieren nicht, alle Frauen entleeren sich mitten in den Vorraum, der keinerlei Luftabzug hat.
Draußen auf dem Vorschiff ist es herrlich, die Casamance-Mündung, im aufgewühlten Meer rollt das Schiff bedenklich unter dem Sternenhimmel vorbei an Banjuls Lichterkette, überall flackern die kleinen Laternen der Fischerboote, groß und nah Orion. An der Reling sitzt auf einem Poller eine dicke Nutte in rotem Kleid, die ganze Nacht bereit, zwischen den Tauen hocken wir zusammen und reden, reden.
Als wir in Dakar einlaufen, ist es noch Nacht, ich bin völlig zerschlagen, habe Halsschmerzen von der ständigen Zugluft, schleppe mein Gepäck durch das dunkle Hafenviertel Richtung Plateau, versuche, den Gedanken an Gefahren auszublenden. Das ›St. Louis‹ ist noch verschlossen, aber der hinter der Tür auf dem Boden schlafende Wächter wacht von meinem Klopfen auf, ich darf auf den Ledersesseln im ›Salon‹ schlafen, später wird ein Zimmer frei. Im Spiegel sehe ich mich zerlumpt, verdreckt, zerkratzt und blutig, hier erst merke ich, wie ich stinke.
Schreiben im ›Café de Paris‹ an der avenue Mohammed V, Wunden lecken, Pläne machen, ein café crème, noch einmal die Katen, Laubengänge und Werkstätten im Plateau-Viertel. Durch Zufall treffe ich Sophie und Marion wieder, also essen und erzählen im ›Poty‹, dem skurrilen Treff der ehemaligen französischen Kolonialbeamten, die von alten Zeiten schwadronieren, einschlafen mit Radio France International aus dem kleinen Weltempfänger, wunderbar.
In einem der bunt bemalten Kleinbusse, die Farben verdecken den deplorablen Zustand dieser Wagen, geht es nach Norden, nach St. Louis, die französische Handelsstation an der Mündung des Senegal-Flusses. Drei Pannen, natürlich, mit dem Öl, dem Wasser und den Reifen, schmerzhaft stechen die scharfen Kanten der Sitze. Es zieht mich wieder auf die Langue de Barbarie, die sandige Landzunge zwischen Flussmündung und Ozean, zu Nicole in eine Hütte am Strand. Der Senegal ist mächtig angeschwollen, führt braunen Schlamm mit sich. Wieder wird die Phantasie beflügelt von dem Denkmal an der Hydrobase, hier liegt der Ursprung der ›Aéropostale‹, auf dieser Landzunge startete Mermoz 1930 seinen ersten Postflug nach Brasilien. An der Mündung bin ich in Sand und Wind allein mit den wilden Hunden, die umeinander spielen. Sie haben sich über und neben mich gelegt, als ich im letzten Jahr hier im Sand geschlafen habe. Im Radio höre ich von schlimmen Überschwemmungen am Casamance, von Schießereien in Ziguinchor, es gab drei Tote.
Vorbei am muslimischen Fischerfriedhof kommt man in das afrikanische Viertel der Fischer, die Frauen haben den Fang zerlegt, gesalzen und zum Trocknen auf Holzgestelle gelegt. Hier herrscht in zahllosen kleinen Moscheen Serigne Touba, die Bruderschaft der Mouriden. Das Leben auf der Insel im Fluss ist bestimmt von der französischen Kolonialarchitektur mit dem Charme des Verfalls, hier steht die erste Kathedrale auf afrikanischem Boden, hierher kamen die ersten Nonnen, hier finde ich auf Marmor am Eingangsportal so einfache und darum so schockierende Forderungen: Bevor du hier eintrittst – Va d’abord te réconcilier avec ton frère! – versöhne dich erst mit deinem Bruder! Celui qui manque trop du pain quotidien n’a plus aucun goût au pain de Jésus-Christ – Wer allzu sehr des täglichen Brots ermangelt, hat keinen Appetit mehr auf das Brot Christi!
Auf der Nordhälfte der Insel, hinter den baumbestandenen Alleen mit den restaurierten belgischen und französischen Konsulaten, ist afrikanisches Leben in die Welt hinter den Fassaden eingezogen, in den Innenhöfen Lehmhütten und Brunnen, Tiere, die um die Wäsche streifen, spielende Kinder unter Bäumen. Ich ziehe weiter über den pont Faidherbe auf das gegenüberliegende Festland nach Sor, will unbedingt den alten Kolonialbahnhof sehen. Wie so oft frage ich mich, warum ich das alles hier mache, mein Leben lang gemacht habe. Ein Gedanke hat sich festgesetzt, vielleicht all das, weil mein ›Onkel Adi‹, Freund meiner geschiedenen Mutter, Afrika-, Indien- und Amazonasforscher, nicht mein ›Vater‹ hat werden können, ihm, der bedingungslosen Liebe des Kindes, habe ich immer folgen wollen, habe immer in der Fremde Väter gesucht. Der Bahnhof, lange schon stillgelegt, ist arg heruntergekommen, aber wunderschön, davor ein lebhafter Markt, die Händler haben Wartehalle und Schienengelände vereinnahmt, auf dem Bahnsteig brodelt das Leben der Familien, eine Rückeroberung. Der pont Faidherbe aber rostet gefährlich, über den Eisenträgern der Fußgängerspur liegen dünne alte Holzbretter, viele sind zerbrochen oder in den Fluss gefallen, so dass wir auf den Trägern über den Fluss balancieren müssen.
Auf dem Rückweg spricht mich ein vielleicht 30-jähriger Mann an, er arbeitet als Fischer für einen patron, seine Eltern sind tot, als einziger Mann ist er für fünf Töchter und unverheiratete Schwestern verantwortlich. Das Vermögen für die Verheiratung der Schwestern aufzubringen ist für ihn eine untragbare Bürde, er verdient viel zu wenig. Sein Verdienst von 2.500 FCFA reicht gerade aus, dass er eine Zigarette am Tag für sich hat. Jetzt hat er Syphilis in fortgeschrittenem Stadium, fühlt sich immer schwächer, bräuchte Antibiotika für 20.000 FCFA, zeigt mir die Anweisung des Arztes. Diese Summe kann er nicht aufbringen, er muss arbeiten gehen, kann aber nicht mehr, sieht keine Chance auf Behandlung, da es weder Kranken- noch Sozialversicherung gibt, der patron hilft ihm nicht. Er bittet mich, die Kosten für die Behandlung zu übernehmen, ich schlage ihm vor, das Geld aus Deutschland schicken zu lassen, er solle seine Adresse aufschreiben und bei Nicole abgeben. Er hat es nicht getan.
An der gare routière geht ein Wagen mit 7 Plätzen Richtung Rosso in Mauretanien, unterwegs liegen etliche verbeulte oder ausgebrannte Wagen. Die Frau neben mir hat 10 l Dickmilch mitgebracht, beugt sich mit ihrem voluminösen Bauch ächzend nach unten und säuft wie eine Kuh aus dem Eimer, wir alle müssen probieren. Die Straße wird immer schlechter, in Flussnähe schlingern wir durch den Matsch bis zur Grenzstation. Da drüben ist Mauretanien, der Ponton liegt in der Strömung fest, also springe ich zwei Meter tief mit dem Gepäck in die überfüllte Pirogue. Einige Meter vor dem anderen Ufer läuft das Boot auf, also das Gepäck über Kopf und bis zu den Rippen im Wasser durch den Fluss auf den Strand, wo mich der Grenzbeamte breitbeinig, die Arme in die ausladenden Hüften gestemmt, schon erwartet.