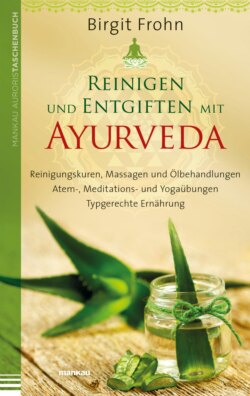Читать книгу Reinigen und Entgiften mit Ayurveda - Birgit Frohn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Prinzipien des Ayurveda
„Die Gesetze des Ayurveda sind universell gültig und zeitlos. Sie beschreiben die Natur des Lebens selbst“
Aus der Caraka Samhita
Die Konzepte der traditionellen indischen Medizin bestechen durch ihre globale Sichtweise: In der ayurvedischen Vorstellung von der Natur und den Menschen ist alles ein Teil des großen Ganzen.
Nur wenige Lehren umfassen das Zusammenwirken von allem Leben in der Natur auf so einleuchtende und kompakte Weise. Dabei ist Ayurveda nicht dogmatisch wie manche Religion, hat keinen alleinigen Gültigkeitsanspruch und steht darüber hinaus allen Menschen offen. Im Ayurveda gibt es daher auch keine starren Gesetze und Regeln, sondern lediglich Empfehlungen.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Attraktivität des Ayurveda resultiert auch daraus, dass alle Empfehlungen durchweg einfach anzuwenden und leicht verständlich sind. Von grundlegender Bedeutung für die gute Wirksamkeit wie für die hohe Beliebtheit der ayurvedischen Lehre ist ferner, dass sie stets an die verschiedenen Konstitutionstypen und deren Erfordernisse angepasst ist.
Fünf Elemente und drei Doshas
Die westliche Weltsicht und Vorstellung von der Natur geht, sehr vereinfacht formuliert, von zwei Ebenen aus – der Ebene der Materie und der Ebene der Energie. Im Gegensatz zur greifbaren und manifesten Materie erscheint uns Energie in der Regel abstrakt, dennoch ist auch sie „fassbar“. So kann Energie von einem Ort zum anderen fließen, zu- oder abnehmen sowie beispielsweise als Elektrizität in Batterien gespeichert werden.
Nun zum Ayurveda: Auch sein Konzept basiert, auf das Wesentliche reduziert, auf zwei Ebenen. Die eine der beiden umfasst Prinzipien, die als die fünf Grundelemente bezeichnet werden. Der andere Eckpfeiler, auf dem das Wissen vom guten Leben ruht, ist die Lehre von den drei Doshas, also von Vata, Pitta und Kapha. Der Begriff Dosha steht für dushya, zu Deutsch „etwas, das gestört werden kann“. Das weist bereits auf die Natur der Doshas hin: Ihr gesunder – ausgewogener – Zustand ist nicht stabil und kann mitunter aus dem Gleichgewicht geraten, weshalb unsere Gesundheit eben auch störanfällig ist. Dazu lesen Sie jedoch später noch mehr.
Universelle Bausteine
Gemäß der bereits vorgestellten Samkhya-Philosophie (S. 13) ist alles auf der Erde mit dem großen Ganzen des Universums verbunden und ein Teil dessen – eine untrennbare und intensive Wechselbeziehung, die in der gemeinsamen Abkunft der Schöpfung gründet. Ihr zufolge gilt in der ayurvedischen Lehre der Grundsatz, dass die gesamte belebte und unbelebte Natur aus den immer gleichen fünf Elementen besteht. Diese sind Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde.
Die Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) fußen ebenfalls auf diesen fünf Elementen. Entsprechend erfolgen die Behandlungen dieser bewährten Medizintradition stets unter Berücksichtigung der fünf Elemente und ihrer Eigenschaften.
Auch das Abendland hat die fünf Elemente schon früh in seine Philosophie integriert. So entwickelte sich in der griechischen Antike die Lehre von den vier Elementen Luft, Feuer, Wasser und Erde. Aristoteles ergänzte diese schließlich noch um das Element Äther, das später als Quintessenz – von quinta essentia, „fünftes Seiendes“ – bezeichnet wurde. Die Elementlehre verlor auch in den folgenden Jahrhunderten innerhalb der abendländischen Kultur nie ganz an Bedeutung. Unter anderem bezog sich Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust I auf den wichtigen Stellenwert der Elemente: „Wer sie nicht kennte, die Elemente, ihre Kraft und Eigenschaft, wäre kein Meister über die Geister.“
Alles hängt mit allem zusammen
Nach der Auffassung der ayurvedischen Lehre, der zufolge „alles fließt“, wirken sich sämtliche Veränderungen der Umgebung und alle Handlungen unmittelbar auf unser Befinden aus. Das gilt beispielsweise für die Tages- und Jahreszeiten, die Ernährung und das Wetter, Schlaf, Freude oder Kummer. Denn im Ayurveda wird unter „Elementen“ nicht nur das Materielle, sondern die Gesamtwirkung unserer Umwelt, auch der nichtstofflichen, auf den Organismus verstanden: Alles, was von „außen“ kommt, enthält die fünf Elemente und nimmt damit Einfluss auf uns. Auf Grund dieser direkten Einwirkung variiert auch die Zusammensetzung der Elemente, aus denen unser Körper besteht, ständig. Das verleiht jedem Individuum seinen eigenen unverwechselbaren Charakter, bestimmt die Besonderheiten seines Körpers und auch seine Schwächen und Stärken.
Die Elemente und ihre Entsprechungen
Wie eben angeklungen, werden den fünf Elementen im Ayurveda sowohl materielle als auch immaterielle, energetische Eigenschaften zugeordnet. Und auch diese finden sich im menschlichen Organismus.
Äther
Das Element Äther, oft auch Raum genannt, steht für fehlenden Widerstand. Im menschlichen Organismus wird Äther durch die Hohlräume des Magen-Darm-Trakts und des Brustraums, den Mund- und Rachenraum, die Atemwege sowie durch die Blutgefäße, also Arterien und Venen, repräsentiert. Weiterhin wird dieses Element in Beziehung zum Ohr sowie der Zunge und damit der Sprache gesetzt.
Luft
Luft steht für Ausdehnung und Bewegung. Dieses Element ist in allen Bewegungsabläufen im Körper manifestiert sowie in der Nerven-, Lungen- und Herzfunktion. Ihm zugeordnet sind ferner die Haut sowie der Anus.
Feuer
Dieses Element steht für Hitze. Im menschlichen Organismus ist es abgebildet in den komplexen Abläufen des Stoffwechsels, also unter anderem der Verdauung. Nicht umsonst spricht die ayurvedische Lehre auch vom „Verdauungsfeuer“, Agni (S. 206). Feuer wird jedoch auch durch die Hirnfunktionen und damit durch alle intellektuellen und mentalen Fähigkeiten repräsentiert. Darüber hinaus sind dem Element unsere Augen sowie die Geschlechtsorgane zugeordnet.
Wasser
Auch hier ist die Zuordnung ganz offensichtlich. Das Element Wasser ist, ganz gemäß dessen Beschaffenheit, allem Flüssigen zugeordnet. Es manifestiert sich in Urin, Schleim, Speichel, Tränen, Gewebe- und Zellflüssigkeit. Zudem ist es lebenswichtig für die Aufrechterhaltung sämtlicher Organfunktionen. Darüber hinaus sind ihm die Zunge und der Gaumen sowie die Füße zugewiesen.
Erde
Erde steht für Festigkeit, Rauheit und Form. Sie manifestiert sich im Skelett und im Bewegungsapparat mit allen Muskeln, Bändern und Sehnen. Darüber hinaus ist dieses Element in der Haut und den Haaren ausgeprägt. Dem Element zugeordnet sind ferner die Nase sowie die Hände.
In einer weiteren Form finden wir die fünf Elemente auch in unserer Nahrung wieder. Das heißt, ein wärmendes Feuer kann genauso Einfluss auf einen Menschen haben, wie eine warmherzige Umarmung, ein Gericht mit „feurigen“ Gewürzen oder die Begegnung mit einem Menschen, der einem feindlich gesonnen ist und der sich aggressiv und zornig gibt. All diese Ausprägungen stehen beispielsweise für das Element Feuer. Da alle Elemente auch in immaterieller „übertragener“ Form existent sind, können sie sich über bestimmte Gesten oder in der speziellen Wesensart eines Menschen ausdrücken.
Die Elemente und die Sinnenwelt
Die fünf Elemente sind auch eng mit allen sinnlichen Empfindungen verbunden – mit jenen Eindrücken, über die wir spontan und ganz unmittelbar die Welt erfassen und uns darin zurechtfinden. Der Geist als analytisches und zusammenfassendes Werkzeug benötigt diese sinnlichen Erfahrungen als sein Rohmaterial.
Jedem der fünf universellen Bausteine ist auch einer unserer Sinne, ein Sinnesorgan, eine bestimmte ausführende Tätigkeit und ein körperliches ausführendes Werkzeug oder Organ zugeordnet. Selbst wenn das einem bestimmten Sinn zugehörige Tätigkeitsorgan oder -werkzeug zunächst befremdlich erscheinen mag: Dahinter liegt wohlüberlegt ein tieferer Sinn, der vor allem bei der Diagnose von körperlichen Beschwerden ein wichtige Rolle spielt.
Die Sinne schärfen
Die Empfehlungen des Ayurveda halten auch dazu an, ganz intensiv auf die innere Stimme zu hören. Die unmittelbarsten Botschafter sind hierbei die Sinnesempfindungen. Sie leiten einen oft genauso gut wie der viel beschworene Instinkt der Tiere – jenes wichtige Instrument, das der Mensch im Lauf der Evolution leider größtenteils verloren hat. Wer jedoch wieder lernt, sich auf seine Sinneseindrücke wie etwa Gerüche oder Geschmack zu verlassen, und das kann prinzipiell jeder, lebt eindeutig gesünder und ist zufriedener. So lassen sich durch das Wahrnehmen der inneren Stimme beispielsweise Speisen vermeiden, die dem Körper nicht guttun. Schließlich weiß er sehr genau, welche Nährstoffe er im Moment benötigt, und Ihre Nase bringt ihn dabei auf den richtigen Weg. Kurz gesagt: Wenn ein bestimmtes Gericht angenehm riecht, tut es Ihrem Körper und Ihrer Seele gut.
Äther und die Sinne
Hören und Horchen gehören zum Element Äther, da in ihm der Schall übertragen wird. Sein Sinnesorgan ist unser Ohr, die ausführenden Strukturen sind Mund und Stimmbänder – grundlegend für unsere Kommunikation mit anderen Menschen um uns.
Luft und die Sinne
Dem Element Luft wird die Haut zugesprochen und somit auch der dazugehörige Tastsinn. Unsere Hände wirken als ausführendes Werkzeug dieses Sinnes, indem sie festhalten, annehmen und weitergeben.
Feuer und die Sinne
Zum Feuer, das bekanntermaßen mit Licht, Wärme und Farbigkeit assoziiert wird, gehört der Sehsinn. Dadurch, dass wir mit unseren Augen sehen können, können wir unseren Bewegungen ganz bewusst eine Richtung geben. Aus diesem Grund wird das Feuer auch mit den Tätigkeiten des Gehens und Laufens und damit mit den Füßen als ausführenden Werkzeugen zusammengebracht.
Wasser und die Sinne
Wasser wiederum geht Hand in Hand mit dem Geschmackssinn und damit mit der Zunge. Als ausführende Organe sind diesem Element unsere Fortpflanzungsorgane und unsere Sexualität zugeordnet.
Erde und die Sinne
Der Geruchssinn und damit auch unsere Nase werden dem Element Erde zugeordnet, ebenso wie die Ausscheidungsfunktionen des Körpers über den Darm beziehungsweise den Darmausgang.
Die drei Doshas – dynamische Bioenergien
Bildet man aus den fünf Elementen Paare, erhält man die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Die Verbindung von Äther und Luft wird zu Vata, Feuer allein zu Pitta und die Mischung aus Erde und Wasser zu Kapha. Diese drei Doshas – die Tridosha – sind die zweite tragende Säule, auf der das Fundament des Ayurveda ruht. Dosha bedeutet übersetzt „Stütze“, was bereits die Funktion verdeutlicht: Sie (unter)stützen den Organismus, indem sie alle körperlichen und seelischen Vorgänge in uns steuern. Insofern sind die drei Doshas auch als Bioenergien zu sehen.
Diese befinden sich in einem dynamischen Gleichgewicht: Sie sind wechselseitig voneinander abhängig, um gemeinsam wirksam werden zu können. Man kann die Doshas vor diesem Hintergrund auch mit Musikinstrumenten vergleichen, die zusammen ein Klangbild ergeben. Um jedoch nicht falsch zu klingen, müssen sie aufeinander abgestimmt sein.
Oder, noch anschaulicher, ein Vergleich mit der Feinabstimmung der Farben bei einem Fernseher. Dominiert eine Farbe zu sehr, beispielsweise Blau, wird das Bild blaustichig. Übertragen auf die Doshas bedeutet das: Steht beispielsweise Vata zu sehr im Vordergrund, erhält die gesamte Persönlichkeit diese Tönung.
Funktionen und Sitz der Doshas
Die Doshas stehen für Regelkreise oder Grundprinzipien, welche unsere verschiedenen Erscheinungstypen sowohl im gesunden als auch im kranken Zustand prägen und alle unsere körperlichen, geistigen und seelischen Vorgänge steuern. Sie selbst bleiben dabei unsichtbar, doch zeigen sie sich in sichtbaren körperlichen, geistigen und seelischen Merkmalen.
Die Doshas stellen zum einen grundlegende Regulationssysteme dar, welche die Funktionsweise des Organismus bestimmen: Jedes Dosha ist in allen Zellen, Geweben und Organen des Körpers wirksam und hat darüber hinaus eine geistige sowie seelische Funktion. Dies ist der Grund, warum der ayurvedische Arzt nie die Ganzheit des Körpers aus den Augen verlieren kann, selbst wenn er sich nur mit bestimmten Symptomen befasst. Zum anderen erklären die drei Doshas die Wechselbeziehung des Menschen mit seiner Ernährung und der gesamten Umwelt und machen so das komplexe System des menschlichen Organismus überschaubar. Sie zeigen, wie die menschliche Natur in die Gesetze des Universums eingebettet ist.
Obwohl die drei Doshas in jeder Zelle des Körpers zugegen sind, hat jedes seinen Hauptsitz, in dem seine Funktionen klar repräsentiert sind. Das Zentrum von Vata liegt im Dickdarm, in dem Schlackenstoffe und Nahrungsüberreste eingetrocknet und ausgeschieden werden, sowie im kleinen Becken. Pitta sitzt im unteren Drittel des Magens, im Zwölffingerdarm und im Dünndarm, also dort, wo die hauptsächliche Verdauungsarbeit stattfindet. Kapha ist in den oberen zwei Dritteln des Magens und im Brustraum lokalisiert. Im Magen hat dieses Dosha die Aufgabe, Nahrung aufzuweichen und in ihre Bestandteile zu zerlegen.
Unterschiedliche Konstitutionen
Nach der Auffassung der ayurvedischen Lehre sind die Tri-dosha bei jedem von uns seit dem Moment unserer Entstehung im Mutterleib in einem bestimmten und einzigartigen Verhältnis zueinander angelegt. So besitzt jeder von Geburt an seine eigene, unverwechselbare Natur mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben, beispielsweise für bestimmte Nahrungsmittel oder klimatische Bedingungen. Ebenso regeneriert sich jeder Körper auf verschiedene Art und Weise, ist unterschiedlich aktiv beim Aufbau von Körpergewebe und arbeitet auf verschiedene Art und Weise bei der Entgiftung und Entschlackung über das Verdauungssystem. Auch emotional ist jeder Mensch anders „gestrickt“, verhält sich seiner Umwelt gegenüber eher extrovertiert oder ist schüchtern, hat diese oder jene gefühlsmäßige Ausstattung beziehungsweise angenehme oder sozial unverträgliche Charaktereigenschaft.
Jeder von uns besitzt also eine individuelle Konstitution, die vom Mischungsverhältnis der Doshas bestimmt wird.
Die kleinsten Regelkreise im Kosmos
Anhand der Doshas, die alle körperlich-geistig-seelischen Vorgänge und Zustände regulieren, wird wieder der Zusammenhang von den Kräften deutlich, die im Kosmos wirksam sind. Genauso, wie uns die Doshas mit ihren nach innen wirkenden Kräften prägen, so beeinflussen sie sich gegenseitig, stehen zudem in Wechselwirkung mit der Natur und mit der Ernährung sowie den verschiedenen Reizen, die aus der Umwelt auf uns einströmen.
Entsprechend gibt es unterschiedliche Konstitutionstypen, mithilfe derer sich unter anderem Aussagen über die physischen und psychischen Veranlagungen eines Menschen machen lassen, was für Diagnose und Therapie gleichermaßen hilfreich ist.
Die Subdoshas
Neben ihren Hauptsitzen haben die drei Doshas noch weitere funktionelle Schwerpunkte im Körper. So ist beispielsweise Vata neben dem Dickdarm auch in der Harnblase, in den Nieren, im Anus, in den Hüften, Beinen und Füßen sowie in den Knochen lokalisiert. Pitta sitzt neben dem Dünndarm und Magen auch in der Leber, im Blut und in der Lymphflüssigkeit, im Herzen sowie in den Augen, im Schweiß und in der Haut. Kapha schließlich ist neben dem Brustraum und dem Magen auch im Kopf, Nacken und in den Gelenken vertreten.
Auf diese Weise lassen sich jedem der drei Doshas fünf untergeordnete Funktionskreise, die Subdoshas, zuordnen, die miteinander in Beziehung stehen. Das Beispiel von Apana-Vata, eines Subdoshas von Vata, soll das Prinzip der untergeordneten Teilfunktionen der drei Doshas verdeutlichen: Apa-an bedeutet wörtlich übersetzt „Bewegung nach unten“. Gemeint sind damit alle körperlichen Funktionen, die nach unten gerichtet sind. Sie können unter dem Begriff Elimination, zu der die Ausscheidung von Stuhl, Urin, Menstruationsblut, Samenflüssigkeit und der Geburtsvorgang gehören, zusammengefasst werden. Apana-Vata ist im unteren Bauchraum, im Dickdarm, in der Blase und den weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen lokalisiert.
Aus geistiger Sicht steht Apana für die Fähigkeit, loslassen zu können. Ist Apana-Vata gestört, blockiert oder in seiner Aktivität vermindert, kann sich das im Festhalten an negativen Gedanken und Gefühlen äußern. Auf körperlicher Ebene zeigen sich Beeinträchtigungen von Apana-Vata in Störungen der ihm zugeordneten Funktionen. Ein typisches Krankheitsbild für ein gestörtes Apana-Vata sind Menstruationsprobleme, etwa eine ausbleibende oder schmerzhafte Periode. Die Schmerzausstrahlung während der Menstruation entspricht auch der Lokalisation dieses Subdoshas, das im Rücken und Unterleib sowie in den Hüften und Oberschenkeln angesiedelt ist.
Generell können alle Schmerzzustände im unteren Bauchraum, im Rücken, in den Lenden, den Hüften und den unteren Extremitäten Folge akuter oder chronischer Funktionsstörungen von Apana-Vata sein. Wie einige andere Subdoshas nimmt auch Apana-Vata eine Schlüsselfunktion in der Entstehung körperlicher oder geistiger Störungen ein. Es ist gewissermaßen die Wurzel von Vata und häufig grundlegende Ursache einer Vielzahl komplexer geistiger wie körperlicher Symptome, die sich fernab des Sitzes von Apana-Vata manifestieren und so scheinbar nicht mit ihm in Zusammenhang stehen. Die erfolgreiche Behandlung der Schlüsselstörungen führt deshalb zu einer tief greifenden Heilung und ganzheitlichen Normalisierung des Gleichgewichts der drei Doshas.
Basis der Gesundheit: Gleichgewicht der Doshas
Als grundlegende Voraussetzung für die Erhaltung und Wiederherstellung unserer Gesundheit wird im Ayurveda das Gleichgewicht der drei Doshas erachtet. Gleichgewicht bedeutet dabei jedoch nicht, dass alle Doshas zu gleichen Teilen in unserem Körper vertreten sein müssen. Vielmehr geht es hier um die individuelle Balance eines Dosha. Bewegen sich ein oder mehrere Doshas aus ihrem Gleichgewichtszustand, greift das in die physischen wie psychischen Regelkreise ein – und ebnet den Weg für gesundheitliche Störungen und Krankheiten.
Gerät etwa Vata aus dem Gleichgewicht, können Gewichtsverlust, Schwäche, Verstopfung, Lähmungen, Arthrose, Bluthochdruck, raue Haut, Angst, Ruhe- und Schlaflosigkeit die Folgen sein. Im ausgeglichenen Zustand bringt Vata hingegen Vitalität und Abwehrkraft, gesunden Schlaf, gute Funktion von Darm und Harnorganen, richtige Bildung der Körpergewebe sowie Heiterkeit und einen klaren und wachen Geist. Störungen von Pitta können in Verdauungs- und Leberfunktionsstörungen, Entzündungen, Hautkrankheiten, ungenügendem Schlaf, großer Körperhitze und damit starkem Schwitzen, übersäuertem Magen und Reizbarkeit resultieren. Ist Pitta im Gleichgewicht, zeigt sich das an guter Verdauung, klarer und reiner Haut, einem geschmeidigen Körper, ausgewogener Körperwärme sowie einem ausgeglichenen Seelenleben. Kapha-Störungen führen zu einem vermehrten Aufbau von Körpergewebe und damit zu Übergewicht, schwachen Gelenken, großem Schlafbedürfnis und Trägheit sowie zu Blässe, Kälte, Benommenheit und Depressionen. Im ausgeglichenen Zustand bringt Kapha Kraft, Würde, gesunde Gelenke, geistige Stabilität, Nachsicht und menschliche Liebe, Mut, Vitalität und einen kraftvollen, wohlproportionierten Körper.
Sämtliche therapeutische Maßnahmen des Ayurveda zielen darauf ab, die Balance der drei Doshas zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Den damit erreichten Zustand der Harmonie zwischen den Doshas nennt man im Ayurveda „sattwa“. Dieses Sanskrit-Wort steht auch für Liebe, Ausgeglichenheit und Klarheit der Gedanken. Um Sattwa zu erreichen, bedient sich der Ayurveda verschiedener Methoden. Welche das sind, ist im Kapitel „Ayurvedischer Behandlungskanon“ (ab S. 69) aufgeführt.
Die sieben „Gewebe“: die Dhatu
Der Ayurveda unterscheidet weiterhin sieben verschiedene Arten von Gewebe, die Dhatu. Dies bedeutet übersetzt „aufbauendes Element“ und beschreibt deren Funktion: Die Dhatu sind für die gesamte Struktur unseres Körpers verantwortlich. Sie ermöglichen die Funktion unserer verschiedenen Organe und Organsysteme und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Ernährung des Körpers. Dhatu sind darüber hinaus Bestandteil unseres Immunsystems, denn wenn ein Dhatu nicht mehr richtig arbeitet, zieht es auch die nach ihm folgenden in Mitleidenschaft – denn jedes Dhatu wird vom vorangegangenen ernährt. Das Abwehrsystem wird somit beeinträchtigt, und die Anfälligkeit für Krankheiten steigt an.
Alle sieben Gewebearten sind also direkt miteinander verbunden und voneinander abhängig, weil sie sich in einem fortwährenden Umwandlungs-, Auf- und Abbauprozess befinden. Dieser dient der Aufrechterhaltung sämtlicher Funktionsabläufe und Reaktionen unseres Körpers. Befinden sich Vata, Pitta und Kapha im Ungleichgewicht, sind davon auch alle Dhatu betroffen. Störungen der drei Bioenergien und damit verbunden Fehlfunktionen der Gewebe ermöglichen die Entstehung von Krankheiten. Der Ayurveda beschreibt deshalb für jedes der sieben Dhatu auch spezifische Krankheiten und deren Behandlung.
Srota – das „Kanalsystem“ des Körpers
Mit Srota bezeichnet man im Ayurveda die Kanälchen unseres Körpers, in denen Stoffe transportiert werden. Dabei wird unterschieden in Srota, die den Körper versorgen, und solche, die den Körper entsorgen. Zu Ersteren gehören die Bronchien und das Magen-Darm-System, zu Letzteren die ableitenden Harnwege und der Dickdarm. Blutgefäß- und Lymphsystem zählen ebenso zu den Srota wie die Kapillaren, die Poren in der Zellwand und die Transportwege innerhalb der Zelle. Ayurveda beschreibt für jedes Gewebe ein eigenes System von Srota.
Rasa – Plasma, Zellflüssigkeit: Plasma enthält die Nährstoffe, die mit der Nahrung aufgenommen werden, und gibt sie über den Blutkreislauf an alle anderen Gewebe und damit an alle Organe unseres Körpers weiter.
Rakta – Blut(system): Blut versorgt Gewebe und Organe mit lebenswichtigem Sauerstoff sowie Nährstoffen und erhält so die Funktionen aller nachfolgenden Gewebe – Muskeln, Fett, Knochen, Nervensystem und Keimzellen.
Mamsa – Muskelgewebe: Muskeln werden vom Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und können so ihre Aufgaben erfüllen. Sie schützen die empfindlichen Organe, ermöglichen Bewegung und geben unserem Körper seine physische Kraft.
Meda – Fettgewebe: Fett speichert Nährstoffe und schützt die Organe, Muskeln und Knochen wie ein Polster.
Astha – Knochengewebe: Das knöcherne Skelett stützt unseren Körper und hält ihn aufrecht.
Majja – Knochenmark und Nervensystem: Das Knochenmark ernährt die Knochen. Die Nerven leiten motorische und sensorische Impulse – Befehle zu Bewegung und Sinneswahrnehmungen – an ihre Erfüllungsorgane wie Muskeln oder Gehirn weiter.
Sukra – Samen und Eizellen: Die Keimzellen dienen unserer Fortpflanzung und geben das Erbmaterial, also alle Informationen über Organe, Gewebe und Funktionen unseres Körpers, an unsere Nachkommen weiter.
Die Konstitutionstypen
Die in jedem Menschen vorhandenen drei Doshas sind von Geburt an in einem für jeden von uns charakteristischen Verhältnis angelegt. Dabei können ein, zwei oder alle drei Doshas vorherrschen. Die dominierenden Doshas prägen mit ihren Eigenschaften unsere körperlichen, geistigen und seelischen Merkmale. Entsprechend geht man im Ayurveda von verschiedenen Konstitutionstypen aus. Die Konstitution beschreibt unsere Stärken, aber auch unsere Schwachstellen. Sie erlaubt Aussagen über die Krankheitsanfälligkeit und erklärt die unterschiedlichen Reaktionen auf Ernährung, Sinneseindrücke, Klima oder Lebensumstände. Bei der Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten spielt deshalb unser Konstitutionstyp immer eine entscheidende Rolle. Nachfolgend sind die drei Doshas und ihre charakteristischen Eigenschaften vorgestellt. Allerdings ist zu beachten, dass alle Menschen Mischtypen sind. Niemand ist also rein Vata, Pitta oder Kapha. Bei jedem sind alle drei Doshas vorhanden, nur eben in unterschiedlicher Gewichtung.
Vata-Dosha – Lenker der Doshas
Vata ist das aus den beiden Elementen Luft und Äther entstandene Dosha. Damit repräsentiert es das Prinzip der Bewegung: Ihm obliegt die Regelung sämtlicher Bewegungsabläufe in unseren Körperzellen und Eingeweiden. Auch die Muskeltätigkeit, die Funktionen der inneren Organe und Sinnesorgane sowie die Aktivität des Gehirns und des Nervensystems unterliegen der Kontrolle von Vata. Dieses Dosha steuert ferner das Wachstum und bewirkt Wachheit, Klarheit sowie Kreativität. Es kann entsprechend auch als „Schrittmacher der biologischen Aktivität“ gelten, der Kommunikation und Stofftransport im Körper reguliert.
Vata aktiviert und kontrolliert die beiden unbeweglichen Doshas Pitta und Kapha. Befindet sich Vata im Gleichgewicht, so sind es die anderen beiden in den meisten Fällen auch. Vata-Dosha sind folgende Attribute zugeordnet: beweglich, schnell, leicht, kalt, subtil, rau und trocken.
Körperliche Lokalisation
Vata-Dosha ist im unteren Körperdrittel, mithin im Beckenraum mit den Hüften, den Geschlechtsorganen sowie im Dickdarm angesiedelt. Auch in unserem Gesicht ist die Vata-Region im unteren, beweglichen Drittel mit Mund und Ohren zu finden. Ist Vata-Dosha übermäßig aktiviert und dominiert es die anderen Doshas, staut es sich in den genannten Regionen und kann hier entsprechende Störungen bewirken.
Charakteristische körperliche Ausprägung
| → | leichter Knochenbau |
| → | schlanke, mitunter zu schlanke Figur |
| → | verhältnismäßig schwach entwickelte Muskulatur |
| → | hervortretende Knochen, Gelenke und Venen |
| → | eher dunkler Teint mit Neigung zu Muttermalen und Sommersprossen |
| → | Neigung zu trockener Haut |
| → | langsamer Haarwuchs |
| → | brüchige Nagelsubstanz |
| → | Veranlagung zu körperlichen Unregelmäßigkeiten, wie beispielsweise Überbiss oder Beckenschiefstand |
| → | ausgeprägte Geräusch- und Berührungsempfindlichkeit |
| → | unterschiedlich stark ausgeprägter Appetit |
| → | unregelmäßige Verdauung |
| → | Neigung zu Verstopfung |
| → | Abneigung gegen kaltes und windiges Wetter |
| → | leichter und unterbrochener Schlaf |
Charakteristische geistige Ausprägung
| → | schnelle Auffassungsgabe |
| → | gutes Kurzzeitgedächtnis |
| → | große Fantasiebegabung |
| → | begeisterungsfähig |
| → | offen und gesprächig |
| → | mitunter vergesslich |
| → | ab und an unkonzentriert |
Charakteristische seelische Ausprägung
| → | oft wenig ausgeprägter Wille und mangelndes Selbstvertrauen |
| → | Neigung zu Sorgen und Kummer |
| → | wechselhaftes, unstetes Wesen |
| → | wechselhafte emotionale Verfassung |
| → | Stimmungsschwankungen |
| → | Neigung zu einer unregelmäßigen Lebensführung |
Vata-Effekte und Vata-Störungen
Im ausgeglichenen Zustand fördert Vata Vitalität und Abwehrkraft, gesunden Schlaf, sorgt für eine gute Funktion von Darm und Harnorganen und den Aufbau der Körpergewebe. Auf psychischer Ebene bewirkt dieses Dosha Heiterkeit und einen klaren und wachen Geist.
Ist Vata aus dem Gesamtgleichgewicht der Doshas geraten, kommt es zu rascheren Verfallsprozessen, und der Körper magert ab, da sämtliche organischen Abbauvorgänge beschleunigt werden. Entsprechend ist das Frühstadium einer Krankheit häufig von Vata-Dosha dominiert. Weitere charakteristische Vata-Störungen sind unter anderem Schlafprobleme, Erschöpfung, chronische Müdigkeit, Nervosität und hektische Anspannung sowie Ängste und Verkrampfungen. Typisch für ein gestörtes oder zu dominantes Vata sind darüber hinaus Verstopfung, Blähungen, nervöse Magenbeschwerden und Menstruationsbeschwerden.
Pitta-Dosha – Schrittmacher des Stoffwechsels
Pitta wird aus den beiden Elementen Feuer und Wasser gebildet. Es repräsentiert den Temperatur- und Wärmehaushalt in unserem Körper, reguliert unsere Verdauung und wirkt maßgeblich auf die Aktivität des Stoffwechsels ein. So ist Pitta auch die steuernde Instanz des Verdauungsfeuers Agni (S. 206), welches in der ayurvedischen Heilkunde eine wichtige Rolle spielt. Weiterhin werden die Intelligenz und die Auffassungsgabe sowie der emotionale Ausdruck eines Menschen von Pitta gesteuert. Die Attribute von Pitta-Dosha sind: heiß, scharf, leicht, sauer, durchdringend und feucht-ölig.
Körperliche Lokalisation
Pitta ist im mittleren Körperdrittel angesiedelt, in den Verdauungsorganen, den Nieren und der Leber. Darüber hinaus ist dieses Dosha in der Haut, dem Bindegewebe, im Blut sowie in den Blutgefäßen lokalisiert. In unserem Gesicht ist ebenso das mittlere Drittel mit Nase und Wangen diesem Dosha zugeordnet.
Charakteristische körperliche Ausprägung
| → | schlanker und wohlproportionierter Körper |
| → | üblicherweise nur leichte Gewichtsschwankungen |
| → | mittelstark ausgeprägte Muskulatur und Knochenbau |
| → | hellerer Teint mit Neigung zu Sommersprossen und Muttermalen |
| → | gut durchfeuchtete und weiche Haut |
| → | sonnenempfindliche Haut |
| → | feines Haar |
| → | Neigung zu Haarausfall und frühzeitigem Ergrauen der Haare |
| → | weiche Nagelsubstanz |
| → | stark ausgeprägter Hunger |
| → | viel Durst |
| → | kann Mahlzeiten schlecht ausfallen lassen |
| → | bevorzugt kalte Speisen und kühle Getränke |
| → | Neigung zu verstärktem Schwitzen |
| → | gute Stoffwechselfunktionen |
| → | gute Verdauung |
| → | guter und erholsamer Schlaf |
| → | sehr empfindlich gegenüber Nahrungsgiften und Drogen |
| → | Abneigung gegen Hitze |
Charakteristische geistige Ausprägung
| → | gute Auffassungsgabe |
| → | systematische und gut organisierte Arbeitsweise |
| → | scharfsinnig und analytisch |
| → | rhetorisch sehr begabt |
| → | kann Erlerntes systematisch wiedergeben |
| → | ehrgeizig |
| → | typische „Anführernatur“ |
| → | sehr konzentrationsfähig |
Charakteristische seelische Ausprägung
| → | auffällige Intensität des Wesens |
| → | unternehmungslustig und mitunter sogar kühn |
| → | anspruchsvoll, genuss- und luxusorientiert |
| → | hitziges Gemüt |
| → | leicht erregbar |
| → | ungeduldig und mitunter verletzend |
| → | rasch eifersüchtig |
| → | ab und an angeberisch |
| → | empfindsam gegenüber einer „unguten“ Atmosphäre |
Pitta-Effekte und Pitta-Störungen
Ist Pitta im Gleichgewicht, folgen daraus eine gute Verdauung, klare und reine Haut, ausgewogene Körperwärme, Zufriedenheit und eine ausgeglichene Gemütsverfassung.
Ist Pitta-Dosha gestört oder im Übermaß aktiv, treten Entzündungen, fieberhafte Infekte, Sodbrennen, Magenbeschwerden sowie Hautkrankheiten und Sehstörungen auf. Im emotionalen Bereich können sich Pitta-Störungen als Ungeduld, Zorn sowie Eifersucht und sogar Hass bemerkbar machen.
Kapha-Dosha – Fundament der Vitalität und Widerstandsfähigkeit
Dieses Dosha entstand aus dem Zusammenschluss der beiden Elemente Wasser und Erde. Es liefert das Baumaterial für unsere Körperstrukturen, hält sie zusammen und stabilisiert sie. Damit verleiht Kapha uns Stabilität sowie Energie und fördert unsere körpereigenen Abwehrkräfte. Darüber hinaus ist dieses Dosha für die Regulation des Flüssigkeitshaushalts verantwortlich und stärkt Gelenke sowie Bindegewebe. Das Immunsystem und die Herz-Lungen-Funktionen werden ebenso durch Kapha beeinflusst. Auf sein Konto gehen zudem Wiederaufbau und Regeneration der Körpergewebe sowie Wachstum. Angesichts dieser Funktionen steht ein ausgeglichenes Kapha-Dosha im Ayurveda für gute Gesundheit und ein ausgeglichenes Gemüt schlechthin.
Kapha-Dosha sind die Attribute schwer, kalt, süß, ölig, wässrig glatt, stabil, langsam, fest und träge zugeordnet.
Körperliche Lokalisation
Die Kapha-Region liegt im oberen Körperdrittel. Da dieses Dosha auch mit den Körperflüssigkeiten assoziiert wird, lokalisiert man es in allen Schleimabsonderungen und Körpersekreten sowie im Brustraum, im Hals-Nasen-Rachen-Raum und im Zellplasma. Auch im Gesicht ist Kapha im oberen Drittel lokalisiert und umfasst entsprechend Stirn und Augen.
Charakteristische körperliche Ausprägung
| → | starker, kraftvoller Knochenbau |
| → | Neigung zu Übergewicht und Rundlichkeit |
| → | gut entwickelte Muskulatur |
| → | große Kraft und Ausdauer |
| → | kaum sichtbare Venen |
| → | anmutige Beweglichkeit |
| → | ausgeglichener Energiehaushalt |
| → | heller Teint |
| → | weiche und feste Haut |
| → | Neigung zu fetter Haut |
| → | kräftiges, vielfach welliges Haar |
| → | starke Nagelsubstanz |
| → | kräftige, stabile Zähne |
| → | regelmäßiger Appetit |
| → | geringes Hungergefühl |
| → | eher träge Verdauung |
| → | wenig Schweißabsonderung |
| → | tiefer und langer Schlaf |
Charakteristische geistige Ausprägung
| → | langsame Auffassungsgabe |
| → | gutes Langzeitgedächtnis |
| → | methodische und bedachte Arbeitsweise |
Charakteristische seelische Ausprägung
| → | entspanntes und ausgleichendes Wesen |
| → | ruhige und beständige Persönlichkeit |
| → | schwer aus der Ruhe zu bringen |
| → | an Körperempfindungen orientiert |
| → | tolerant und nachsichtig |
| → | vergebend und liebevoll |
| → | mitunter wenig ausgeprägter Wille |
| → | besitzorientiert, neigt zum Horten |
| → | Neigung zu Stimmungsschwankungen |
Kapha-Effekte und Kapha-Störungen
Im ausgeglichenen Zustand bringt Kapha-Dosha viel Energie und Vitalität, erhöht die geistige Stabilität und schenkt Mut, Liebesfähigkeit sowie Nachsicht.
Störungen und Dominanz von Kapha-Dosha können einen vermehrten Aufbau von Körpergewebe bewirken und damit zu Übergewicht und Trägheit führen. Weiterhin charakteristisch sind schwache Gelenke, ein überhöhtes Schlafbedürfnis und depressive Verstimmungen.
Doshas regulieren
Die ayurvedische Lehre hält individuell abgestimmte Empfehlungen zur Regulierung der Doshas bereit – allen voran auf Basis der Ernährung, gezielter körperlicher Maßnahmen und des Lebensstils.
| → | Kapha-regulierend wirken die persönliche Weiterentwicklung in geistigen Bereichen sowie körperliche Aktivität, eine abwechslungsreiche Arbeit und leichte, warme, maßvolle Mahlzeiten. |
| → | Pitta-regulierend ist ein ausgeglichener Lebensrhythmus, bei dem vor allem beim Essen und bei anderen Genussmitteln Maß gehalten werden sollte. |
| → | Vata-regulierend sind entspanntes Liegen und Meditieren, ausreichender Schlaf und ein regelmäßiger Tagesablauf. |
Ayurvedische Uhr: die Rhythmen der Doshas
„Die Ursachen von Krankheiten des Körpers wie auch des Geistes sind dreifach: falscher, fehlender und übermäßiger Gebrauch von Zeit, Verstand, Sinnen und Objekten.“
Aus der Caraka Samhita
Die ayurvedische Lehre befasst sich sehr genau mit den Biorhythmen, die jeder von uns tagtäglich sowie im Laufe seines Lebens durchläuft. Ziel ist es, zu verhindern, dass man aus dem natürlichen Lebenstakt gerät. Denn nach ayurvedischer Auffassung wird dadurch die Entstehung von Krankheiten begünstigt: Wer sein inneres Gleichgewicht verliert, wird anfälliger für geistig-seelische und körperliche Störungen. Unser Anliegen sollte es daher stets sein, sich den biologischen Zyklen anzupassen und im Einklang mit ihnen zu leben.
Alle Biorhythmen können von den drei Doshas abgeleitet werden. Eine große praktische Bedeutung haben dabei die Perioden der Tages- und Jahreszeiten und die unterschiedlichen Lebensphasen eines Menschen. Entsprechend unterscheidet man im Ayurveda verschiedene, von Vata, Pitta und Kapha dominierte Phasen und gibt dafür konkrete Empfehlungen. Diese betreffen die Ernährung, berufliche und private Aktivitäten sowie das allgemeine Verhalten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um starre Richtlinien, die streng befolgt werden müssen. Vielmehr sind diese Empfehlungen als Anregung und Richtschnur für einen gesundheitsfördernden Lebensstil nach den Prinzipien des Ayurveda zu verstehen.
Die Doshas von morgens bis abends
An jedem Tag gibt es zwei Zyklen, in denen die drei Doshas aufeinanderfolgen. Während dieser Zeiträume beeinflussen sie maßgeblich die Funktionen unseres Organismus.
Diese Phasen erstrecken sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang:
Biorhythmen
An jedem Tag durchlebt unser Organismus viele verschiedene Phasen: rhythmische Veränderungen, die sich auf Körper, Geist und Seele unterschiedlich stark auswirken. So gibt es beispielsweise diverse Perioden der vermehrten Hormonausschüttung, Zeiten, in denen wir geistig und körperlich leistungsfähiger sind, sowie Phasen, in denen unser Körper besonders viel Ruhe benötigt.
In den letzten Jahren wurden viele Biorhythmen untersucht, die so lebenswichtige Körperfunktionen wie Herzschlag oder Atemfrequenz betreffen. Seither ist bekannt, dass einige der körpereigenen Rhythmen bereits in der Erbsubstanz, also genetisch festgelegt sind. Andere hingegen werden durch äußere Zeitgeber aktiviert. Solche natürlichen Zeitgeber sind der Lauf der Sonne, die Phasen des Mondes und die Jahreszeiten. Viele der biologischen Rhythmen und der mit ihnen einhergehenden körperlichen Veränderungen sind darüber hinaus von klimatischen Bedingungen und den verschiedenen Lichtverhältnissen der Jahreszeiten beeinflusst und ziehen sich entsprechend lange hin.
Erster Zyklus
| von 6 bis 10 Uhr | Kapha-Dosha |
| von 10 bis 14 Uhr | Pitta-Dosha |
| von 14 bis 18 Uhr | Vata-Dosha |
Zweiter Zyklus
| von 18 bis 22 Uhr | Kapha-Dosha |
| von 22 bis 2 Uhr | Pitta-Dosha |
| von 2 bis 6 Uhr | Vata-Dosha |
Um ein gesundes Leben im Sinne des Ayurveda zu führen, sollte man die persönliche Tagesgestaltung nach diesen Zyklen ausrichten. Die ayurvedische Lehre gibt hierzu einfache Empfehlungen, die helfen, den eigenen Lebensrhythmus an jenen der Natur anzupassen.
Das Aufstehen
Der Tag beginnt bei den meisten Menschen unter dem Einfluss von Kapha. Morgens nach dem Aufwachen fühlen sie sich meist noch etwas träge, entspannt und ruhig, aber auch gestärkt durch den Schlaf – alles Eigenschaften, die diesem Dosha zugeordnet werden. Die traditionelle indische Heilkunde empfiehlt allerdings, noch während der Vata-Phase, also vor 6 Uhr morgens aufzustehen – auch wenn dies manchem schwerfallen mag. Doch die Eigenschaften von Vata, seine Beweglichkeit und Leichtigkeit, machen es einfacher, frisch und aktiv in den Tag zu starten. Die vitale Stimmung des Tagesbeginns begleitet einen dann über den ganzen Tag. Wenn Sie dagegen zu lange, bis weit in die Kapha-Phase hinein im Bett bleiben, erwachen Sie schwerer und fühlen häufig noch eine bleierne Müdigkeit in sich.
Das Frühstück
Ihr Frühstückstisch sollte mit dem gedeckt sein, was Ihrer jeweiligen Konstitution am zuträglichsten ist (S. 216). Wer morgens lange braucht, um wach zu werden – das ist vor allem bei Kapha-Typen der Fall – und bei wem sich der Hunger erst am späten Vormittag einstellt, dem reicht etwas Obst oder nur Tee oder Saft. Vata-Konstitutionen, meist eher zarte Naturen, sowie Pitta-Typen mit ihrer starken Verbrennung können dagegen kräftiger frühstücken.
Die Mittagszeit
Von 10 bis 14 Uhr übernimmt Pitta die Führung über den Organismus. Dies ist für viele Menschen die produktivste Phase des Tages, während der Lernfähigkeit und Kreativität ihren Zenit erreichen. Entsprechend stellt sich nun auch meist großer Appetit ein, der durch ein nicht zu spätes Mittagessen, nach Möglichkeit der größten Mahlzeit des Tages, gestillt werden sollte.
Agni, das Verdauungsfeuer (S. 206), sowie der Stoffwechsel laufen nun auf Hochtouren und können eine ausgiebige Mahlzeit gut verarbeiten.
Der Nachmittag
Die erste Pitta-Zeit des Tages endet nun, und es folgt eine kurze Zeit abflauender Leistungsbereitschaft. Die Zeiger der inneren Uhr wandern jedoch jetzt in die Vata-Phase. Mit ihr bekommen Körper und Geist wieder neuen Schwung, sodass Konzentrationsfähigkeit und geistige Leistungsbereitschaft nachmittags noch einmal ihren Höchststand erreichen.
Die meisten Menschen fühlen sich jedoch gerade nachmittags besonders müde. Das liegt daran, dass sie ein schwaches Agni (S. 206) und infolgedessen keine gute Verdauung haben – ihnen also oft das Mittagessen noch zu schaffen macht. Diesen Menschen seien verdauungsstärkende Maßnahmen besonders empfohlen (S. 209).
Der Abend
Der zweite Tageszyklus beginnt gegen 18 Uhr abends ebenfalls wieder mit einer Phase unter dem Regiment von Kapha. In dieser Phase liegt der ideale Zeitpunkt für ein kleines Mahl, mit dem Kapha, biologische Stärke, aufgenommen wird. Am besten essen Sie gleich zu Beginn dieser Zeitspanne, nachdem die Vata-Phase zu Ende gegangen ist. Sehr viel später ist der Stoffwechsel wieder träge und kann Nahrung nur mehr schwer verdauen.
Die letzte Mahlzeit Ihres Tages sollte in jedem Fall leicht sein und wenig tierisches, schwer verdauliches Eiweiß enthalten. Ein anschließender Spaziergang unterstützt Agni sowie Magen und Darm in ihrer Aktivität und hat eine beruhigende Wirkung auf Ihren Geist und Ihre Seele. Ansonsten sollte Ihr Abend zur Erholung und zur Einstimmung auf die bevorstehende Nachtruhe dienen.
Die Nacht
Als beste Zeit, zu Bett zu gehen, gilt im Ayurveda das Ende der Kapha-Phase – mithin gegen 22 Uhr. Nun stellt sich in der Regel ein natürliches Schlafbedürfnis ein, das Körper und Geist entsprechend den Eigenschaften dieses Doshas ruhig stimmt und so auf die Nacht vorbereitet. Danach beginnt wieder eine neue biologische Phase, in der Pitta dominiert und in der neue Energien freigesetzt werden. Wenn Sie später zu Bett gehen, kann Sie die anschließende Pitta-Zeit erneut zu Aktivitäten aufmuntern. Das ist der Grund warum man oft noch lange wach bleiben kann, wenn der „tote Punkt“ erst einmal überwunden ist. In der nächtlichen Pitta-Phase findet zudem die Regeneration unseres Körpers und damit auch unserer Haut statt. Jetzt werden abgestorbene Hautzellen erneuert und mögliche Schädigungen durch Umwelteinflüsse beseitigt. Die anschließende Dominanz von Vata in den frühen Morgenstunden drückt sich in der besonders aktiven Traumphase aus, die nun durchlaufen wird. Die Hirnimpulse sind nun am aktivsten. Angeregt von ihnen wachen wir schließlich auf. Der Kreis schließt sich nun und beginnt von neuem mit der Phase von Kapha-Dosha.
Die Doshas im Lauf der Jahreszeiten
Wie von den einzelnen Tageszeiten werden Körper, Geist und Seele auch vom Wechsel der Jahreszeiten bestimmt: Die Merkmale der drei Doshas spiegeln sich in den Eigenschaften der Jahreszeiten wieder. Deshalb hat auch das Jahr seine den Doshas entsprechenden Zyklen. Sie beginnen ebenfalls mit einer Kapha-Phase und stellen insofern ein Abbild der Tagesrhythmen dar.
Im Gegensatz zu unserer Jahreszeitenberechnung unterscheidet man im Ayurveda allerdings sechs statt vier Jahreszeiten, die auf zwei Hälften aufgeteilt werden. In der einen Hälfte bewegt sich die Sonne in der nördlichen Hemisphäre, in der anderen innerhalb der südlichen. Der nördliche Lauf, Uttaryana genannt, setzt mit dem 21. Dezember ein und endet mit dem 21. Juni. Ab dann beginnt Dakshinaya, die Zeit, in der sich die Sonne gen Süden bewegt und die Kraft ihrer Strahlen wieder abnimmt. Der Einfachheit halber können die sechs ayurvedischen Jahreszeiten zu drei zusammengefasst werden.
Kapha-Zeit:
Frühling und Frühsommer: Mitte März bis Mitte Juni
Pitta-Zeit:
Sommer und Frühherbst: Mitte Juni bis Mitte Oktober
Vata-Zeit:
Spätherbst und Winter: Mitte Oktober bis Mitte März
Ebenso wie für die einzelnen Tageszeiten gibt uns die ayurvedische Lehre auch Empfehlungen für die verschiedenen Jahreszeiten, um in ihrem Lauf im Gleichgewicht und damit gesund zu bleiben. Generell gilt, dass man in der Jahreszeit besonders auf sich achten sollte, die dem eigenen Konstitutionstyp entspricht: Kapha-Menschen im Frühjahr, Pitta-Menschen im Sommer und Vata-Menschen im Winter. In diesen „kritischen“ Zeiten sollte man sich verstärkt an den Ernährungsempfehlungen orientieren, die der eigenen Konstitution förderlich sind. Vata ist zudem bei jedem Jahreszeitenwechsel besondere Beachtung zu schenken, unabhängig davon, welcher Typ man ist. Denn dieses Dosha, das für Beweglichkeit und Veränderung steht, reagiert besonders empfindlich auf Wetterwechsel und erhöht die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten.
Frühling und Frühsommer
Jetzt ist die Zeit von Kapha, denn durch die allmähliche Erwärmung „schmilzt“ gewissermaßen auch unser Winterspeck und führt zu einer Anreicherung von Ama, Schlacken und Giftstoffen (S. 208), sowie Kapha in unserem Körper. Daher sollten jetzt Kapha reduzierende Maßnahmen wie Entschlackungskuren und Fastentage auf dem Programm stehen, mit deren Hilfe man fit und gestärkt in den Sommer gehen kann. Eine Kapha reduzierende Ernährung (S. 221) ist jetzt für alle Konstitutionen das Richtige. Entsprechend sollten in den Frühjahrsmonaten warme Speisen und Getränke mit den Geschmacksrichtungen scharf, bitter und herb auf dem Speiseplan stehen.
Sommer und Frühherbst
In den Sommermonaten dominiert Pitta. Im Ayurveda geht man davon aus, dass die Sonne, wenn sie im Norden steht, austrocknend wirkt und daher zu einem Energieverlust führt – nicht umsonst fühlen wir uns in der heißen Jahreszeit oft schlapp und müde und haben weniger Antrieb als im Winter. Aufgrund der großen Wärme von außen dreht unser Körper auch die innere Flamme, das Verdauungsfeuer Agni (S. 206), herunter, und wir haben weniger Appetit. Ideal sind in dieser Jahreszeit leichte Gerichte, die gut gewürzt sein sollten, um das schwache Agni anzuregen. Zu bevorzugen sind generell süße, bittere und herbe Speisen. Saure und salzige Nahrungsmittel sollten Sie nun eher meiden.
Beim Sonnenbaden ist zu berücksichtigen, dass die Sonnenstrahlen nach ayurvedischer Auffassung nur bis 10 Uhr morgens eine vitalisierende und kräftigende Wirkung haben. Ab diesem Zeitpunkt, besonders über Mittag und am frühen Nachmittag ziehen Sonnenbäder eher Energien ab und schwächen den Organismus. Daher sollten Sie den Vormittag zum Sonnen nutzen und sich nachmittags dagegen bevorzugt im Schatten aufhalten.
Spätherbst und Winter
Die kühlen, stürmischen Herbsttage und die klirrende Kälte der Wintermonate sind überwiegend die Zeit von Vata. Jetzt, wo die Sonne wieder im Süden steht, nimmt auch unsere Energie wieder zu, und wir fühlen uns aktiver und kräftiger. Im Spätherbst, der meist eher feuchtkalt ist, kommt es zunächst zu einer Zunahme von Kapha, der Sie ebenso wie im Frühjahr mit Fasten- und Entschlackungstagen begegnen sollten.
Mit der trockenen Kälte in den späteren Wintermonaten, etwa ab Mitte Dezember, reichert sich dann vor allem Vata an. Jetzt gilt es, sich besonders gut vor Erkältungen zu schützen und den Körper durch Abhärtung auf die herannahende kalte Zeit vorzubereiten. Weiterhin sollten Sie bevorzugt Vata reduzierende Nahrung (S. 217) zu sich nehmen und sich fetter und nahrhafter als sonst während des Jahres ernähren. Denn der Körper braucht nun viel Energie, um sich „aufzuheizen“ und Widerstandskraft zu erlangen. Durch das in den kalten Wintermonaten sehr kräftige Agni brauchen Sie sich auch keine Sorgen um Ihr Gewicht zu machen – jetzt kann viel mehr gegessen werden als im Sommer, ohne dabei zuzunehmen.
Lebensphasen und Doshas
„Vata beherrscht das letzte Stadium des Lebens, den Tag, die Nacht und die Verdauung, Pitta das mittlere Stadium und Kapha das Anfangsstadium.“
Aus der Ashtanga Hridaya Sutrasthana
Kindheit, Erwachsenenzeit und Alter gelten im Ayurveda als die drei Jahreszeiten des Lebens. Sie unterliegen ebenso wie die einzelnen Abschnitte des Tages und des Jahres dem Einfluss der drei Doshas. Während der ersten Entwicklungsphase, dem Säuglingsalter und der Kindheit, dominiert Kapha. In dieser Zeit werden unsere Gewebe aufgebaut, und der Körper erhält seine Struktur. Gerät Kapha aus dem Gleichgewicht, können Symptome von zu viel Kapha auftreten, so zum Beispiel Erkältungen, Husten, Verschleimungen der Luftwege und Lungenerkrankungen. Auf dem Höhepunkt des Zyklus, in unserem Erwachsenenalter, wirkt die Kraft von Pitta. Dieser Lebensabschnitt ist geprägt von Aktivität und Schaffenskraft, denn Pitta verleiht jetzt die nötige Energie, um Vorhaben zu realisieren und sich im täglichen Leben durchzusetzen. Im Herbst des Lebens vermehrt sich Vata. Alte Menschen unterliegen vor allem dem Einfluss dieses Doshas. Das zeigt sich auch deutlich an den charakteristischen Alterserscheinungen: In diesem Lebensalter besteht die Tendenz zu trockener Haut und Faltenbildung, einem geringen Schlafbedürfnis, Osteoporose und Gelenkkrankheiten.
Während der Übergangsphasen von einem Dosha zum anderen, beispielsweise von Kapha zu Pitta, also von der Kindheit zur Erwachsenenzeit, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen. Denn der Organismus muss sich nun an veränderte Bedingungen anpassen, wodurch seine Widerstandsfähigkeit zeitweise beeinträchtigt ist. So gelten im Ayurveda Pubertät und Menopause als Übergänge des Lebens und sind kritische Phasen seelischer und körperlicher Unausgewogenheit mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Störungen des Wohlbefindens.
Die Gesamtheit des Menschen im Blick
Ayurveda sieht uns Menschen stets unter Berücksichtigung unserer individuellen Beschaffenheit – als Ergebnis verschiedener Energien und Stofflichkeiten, die sich im Triumvirat von Körper, Geist und Seele unterschiedlich ausprägen. Erfährt eine der drei Ebenen zu wenig Beachtung, gerät deren symbiotisches Wirken aus dem Takt und der so wichtige Gleichklang ist gestört. Was in der ayurvedischen Medizin unter dem Begriff „Behandlung“ verstanden wird, ist daher ein Austarieren der Waagschalen von Körper, Geist und Seele. Deren Gleichgewicht ist unabdingbar zur Wiederherstellung wie auch zur Erhaltung unserer Gesundheit.
Vor diesem Hintergrund wird im Ayurveda auch der Patient an sich und in seiner Ganzheit behandelt, nicht die Krankheit: Im ayurvedischen Sinn bedeutet Gesundheit nicht einfach nur das Fehlen von Krankheit. Die Behandlung des Patienten schließt insofern die Behandlung der Krankheit mit ein. Bei der Behandlung von Krankheit muss die Therapie aber nicht unbedingt direkt am Patienten ansetzen, sondern kann beispielsweise auch eine Regulierung seines Umfelds betreffen – eine Herangehensweise, die die westliche Schulmedizin im Gros der Fälle leider vernachlässigt. Menschen als Ganzes zu behandeln, bedeutet in der Praxis, die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Konstitutionstypen in vollem Umfang zu berücksichtigen. Nicht von ungefähr bezieht ein ayurvedischer Arzt bei der Behandlung eines Patienten immer dessen individuelle Konstitution im Wechselspiel mit seiner Psyche wie seiner Umwelt mit ein. Zweifelsohne gründen die guten Erfolge ayurvedischer Therapiemaßnahmen mit darauf, dass diese stets den Menschen in dessen Gesamtheit im Blick haben und sich nicht auf allein stehende Symptome beschränken.
Gesundheit und Krankheit im Ayurveda
Gesundheit und Krankheit sind aus ayurvedischer Sicht keine sich gegenseitig ausschließenden Zustände, sondern gehen vielmehr ineinander über. Was sie verbindet, ist der gemeinsame Nenner Immunität. Solange die Immunkraft intakt ist, bleiben wir gesund. Nimmt sie jedoch ab, können krank machende Faktoren die Überhand gewinnen. Die klassischen Lehrschriften widmen sich nicht ohne Grund so ausführlich der Immunologie: Ayurveda kann insofern auch als Immuntherapie bezeichnet werden.
Die therapeutischen Strategien sind deshalb im Ayurveda weit gefächert. Sie umfassen neben einer speziell abgestimmten Medikation und gezielten Reinigungsbehandlungen in der Regel auch eine Ernährungsumstellung, die auf die individuelle Konstitution abgestimmt ist. Erfahren Sie dazu mehr im nächsten Kapitel dieses Buches, das Ihnen das breite Spektrum der ayurvedischen Medizin ausführlich präsentiert.