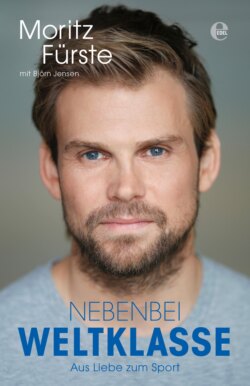Читать книгу Nebenbei Weltklasse - Björn Jensen - Страница 5
K A P I T E L 1 15 MONATE WAHNSINN
ОглавлениеEs gab keinen Knall, und es gab auch keinen Schmerz in dem Moment, der meine Karriere in das Vorher und das Nachher teilt. Ich bin einfach irgendwie hängen geblieben mit meinem Knie, als ich mich an meinem Gegenspieler Sebastian Biederlack vorbeischlängeln wollte. Ich stürzte, stand wieder auf, spielte weiter. Etwas schwammig fühlte es sich an, das rechte Knie, aber das war nichts, was mich daran gehindert hätte, dieses Testspiel gegen den Club an der Alster zu beenden. Schließlich sollte eine Woche später die Feldbundesligasaison 2011/12 beginnen, und ich war in der Form meines Lebens.
Zehn Tage zuvor war ich mit den deutschen Herren Europameister geworden, bei der Heim-EM in Mönchengladbach. Das war, nach dem WM-Triumph von 2006, der nächste Coup im eigenen Land, und für mich war es ein ganz besonderes Turnier. Im Juni 2011 hatte sich meine damalige Freundin und heutige Frau Stephanie von mir getrennt, nach acht Jahren Beziehung. Zusammengekommen waren wir, bevor meine Leistungssportkarriere richtig Fahrt aufnahm, und deshalb war es das erste Mal, dass ich mit der Bürde spielte, im Privatleben einen schweren Einschnitt erlebt zu haben.
Man kann also durchaus behaupten, dass Steph mitverantwortlich für all das war, was in den 15 Monaten des Wahnsinns, wie ich sie rückblickend nenne, auf mich einstürzte. Sie hatte mich mit ihrer Entscheidung, mich zu verlassen, zum ersten Mal in meinem Leben dazu gebracht, mich selbst zu hinterfragen. Und ein bisschen Selbstreflexion hatte ich wahrlich mehr als nötig. Ich machte an der SRH Fernhochschule Riedlingen ein Fernstudium in Wirtschaftspsychologie und befand mich in einer Findungsphase, die nicht nur mein Privatleben, sondern auch den Sport mit einschloss.
Vor der Trennung von Steph hatte ich nie etwas darum gegeben, was andere von mir hielten oder wie ich auf mein Umfeld wirkte. 2006 hatte ich, als 21-Jähriger, im WM-Finale, das wir 4:3 gewannen, ein Tor gegen Australien geschossen, 2008 hatte ich mit dem Uhlenhorster HC erstmals die Euro Hockey League gewonnen, und danach war ich in Peking Olympiasieger geworden. Das waren alles frühe Erfolge, die ich nie richtig verarbeitet hatte. Als Weltmeister und Olympiasieger fühlte ich mich unverwundbar, in Zeitungsinterviews sagte ich so Sachen wie, ich könne auf den Mond fliegen und den Mann im Mond umdribbeln. Kurz: Ich gab mich als Freak, der meinte, sich nicht an Regeln halten zu müssen, und der sein Ding machte. Und ich dachte nicht daran, dass andere ein Problem damit haben könnten. Ich war der coole Mo, das junge Supertalent. Dass meine bisweilen zynische, auf jeden Fall aber ziemlich selbstsichere Art bei vielen Menschen negativ ankommen könnte, damit rechnete ich nicht.
Ich konnte lange nicht verstehen, warum viele mich nicht mochten oder sich doch sehr reserviert zeigten. Ich dachte: Ich bin doch immer nett! Erst als Steph mich verlassen hatte, wurde mir klar, dass ich etwas ändern musste.
Zwar nicht meinen Charakter – man kann sich nicht verbiegen, darum geht es auch gar nicht –, aber ich musste an meinem Auftreten arbeiten. Ich hatte mich in den Monaten vor der EM zu einem arroganten Besserwisser entwickelt, der andere kritisierte, ohne sich selbst je zu hinterfragen. Mein Ziel war stets der größtmögliche Erfolg, aber mein Auftreten war, so wurde mir klar, alles andere als zielführend. Ich musste es anders anpacken. Es lag an mir, etwas zu verändern.
Mit diesen Gedanken beschäftigte ich mich während der Vorbereitung auf die EM intensiv. Umso glücklicher war ich dann, dass es tatsächlich funktionierte. Ich hatte mir vorgenommen, als Leader, als Führungsspieler zu agieren, aber gleichzeitig mannschaftsdienlicher zu spielen, meine Mitspieler mehr in mein Spiel einzubeziehen, ohne meine eigenen Stärken zu vergessen. Aufgrund der privaten Probleme war der Sport mehr denn je ein Ventil für mich. Ich konzentrierte mich voll und ganz auf Hockey und gab alles für den Erfolg.
Mit 26 Jahren, die ich damals alt war, hatte ich das optimale Leistungssportleralter erreicht. Mit unserem Konditionstrainer Rainer Sonnenburg hatte ich sehr viele zusätzliche Trainingseinheiten absolviert und befand mich athletisch auf einem sehr hohen Niveau. Dazu kam die Erfahrung, die ich in den vielen internationalen Turnieren, die ich mittlerweile gespielt hatte, gesammelt hatte. Nicht zuletzt aber waren wir eine großartige Mannschaft. In der Vorrunde schlugen wir Belgien und Spanien jeweils mit 3:1 und Russland mit 7:0. Im Halbfinale gewannen wir die Regenschlacht gegen England mit 3:0, das Spiel stand wegen Starkregens und überflutetem Platz kurz vor dem Abbruch, aber wir wollten unbedingt am selben Abend zu Ende spielen und schafften es mithilfe von Bierbänken, das Wasser vom Kunstrasen zu schieben.
Im Finale machten wir dann gegen unseren Erzrivalen Niederlande im ausverkauften Warsteiner Hockeypark ein unfassbar geiles Spiel, siegten 4:2 – ich traf kurz vor der Pause per Siebenmeter zum 2:1: Es war sportlich ein absolutes Sahnestück, das wir als Team ablieferten. Ich wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt und hatte auch selber das Gefühl, das höchste Level meines sportlichen Könnens erreicht zu haben. Die Flucht vor den privaten Sorgen in den Sport hatte sich für mich ausgezahlt. Oder anders ausgedrückt: Die Auseinandersetzung mit mir selbst hatte mich zumindest zu einem besseren Hockeyspieler werden lassen.
Dass dieser Prozess damit nicht abgeschlossen sein, sondern erst beginnen würde – damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Wie im Hockey üblich, begann 14 Tage nach dem EM-Finale bereits die Bundesligasaison. Nach einer Woche Pause ging es für meine Nationalmannschaftskollegen und mich wieder ins UHC-Training und in das zu Beginn erwähnte Testspiel gegen Alster. Ich spürte, dass ich meine EM-Form hatte konservieren können, und schwebte förmlich über den Platz. Drei Tore schoss ich in der ersten Halbzeit, mir gelang wirklich alles. 20 Minuten vor Schluss fädelte ich beim Zweikampf mit Sebastian Biederlack ein, blieb hängen und stürzte. Nach dem Spiel sagte ich unserer Physiotherapeutin, dass mein rechtes Knie ein wenig instabil wirke, und sie empfahl mir, eine Kernspintomografie machen zu lassen. Also ging ich am nächsten Morgen in die MRT-Praxis eines Hamburger Krankenhauses. Ich hatte überhaupt keine schlechte Vorahnung, sondern dachte, dass es maximal darum ginge, ein paar Tage mit dem Training auszusetzen. Im Wartezimmer daddelte ich gelangweilt an meinem Telefon herum, als der Arzt mich aufrief, um mir lapidar mizuteilen, dass mindestens ein Teilriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie vorliege.
Ich hatte mir als Jugendlicher oft die Bänder im Fuß gerissen, weil mein Körper im Wachstum recht instabil war. Ich hatte diverse Knochenbrüche erlitten – Handgelenke, Nase, einmal sogar eine Schädel- und Jochbeinfraktur, als ich in der Halle das Knie eines Gegenspielers ins Gesicht bekam. Aber das waren alles Verletzungen, die mich nicht länger als einen Monat beschäftigt hatten. Und nun sollte ich plötzlich einen Kreuzbandriss haben? Das, wovor Sportler sich so fürchten, weil es in der Regel mindestens ein halbes Jahr Pause bedeutet? Ich stand unter Schock, konnte nicht einmal heulen, obwohl mir genau danach zumute war.
Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss: Es sind nur noch zehn Monate bis London! Und nur noch acht, bis die Nominierungen bekannt gegeben werden! Es ist verrückt, dass man in solchen Momenten nicht in erster Linie daran denkt, was eine solche Verletzung für den eigenen Körper bedeutet oder welche Auswirkungen es auf das Alltagsleben haben wird. Der alles beherrschende Gedanke war zunächst: Du musst es unbedingt in den Olympiakader schaffen! Und danach kamen sofort auch die Zweifel: War es das jetzt, vielleicht für immer?
Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nur das vordere Kreuzband betroffen war. Oftmals gehen mit Kreuzbandrissen auch Totalschäden im Knie einher, die nicht nur sehr schmerzhaft sind, sondern auch Operationen und im Anschluss daran lange Rehabilitationszeiten erfordern. Bei mir war die Substanz so gut, dass ich nach drei Wochen Pause, nach denen die Schwellung im Knie vollständig verschwunden war, ohne OP mit der Reha anfangen konnte. Das war am 29. September 2011. Zuvor war ich von Arzt zu Arzt gelaufen, um verschiedene Meinungen über das weitere Vorgehen einzuholen, und auf Anraten unseres UHC-Vereinsarztes Jörg Huhnholz und des Hamburger Kniespezialisten Carsten Lütten hatte ich mich schließlich gegen eine Operation entschieden.
Für mich war klar, dass mein vorderes Kreuzband nicht wieder so zusammenwachsen würde, dass es die Haltefunktion ausfüllen könnte, für die es in unserem Körper vorgesehen ist. Das bedeutete, ich musste die Muskulatur um die betroffene Region herum so stark aufrüsten, dass sie die Funktion des Kreuzbandes mit übernehmen konnte. Rund 25 Prozent der Halte- und Stützarbeit verrichtet das Kreuzband, also wusste ich, was mein Ziel war: mindestens 25 Prozent.
Zum Glück hatten mein Athletikcoach Rainer Sonnenburg und der Trainingswissenschaftler Norbert Sibum vom Olympiastützpunkt vom ersten Tag an keinen Zweifel daran – und sie ließen auch keinen zu –, dass ich bis zu den Olympischen Spielen in London wieder fit sein würde. Und deren Optimismus habe ich mir dann zu eigen gemacht. Rainer hat mich durch diese Zeit gepusht, mit ihm hatte ich fachlich wahrscheinlich den besten Mann an meiner Seite gehabt. Ich habe während der Reha kein einziges Mal daran gedacht, aufzugeben. Mir war immer klar: Wenn ich alles investiere, was möglich ist, dann packe ich es.
Tatsächlich habe ich vom 29. September an alles andere beiseitegeschoben und mich voll und ganz auf die Genesung konzentriert. Ich habe ein Urlaubssemester eingelegt, um jeden Tag meine zwei Trainingseinheiten durchziehen zu können, immer nach dem gleichen Muster: Morgens fuhr ich zum Olympiastützpunkt, hatte dort zwei Stunden Physiotherapie, Aquajogging, Lymphdrainage oder trainierte den Oberkörper, und nachmittags wiederholte sich das Ganze. Zwölf Einheiten pro Woche, 20 bis 25 Stunden Training, und das vier Monate lang, von Anfang Oktober bis Ende Januar. Nur am Wochenende gab es einen freien Tag.
Man mag sich vielleicht wundern, dass diese Eintönigkeit mich, der am Hockey vor allem das Spielen liebt, nicht mürbe gemacht hat. Aber zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit, über den Hockeykosmos-Tellerrand zu schauen. Am Olympiastützpunkt trainieren Schwimmer, Ruderer, Beachvolleyballer, und weil ich nach dem Vormittagstraining oft zum Mittagessen dort blieb, lernte ich in dieser Zeit viele andere Sportler besser kennen. Freundschaften wie die mit den Topschwimmern Steffen und Markus Deibler, Ruder-Olympiasieger Eric Johannesen oder Beachvolleyball-Ass Laura Ludwig sind damals entstanden. Das „Team Hamburg“ füllte sich für mich in der Reha-Phase, in dem alle Olympia-Kaderathleten der Stadt gefördert werden, mit Leben.
Und es gab noch einen angenehmen Nebenaspekt. In der Zeit zwischen Mittagessen und Nachmittagstraining war ich fast täglich auf dem Golfplatz im Golfclub Hamburg-Walddörfer, um allein ein paar Bälle zu schlagen. Manchmal nur auf der Driving Range, manchmal spielte ich aber auch neun Löcher. Hier fand ich die nötige Ruhe, um mich auf mich selbst zu konzentrieren – eine sehr wichtige Zeit, denn beim Hockey und in der Reha war ich immer von vielen Menschen umgeben. (Und ganz nebenbei lernte ich das Golfspielen, das heute zu meinen größten Hobbys zählt.)
Zum Hockey hielt ich in dieser Phase eher Abstand. Natürlich ging ich an den Wochenenden zu den UHC-Spielen, aber mich quälte es, nur zuschauen zu können. Ich teilte mir damals eine Wohnung am Turmweg mit Alessio Ress und Bene Sperling, die damals beim Club an der Alster, einem unserer größten Konkurrenten aus der Bundesliga, spielten. Aber statt mit ihnen darüber zu reden, verbrachte ich viele Stunden im Café „Swedish Cream“ an der Rothenbaumchaussee, wo ich meinen inneren Frieden zu finden hoffte.
Viele Athleten sagen, dass die Reha nach einer Verletzung nicht nur körperlich immens anstrengend ist, sondern auch mental. Jeden Tag muss man sich aufs Neue motivieren, Übungen zu machen, die keinen Spaß bringen. Zum Glück war es bei mir nicht so extrem. Immer mit meinem Ziel vor Augen, habe ich keine einzige Trainingseinheit versäumt. Aber abends zog ich nicht nur einmal um die Häuser – ich hatte ja keinen Wettkampf, keine Verantwortung für das Team –, um beim Vormittagstraining mit einer Alkoholfahne aufzutauchen.
Man sagt uns Hockeyspielern ja nicht zu Unrecht nach, dass wir im Feiern ganz vorn dabei sind, und ich werde an anderen Stellen in diesem Buch auch noch darauf eingehen. Fakt ist, und das habe ich in jener Zeit besonders gespürt, dass Teamsportler häufig eine bessere Mischung aus Anspannung und Entspannung finden, während Einzelsportler sich oft viel zu sehr unter Druck setzen und aus Angst, an körperlicher Leistungsfähigkeit einzubüßen, keine Ventile zulassen, um Druck abzubauen. Ich bin überzeugt, dass der positive Effekt, den es für den Kopf hat, wenn man mal über die Stränge schlägt, viel wichtiger ist als der negative Effekt für die körperliche Leistungsfähigkeit.
Wichtig ist, dass man danach die nötige Anspannung wieder aufbauen kann. Durch das Training in der Reha spürte ich, wie ich von Tag zu Tag fitter wurde. Daraus zog ich meine Motivation, sodass der Frust über die schwere Verletzung fast in Euphorie umschlug. Und als im Februar 2012 der Fitnesstest der Nationalmannschaft in Mannheim anstand, hatte ich nicht 25 Prozent mehr Haltekraft aufgebaut, sondern 40 Prozent.
Ich konnte unter Vollbelastung alle Übungen mitmachen. Bundestrainer Markus Weise hatte, zum ersten und auch einzigen Mal, für den Lehrgang ein Punktesystem eingeführt, mit dem er alle Bereiche, die getestet wurden, bewertete. Nachdem die Champions Trophy 2011 in Neuseeland nicht gut gelaufen war, wollte er sichergehen, dass sich niemand auf dem EM-Titel 2011 ausruhte. Ich hatte mit Abstand die besten Werte, und das passte zu meinem Selbstgefühl. Ich war nach den vier Monaten Rehatraining körperlich so gut drauf wie nie zuvor – und eigentlich auch nie wieder danach in meiner Karriere.
Ich erinnere mich, wie mich Stefan Kermas, der damalige Assistent Weises und heutige Bundestrainer, beiseite nahm und mir sagte, wie beeindruckend er meine Performance fand. Das hat mir noch mal mehr Kraft gegeben. Tatsächlich habe ich nur in einer einzigen Situation kurz an meine Verletzung gedacht, bei einer Sprintübung mit 180-Grad-Richtungswechsel in vollem Tempo. Da überlegte ich kurz, ob mein Knie halten würde, aber ich machte trotzdem mit, und alles ging gut.
Bereits ein halbes Jahr nach dem Kreuzbandriss flog ich also Anfang März 2012 mit dem Olympiakader zum Zentrallehrgang nach Südafrika. In Kapstadt konnte ich spielerisch und athletisch alle Anforderungen erfüllen – und fühlte mich wieder als vollwertiges Mitglied der Nationalmannschaft. Es war eine Mischung aus Stolz, Glück und Erleichterung, die sich in mir breitmachte. Ich hatte mir und allen anderen bewiesen, dass ich es ohne Operation nach London schaffen konnte.
Ausruhen konnte ich mich auf diesem Glücksgefühl keineswegs, denn der Weg nach Olympia führte über die Rückrunde in der Feldbundesligasaison. Als Krönung gewannen wir mit dem UHC zum dritten Mal die Euro Hockey League. Und mit dieser Euphorie ging es dann im August nach London. Meine drei Olympiateilnahmen sind selbstverständlich separate Kapitel wert. Aber das Gold in England muss hier Erwähnung finden, weil es in dem sportlichen und privaten Wellenbad, das die 15 Monate Wahnsinn darstellten, der sportliche Höhepunkt war. Ich persönlich habe dort gut gespielt, aber nicht überragend, die Leistung bei der EM 2011 erreichte ich nicht ganz.
Dafür funktionierte das Team umso besser, ich erinnere mich am liebsten an das Halbfinale gegen Weltmeister Australien, das wir mit 4:2 gewannen. Ich spielte mit Tobi Hauke, Christopher Wesley, Jan-Philipp Rabente und Oliver Korn im Mittelfeld, und wir verloren über die gesamte Spielzeit so gut wie keinen Ball. Das war eins der drei besten Länderspiele meiner Karriere, und es führte mir vor Augen, wie eng im Sport Erfolg und Enttäuschung beieinanderliegen: Eine verrückte Zeit der Extreme, und der Olympiasieg war auf der Verrücktheitsskala der höchste Ausschlag nach oben.
Das Sahnehäubchen auf meiner persönlichen Torte sollte allerdings im Dezember 2012 folgen. Ich war zur Saison 2012/13 gemeinsam mit meinen Nationalmannschaftskollegen Oskar Deecke und Oliver Korn zum Club de Campo nach Madrid gewechselt, weil ich gern ein Jahr im Ausland spielen wollte. Diese Entscheidung hatte ich in Kapstadt getroffen. Weil in Spanien die Feldsaison bis in den Dezember dauert, waren Oskar, Olli und ich die einzigen drei Olympiasieger von London, die Markus Weise in seinen Perspektivkader für die Champions Trophy in Melbourne berief. Wir steckten nicht in der Vorbereitung auf die Hallensaison, sondern waren noch voll mit Feldhockey beschäftigt.
Und so kam es, dass ich im fernen Australien nach einem Gruppenspiel gegen Neuseeland die höchste persönliche Auszeichnung erhielt, die es im Hockey gibt: die des Welthockeyspielers des Jahres. Seit ich 2007 zum ersten Mal für die Wahl zum Junioren-Welthockeyspieler nominiert worden war, träumte ich von diesem Titel. Als mir der damalige argentinische Weltverbandspräsident Leandro Negre die Medaille überreichte, war das die Krönung. Aber wie fühlt es sich an, als bester Hockeyspieler der Welt gekürt zu werden? Nun, um für so einen Titel nominiert zu werden, muss es ein Gesamtpaket geben: der EHL-Sieg mit dem UHC, der Olympiasieg mit Deutschland, dazu die Geschichte meines Comebacks – das alles hatte den Ausschlag dafür gegeben, diese Wahl gewinnen zu können. Aber der beste Einzelspieler war ich nicht. Ein Benny Wess beispielsweise hätte es mindestens genauso verdient gehabt – er war der beste Außenverteidiger der Welt. Sein Problem war, dass er „nur“ ein unheimlich guter Hockeyspieler war. Es ist ein bisschen wie im Fußball, wo auch keiner an Ronaldo und Messi vorbeikommt, obwohl das objektiv gesehen unfair ist. Aber es geht eben um das Gesamtpaket, und das passte bei mir einfach. (Wobei ich mich ausdrücklich nicht mit Ronaldo und Messi vergleichen möchte. Höchstens mit Andres Iniesta, aber dazu später mehr.)
Ich persönlich finde, dass ich es 2011 viel eher verdient gehabt hätte, denn bei der EM war ich so stark wie nie. Damals wurde jedoch der Australier Jamie Dwyer gewählt, obwohl er fast das ganze Jahr verletzt war und nur bei der Champions Trophy in Neuseeland glänzte, die ich mit meinem Kreuzbandriss verpasste. Aber Jamie hat mir danach eine sehr liebe Nachricht geschrieben, dass er mir den Titel gönne.
Und wie wird ein solcher Titel gefeiert? Eigentlich eher unspektakulär. Es gibt keine Gala in Zürich oder irgendeine große Zeremonie. Die Übergabe fand einfach so direkt nach einem Gruppenspiel der Champions Trophy statt. Ich war mit meinem UHC-Teamkollegen Tom Mieling auf einem Zimmer, wir haben ein Foto von uns mit der Auszeichnung gepostet. Ein Preisgeld gibt es natürlich auch nicht, man erhält eine Medaille, die schon am ersten Abend kaputt gegangen ist. Heute weiß ich leider gar nicht mehr, wo sie ist. Ich bin ein sehr schlechter Sammler von Erinnerungsstücken. Außer meinen drei Olympiamedaillen habe ich nichts aufbewahrt, was mich an die Stationen meiner Karriere erinnert.
Der Bundestrainer hielt eine sehr nette und bewegende Ansprache, in der er daran erinnerte, dass er mir 2010 gesagt hatte, ich hätte das Potenzial zum Welthockeyspieler, müsse dafür aber noch einiges an Leistung drauflegen. Und dass er stolz sei, dass ich das habe umsetzen können. Und das war es auch schon. Das Turnier ging weiter, und als neuer Welthockeyspieler war es umso schwieriger, dem Erwartungsdruck standzuhalten, da jetzt alle noch genauer auf mich schauten.
Der Abend hielt für mich aber noch einen weiteren und viel bedeutenderen Erfolg bereit, denn erstmals seit unserer Trennung im Juni 2011 erhielt ich eine persönliche Nachricht von Steph, um die ich in den Monaten zuvor gekämpft hatte. Bis dahin hatte sie jeden Kontakt gemieden. Das war der Beginn der Annäherung, die uns im Sommer 2013 wieder zusammenführte.
Waren die 15 Monate Wahnsinn von September 2011 bis Dezember 2012 die wichtigste Phase in meiner persönlichen Entwicklung? Auch wenn drei sportliche Highlights innerhalb dieser Zeit dafür sprechen, waren viele Wochen auch gar nicht schön, es war viel Kampf und Krampf, Schweiß und Quälerei notwendig. Dennoch glaube ich, dass ich damals erkannt habe, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe gespürt, was mir mein Sport bedeutet, aber auch, wie wichtig mir Familie und Freunde sind. Ich hatte sehr viel Zuspruch, allen voran von meinem engsten Vertrauten Mo Falcke, mit dem ich über alles reden konnte.
Aber vor allem habe ich gelernt, mich selbst kritisch zu sehen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einmal im Leben den Punkt zu erreichen, an dem man sich und sein bisheriges Tun hinterfragt und etwas verändert. Es war mir eben nicht egal, was andere von mir halten, ich war nicht so sehr mit mir im Reinen. Die Egal-Haltung war eine ziemlich narzisstische Attitüde. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, brauchte es sehr viel Selbsterkenntnis. Für mich war es in der Phase interessant zu sehen, wie Veränderungen, die ich bewusst vornehmen wollte, auch von meinem Umfeld wahrgenommen wurden. Deshalb kann ich sagen, dass die 15 Monate Wahnsinn viel zu dem beigetragen haben, der ich heute bin. Was auf dem Weg dorthin passierte und wie all das meinen Blick auf den Sport und die Gesellschaft geprägt hat – davon möchte ich euch in diesem Buch berichten.