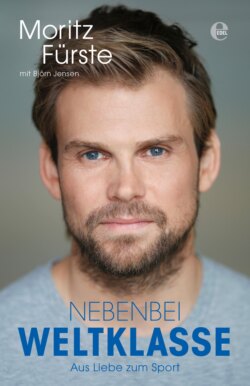Читать книгу Nebenbei Weltklasse - Björn Jensen - Страница 7
K A P I T E L 2 WARUM HOCKEY? MEINE ANFÄNGE IM SPORT
ОглавлениеIn Deutschland, sagt man, spielt jeder Junge irgendwann in seinem Leben einmal Fußball im Verein. Nun, dann bin ich wohl eine dieser Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ich mag Fußball sehr, und ich habe wirklich unendlich viele Stunden mit Kicken verbracht. Aber eben immer nur zum Spaß, denn im Verein gab es für mich nur zwei Sportarten: Hockey und Tennis. Das mag niemanden verwundern, der weiß, dass mein Heimatverein Uhlenhorster HC nur diese beiden Sportarten anbietet. Trotzdem hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, in einer Millionenstadt wie Hamburg in einem Klub in meiner Nähe Fußball zu spielen. Für mich stellte sich diese Frage nie.
Hockey, das war der Sport, den mein Vater Peter liebte, deshalb war mein Weg wohl vorherbestimmt. Er hatte es selbst zwar nicht in die Bundesliga geschafft, aber für den Klipper THC, einen der Traditionsklubs im Hamburger Nordosten, und für unseren UHC in der Zweiten Hockey-Bundesliga gespielt. Deshalb war es für mich von Anfang an selbstverständlich, mit auf den Platz zu gehen. Natürlich habe ich daran keine aktiven Erinnerungen mehr, aber wie solche frühkindlichen Erfahrungen unterbewusst prägen, sehe ich heute selbst an meiner Tochter Emma, die mit ihren drei Jahren in den Spielpausen auch schon über den Kunstrasen flitzt und erste Schlagversuche macht. So war das bei mir auch.
Meine ersten Trainingseinheiten im UHC-Kindergarten hatte ich als Sechsjähriger. Früher ging es nicht, da wir zweieinhalb Jahre in Hirscheid, einer Kleinstadt nahe Bamberg, gelebt hatten. Dort war Hockey kein Thema, aber als wir 1989 nach Hamburg zurückkehrten, konnte ich endlich mit dem Hockey anfangen. Wir wohnten damals in Wellingsbüttel, nur durch einen Gartenzaun von der Anlage des noblen Clubs an der Alster getrennt. Ich hätte also genauso gut dort landen können. Aber mein Vater war halt UHC-ler, und so hatten wir – mein Bruder Jonas ist zwei Jahre jünger als ich – zwar zehn Minuten Fahrtweg zum Training mehr, spielten dafür aber im Herzensverein unseres Vaters. Und das sollte einige Jahre lang so bleiben.
Ich erinnere nicht viel aus der ganz frühen Zeit, Hockey stand da sowieso noch nicht im Fokus. Aktiv setzen meine Erinnerungen erst im C-Knaben-Bereich ein. Da war ich sieben Jahre alt und hatte einen Trainer, der mich nachhaltig geprägt hat. Siegfried „Siggi“ Lück ist der Vater unseres heutigen Klubwirts Steffen Lück. Mittlerweile ist er über 80, kommt aber immer noch zu den Heimspielen der UHC-Herren und sagt mir nach dem Spiel, was falsch gelaufen ist. Siggi hat eine echte Berliner Schnauze, und seine Sprüche haben sich tief in mein Bewusstsein eingebrannt. „Da sind ja meine Rennschnecken schneller“, rief er immer, wenn wir im Training zu langsam liefen. Und er liebte es, uns den „Bauerntrick“ beizubringen: Mit Tempo auf den Gegner zulaufen, den Ball auf der einen Seite an ihm vorbeilegen und auf der anderen Seite vorbeilaufen. Den haben wir wirklich in jedem Training geübt.
Lücki war ein Trainer der alten Schule, eine Respektsperson – und zugleich ein Vertrauter wie ein Großvater. Er versuchte immer, uns zu pushen und das Beste aus uns herauszuholen, aber dabei den Spaß nicht zu vergessen. Immer gut gelaunt konnte man ihm wirklich nie böse sein. Was ich von einigen anderen meiner Trainer nicht sagen kann, aber dazu später mehr. Rückblickend behaupte ich, dass er ein wichtiger Faktor dafür war, dass ich so lange beim Hockey geblieben bin, denn er vermittelte mir, dass Sport in erster Linie mit Spaß zu tun haben sollte.
Einmal hat er uns für den zweitrangigen Pokalwettbewerb angemeldet anstatt für die Meisterschaftsrunde. Heute würden 20 Eltern versuchen, den Trainer dafür zu feuern, dass er die Mannschaft freiwillig für den schwächeren Wettbewerb meldet. Aber für uns war das eine tolle Erfahrung, weil wir mehr Spiele und am Ende sogar den Pokal gewannen. Lücki hatte uns damit gezeigt, dass Erfolg in der Jugend zwar wichtig, aber nicht alles ist. Natürlich wollten wir erfolgreich sein und unsere Spiele gewinnen. Aber vorrangig ging es darum, in einer Gemeinschaft etwas zu erleben. Und das war für mich der Reiz am Hockey im Verein.
Im Hockey hatte ich meinen Freundeskreis. Viele meiner Kumpels aus der Schule waren auch beim UHC. Mein bester Freund, Alex Plum, der in unserer Straße wohnte, spielte auch in meinem Team, wir fuhren gemeinsam mit dem Rad zum Training. Jedes Jahr hatten wir ein Pfingstturnier in Berlin, an dem rund 100 Mannschaften aller Altersklassen teilnahmen. Für mich war das immer der Höhepunkt des Jahres. Mit mehreren UHC-Teams ging es in einem Reisebus nach Berlin, und als einer der Kleinen durfte ich für die älteren Jahrgänge, die im Bus hinten saßen, kleine Liebesbriefe zu den Mädchenteams nach vorn tragen. Mann, was war ich stolz!
An diese Zeit erinnere ich mich sehr gern zurück, weil es einfach darum ging, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und nebenbei auch noch Hockey zu spielen. Im B-Knaben-Bereich hatten wir mal ein Endrundenspiel der Hamburger Meisterschaft auf Naturrasen gegen Großflottbek, den Erzrivalen aus dem Hamburger Westen. Dort spielte Philip Witte, mit dem ich 2008 in Peking Olympiasieger werden sollte. Vor dem Spiel waren wir zusammen in ein an den Platz angrenzendes Maisfeld gestürmt und hatten dort mit unseren Hockeyschlägern Maiskolben heruntergeschlagen. Erst als unsere Trainer laut nach uns riefen, merkten wir, dass wir auf den Platz mussten. Die Prioritäten waren also klar gesetzt, und diese Unbeschwertheit habe ich sehr genossen.
Im Alter zwischen sieben und 16 hatte ich keinerlei Vision davon, was ich im Hockey mal erreichen wollte. Abseits meiner eigenen Spiele war dieser Sport Nebensache. An die Olympischen Spiele 1992, 1996 und 2000 habe ich viele Erinnerungen, weil ich sie im Fernsehen verfolgt habe, aber Hockey habe ich gar nicht geschaut. Ich kannte auch keinen der Bundesliga- oder Nationalspieler. Mein Sportheld war Boris Becker, was sicherlich auch daran lag, dass ich besser Tennis als Hockey spielte.
Ich hatte mit sieben Jahren angefangen, das Racket zu schwingen. Einer meiner Teamkameraden war Mischa Zverev, der heute erfolgreicher Profi ist und dessen Vater Alexander uns trainierte. Für den UHC nahm ich an Mannschaftswettkämpfen und an Hamburger Meisterschaften teil. Tennis war mir so wichtig, dass ich vor Medenspielen, die unter der Woche stattfanden, in der Schule kaum stillsitzen konnte, weil ich so aufgeregt war. Einmal konnte mich meine Mutter nicht zur vereinbarten Zeit aus der Schule abholen und zum Tennis fahren, weil sie einen schweren Hörsturz erlitten hatte. Ich war verzweifelt und lief, in Tränen aufgelöst, siebeneinhalb Kilometer zu Fuß nach Hause, um von dort mit dem Rad in den Klub zu rasen. Immerhin kam ich noch rechtzeitig, um Doppel spielen zu können.
Mit 15, als die Schulzeit auf dem Gymnasium langsam in die entscheidende Phase ging, stellte meine Mutter mich vor die Wahl: Hockey oder Tennis? Beides war zeitlich einfach nicht mehr miteinander vereinbar, und auch wenn ich Tennis liebte und ich darin wahrscheinlich mehr Talent hatte, fiel mir die Entscheidung für Hockey leicht. Beim Tennis hatte ich nicht viele Freunde. Mit Mischa verstand ich mich gut – ich verfolge seine Karriere und die seines zehn Jahre jüngeren und inzwischen noch erfolgreicheren Bruders Sascha mit großem Respekt. Aber Hockey war meine Welt: Da waren die Jungs, mit denen ich abhängen wollte. Dieses Miteinander war und ist mir enorm wichtig, ich wollte immer lieber mit meinen Freunden spielen als gegen sie.
Nie habe ich ein Training versäumt. Hockey, das ist für mich gleichzeitig Ort des mentalen Abschaltens wie auch des körperlichen Auspowerns, und dieses Zusammenspiel ist für mich unglaublich entspannend. Deshalb habe ich auch schon zwei Tage nach dem Tod meines Vaters, auf den ich im nächsten Kapitel näher eingehen werde, den Hockeyschläger wieder in die Hand genommen; und am Tag, als mein Schwiegervater starb, ein Hallenbundesligaspiel gegen Braunschweig bestritten. Gerade in solchen Phasen ist Hockey für mich immer ein Ventil gewesen, das Geschehene zu verarbeiten. Und gleichzeitig auch das perfekte Zeichen, dass das Leben weiter geht, den Blick immer nach vorn gerichtet. Die Entscheidung für den Hockeysport habe ich kein einziges Mal bereut, obwohl ich manchmal schon gern wissen würde, wie weit ich es im Tennis hätte bringen können.
Bisweilen sinniere ich darüber – allein oder im Gespräch mit anderen Sportlern –, ob die Entscheidung zwischen Einzel- und Mannschaftssport eine Charakterfrage ist. Mit dem Golfprofi Martin Kaymer hatte ich eine sehr interessante Diskussion. Als ich ihn fragte, ob er sich bei Olympia neben dem Einzelwettkampf nicht auch einen Teamwettbewerb wünschen würde, um die Chance auf eine weitere Medaille zu haben, antwortete er, dass das der Horror für ihn wäre: die Vorstellung, dass ein Anderer mit einem schlechten Tag seine eigene Leistung kaputtmachen könnte. Darüber hatte ich bis dahin nie nachgedacht. Im Teamsport nimmt man in Kauf, dass Fehler, die jedem passieren können, dazugehören und man sie entweder gemeinsam ausbügelt oder verarbeitet.
Ein Einzelsportler denkt anders, und deshalb bin ich mir auch sicher, dass ich im Tennis nie so weit gekommen wäre wie im Hockey. Mir täte es nicht gut, mich zu viel mit mir selbst zu beschäftigen. Vor allem aber brauche ich die Gemeinschaft, um mich überhaupt zum Training zu motivieren, wenigstens dann, wenn Schläger und Ball nicht berührt werden, sondern Kondition oder Kraft gebolzt werden müssen. Wenn ich diese vielen hundert Einheiten, die ich in meiner Laufbahn absolviert habe, nur für mich hätte machen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich maximal zehn Prozent hinter mich gebracht. Zu wissen, dass die anderen Jungs auch da sind, und dass sie erwarten können, dass ich mich für sie quäle, hat mich immer wieder den inneren Schweinehund überwinden lassen.
Wenn Ball und Schläger im Spiel waren, dann war sowieso alles gut. Den Impuls, den Hockeyschläger an den Nagel zu hängen, habe ich tatsächlich nicht ein einziges Mal gehabt. Nur einmal war ich kurz davor. Mit 16 Jahren als B-Jugend-Spieler fühlte ich mich von meinem damaligen Trainer Frank Hänel so ungerecht behandelt, dass ich das erste und einzige Mal in meinem Leben meine Mutter bat, ein Gespräch mit einem meiner Coaches zu führen. Das tat sie auch, kam aber mit der Antwort zurück, dass ich mich entspannen könne. „Der Trainer sagt, so lange er dich anschreit, könntest du sicher sein, dass er dich gut findet. Erst wenn er dich links liegen lässt, musst du dir Sorgen machen.“ Das reichte mir als Antwort, damit kam ich klar.
Ansonsten gab es keine Sinnkrisen in meiner Jugend, was wohl auch daran lag, dass ich ein untypischer Teenager war. Angesichts des Rufs als Partytier, den wir Hockeyspieler irgendwie alle haben, mag das vielleicht sonderbar klingen, aber ich war nie der große Rebell, sondern eigentlich ziemlich brav. Bei einem Schulausflug in der sechsten Klasse sind wir mal vor der Scientology-Kirche in der Hamburger Innenstadt hängen geblieben. Keiner wusste, was das war, und irgendwann kam ein Scientologe raus und fragte, ob wir nicht mal reinkommen wollten. Alle sind mitgegangen, nur ich nicht. Warum, weiß ich nicht, es fühlte sich einfach falsch an, dort hineinzugehen. Ich rief stattdessen von einer Telefonzelle aus meine Mutter an, damit sie mich abholte. Sie war stolz, dass ich nicht mitgegangen war. Und ich war stolz, weil Mama stolz war. Natürlich hatte ich auch meinen eigenen Kopf und habe Mist gebaut. Einmal habe ich mit einem Kumpel Mercedessterne von parkenden Autos abgebrochen und sie in der Schule verteilt. Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich dachte ich, das wäre cool. Ebenso wie an dem Tag, als wir ein Klassenzimmer mit Deospray einnebelten und ein Lehrer mit Hausstauballergie deshalb einen schweren Asthmaanfall bekam. Aber grundsätzlich war ich relativ angepasst. Als Jugendlicher blieb ich nie länger weg, als ich durfte, hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben. Ich konnte auf Schulpartys gehen und trotzdem am nächsten Tag auf dem Hockeyplatz gut spielen. Verzicht kannte ich nicht, mir hat es immer Spaß gemacht, auch weil ich meinen Freundeskreis ja im Sport hatte und wir uns gegenseitig bestärkten. Die Hockeywelt war mein zweites Zuhause und das Verständnis, was man gegenseitig füreinander aufbrachte, machte meinen Freundeskreis aus..
Jeder Sportart haften Klischees an, und über Hockey sagt man, es sei ein elitärer Sport für Leute, die ihre Poloshirts mit hochgestelltem Kragen tragen. Hab ich zwar wirklich selten getan, aber es gab früher einige Jungs, die sogar Haarspray benutzten, damit der Stehkragen selbst im Bett noch aufrecht stand. Sicherlich ist es auch nicht wegzudiskutieren, dass Hockeyspieler mehrheitlich aus einem sozial starken Umfeld kommen. Die finanziellen Hürden durch die nicht unerheblichen Jahresbeiträge in den Vereinen sind hoch, keine Frage. Aber ob man deswegen von Ausgrenzung sprechen muss?
Mit der Frage, wann ich gemerkt habe, dass ich es im Hockey in die Weltklasse schaffen könnte, werde ich häufiger konfrontiert. Die Antwort darauf ist: eigentlich erst, als ich kurz davor war, den Schritt zu machen. In meiner Kindheit und Jugend stand tatsächlich, wie eingangs beschrieben, der Spaß im Vordergrund. Die Tatsache, dass ich in keiner Jugend-Nationalmannschaft gespielt habe, unterstreicht das. Ich stand mit dem UHC auch niemals in einer Endrunde um die deutsche Meisterschaft.
Einmal, im A-Knaben-Alter, waren wir ganz kurz davor, es in der Halle zu packen. Im Spiel um Platz drei bei der nordostdeutschen Meisterschaft hätten wir gegen Rissen gewinnen müssen. Wir führten 4:0, und ein Rissener Spieler hatte, was in dieser Altersklasse höchst selten war, eine Rote Karte gesehen, weil er unseren Torhüter Maxi Paulus mit einem Roundhouse-Kick gegen den Brustpanzer umgetreten hatte. Wir spielten also in Überzahl, schafften es aber trotzdem noch, das Spiel 4:5 zu verlieren – irgendwie sinnbildlich für meine damalige Mannschaft. Wir waren zwar nicht schlecht, aber unsere Priorität war die Hamburger Meisterschaft. Alles, was darüber hinausging, konnten wir uns nicht vorstellen.
So war der Hamburger Hallenmeistertitel mit den B-Knaben lange der einzige Titel, den wir gewinnen konnten – bis wir es in unserem letzten Jahr im A-Jugend-Bereich noch einmal schafften: 2001, als wir in der Halle des Clubs an der Alster im Finale gegen den Großflottbeker THGC spielten, die damals klarer Favorit waren, weil sie den Eckenspezialisten John Patrick Appelt in ihren Reihen hatten. Bei uns stand mit Dirk Feldmann ein Feldspieler im Tor, weil unser Keeper Maxi Paulus, der heute in den USA ein Imperium von mehr als 40 Hotels leitet, zum Studieren ins Ausland gegangen war. Dirk hielt beim Stand von 5:4 für uns eine Schlussecke sensationell, sodass wir die große Überraschung schafften. Das war mein größter Erfolg im Jugendbereich!
Was mich betraf, so zählte ich in meiner Mannschaft zwar sicherlich zu den besten Spielern und war letztlich der Einzige, der es später in den Bundesligakader schaffte. Aber in Hamburg gehörte ich nicht zu den absoluten Topspielern. Körperlich eher schlaksig und schmächtig spielte ich keine feste Position; wie fast jeder Junge liebte ich es, Tore zu schießen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Den Job als Innenverteidiger kann ich nur annehmen, weil ich die Strafecken und Siebenmeter schießen darf und so immer wieder auch Tore erzielen kann.
Auf der Mittelfeldposition spielte ich mich eigentlich erst nach dem Wechsel zu den Herren fest. Es machte mir schon immer Spaß, das Spiel zu gestalten und aus dem offensiven Mittelfeld heraus torgefährlich zu agieren. Dass man auf der Position an fast allen Spielsituationen beteiligt war, gefiel mir. Ein Defensivmonster war ich nie, mir lag das kreative Element mehr am Herzen; wohl auch, weil meine Stärke darin liegt, eine gute Spielübersicht zu haben, ein gutes Auge für Passwege und -lücken, die andere oft nicht sehen. Außerdem bin ich schwer vom Ball zu trennen, weil ich das Tempo gut verschleppen und meinen Körper gut zwischen Ball und Gegner stellen kann.
All diese Fähigkeiten haben sich tatsächlich erst im Erwachsenenbereich entwickelt. Mein Durchbruch kam meiner Wahrnehmung nach, als ich als 17-Jähriger mein erstes Bundesligaspiel bestreiten durfte. Eigentlich war ich mit der A-Jugend unterwegs zum Zeltturnier in Mönchengladbach, als am Samstagabend der Herren-Cheftrainer Frank Hänel, der mich in der Jugend so getriezt hatte, bei unserem Coach anrief und mich für den darauffolgenden Tag zum Spiel gegen Neuss anforderte.
Also stieg ich in den Zug und reiste zurück nach Hamburg. Mein Bruder hatte mir, das erinnere ich noch genau, als Motivation einen Klebestreifen an die Küchenwand geklebt, auf dem stand: „UHC – Neuss 1:0, Torschütze M. Fürste“. So kam es dann zwar nicht, wir siegten 2:1, aber ich spielte kaum und schoss auch kein Tor. Dennoch: Der Anfang war gemacht, und das war der Moment, in dem ich spürte, dass ich mehr erreichen wollte. Zur Saison 2002/03 gehörte ich fest zum Bundesligakader und habe im ersten Saisonspiel beim 3:3 bei Rot-Weiß Köln mein erstes Tor geschossen.
Und genau so hat sich meine Karriere über die Jahre gestaltet: Immer dann, wenn der nächste Schritt möglich war, konnte ich auch die nötige Leistung abrufen, weil ich ein realistisches Ziel vor Augen hatte. Ich gehörte im Sport nie zu denjenigen, die an das große Ganze gedacht haben. Mir hat es geholfen, dass es erst sehr spät um Leistung ging. Ich habe in meiner Zeit im Herrenbereich Spieler erlebt, die in der Jugend neun deutsche Endspiele in Serie gespielt hatten, bevor sie in den Herrenbereich wechselten. Wie willst du denen dann erklären, dass es das Größte ist, mit den Herren ein Finale zu spielen?
Für mich war es das aber. Als ich Bundesligaspieler war, träumte ich keineswegs vom Nationalkader. Der war für mich genauso weit weg wie die Fußballnationalmannschaft. Der Fokus lag darauf, ein guter Bundesligaspieler zu werden und irgendwann ein Endspiel mitmachen zu dürfen. So bin ich Schritt für Schritt weitergekommen und alles hat seinen Lauf genommen.
Bevor ich davon aber ausführlicher berichte, muss ich noch erklären, warum sich dieses Buch in 21 Kapitel gliedert. Die 21 ist meine Rückennummer, seit ich sieben Jahre alt bin. Damals wurden im Training die Trikots verteilt. Natürlich wollte ich eine der coolen einstelligen Nummern ergattern, aber mein Vater hatte sich verspätet, und ich kam erst an, als alle anderen schon gewählt hatten. Ich war völlig fertig und heulte. Mein Vater aber schaffte es, mir die 21 schmackhaft zu machen, indem er mir erklärte, dass beim HSV, seinem und unserem Lieblingsverein, ein Mittelfeldspieler namens Harald Spörl diese Rückennummer trüge und es doch wohl das Tollste der Welt wäre, wenn ich auch diese Nummer hätte. Fand ich dann auch toll, obwohl mir Harald Spörl nie besonders aufgefallen war. So ging ich freudestrahlend zum Trainer und wünschte mir die 21.
Seitdem habe ich im UHC diese Rückennummer gebucht. In der Nationalmannschaft musste ich dagegen bis 2012 warten, um sie zu bekommen. 2006, vor der Heim-WM in Mönchengladbach, weigerte sich der damals vierte Torwart, mein heutiger guter Freund Max Weinhold, sie herauszugeben, obwohl er nicht mal im Kader stand! Und weil er danach „leider“ so gut wurde, dass er es bis zum Stammtorwart brachte und uns zwei Goldmedaillen bescherte, musste ich bis zu seinem Karriereende warten. Bis dahin trug ich für Deutschland die Neun, die im UHC mein Bruder Jonas hatte. Ein guter Ersatz!
Im Ernst: Ich bin nicht abergläubisch, habe auch im UHC schon mal mit anderen Rückennummern gespielt, wenn ich mal wieder so schusselig war und mein Trikot vergessen hatte. Aber ich verbinde schon viele Emotionen mit dieser Zahl. Wer meine Freunde fragt, was sie mit der 21 verbinden, werden sie meinen Namen nennen. Vor zehn Jahren habe ich mir die zwei Ziffern auf den linken Oberarm tätowieren lassen, trage sie so immer bei mir. Wenn ich hin und wieder einen Casinobesuch starte, setze ich immer einen Chip auf die 21. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ein anderer mit „meiner“ Zahl gewinnen würde.
Und letztlich erinnert mich die 21 natürlich auch an meinen Vater, den ich so früh verloren habe. An den Menschen, der meinen Weg in den Sport geebnet und der mir all das mitgegeben hat, wovon ich auf den kommenden Seiten mehr erzählen möchte.