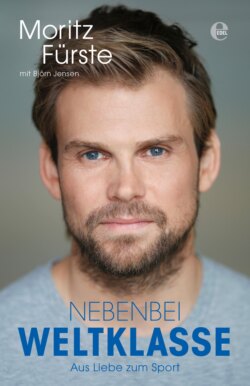Читать книгу Nebenbei Weltklasse - Björn Jensen - Страница 9
K A P I T E L 4 MEIN UHC
ОглавлениеDas Paradies stellen viele Menschen sich vor wie einen endlosen Sandstrand mit Palmen und kristallklarem Wasser. Finde ich zwar auch schön, aber mein Paradies, das war viele Jahre lang die Anlage meines Heimatvereins Uhlenhorster HC. Ich weiß natürlich, dass wohl fast jeder Hockeyklub in Deutschland seine eigene Anlage als die schönste bezeichnet. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir am Wesselblek im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel ein wirklich überragend schönes Gelände haben.
Als ich 1990 von meinen Eltern, die beide Mitglieder waren – mein Vater spielte Hockey, meine Mutter Tennis –, im UHC angemeldet wurde, sah die Anlage gar nicht so viel anders aus als heute. Der hintere Platz, der heute auch Kunstrasenbelag hat, war noch Naturrasen. Aber die große Tennis- und Hockeyhalle war schon da, der große Kunstrasenplatz auch. Am coolsten fanden wir als Kinder aber die vielen alten Bäume auf dem Gelände. Und weil es nur zwei Eingänge zur Anlage gibt und der Rest rundherum eingezäunt ist, durften wir als Kinder immer völlig unbeobachtet herumtoben. Einzige Regel: Die beiden Eingangstore durften nicht passiert werden. Ansonsten konnten wir tun, was wir wollten, und das haben wir absolut ausgekostet.
In meiner Jugend verbrachte ich bestimmt an vier Wochentagen meine Freizeit im Klub, die Punktspiele im Tennis und Hockey an den Wochenenden nicht mitgerechnet. Da mein Bruder Jonas zwei Jahre jünger ist und deshalb zu anderen Zeiten Training hatte, wurde ich einfach mit in den Klub genommen, weil meine Mutter natürlich nicht dauernd hin- und herfahren wollte. Wenn Joni trainierte, habe ich mit Freunden Fußball gespielt, und andersherum ging das genauso. Entsprechend viel Zeit haben wir beim UHC verbracht, und natürlich entsteht so über die Jahre eine enorme Bindung an den Verein. Wir waren, später auch bedingt durch den Tod unseres Vaters, bekannt wie bunte Hunde, jeder hat sich um uns gekümmert und uns das Aufwachsen ein Stück weit zu erleichtern versucht.
Von den Jungs, mit denen ich gemeinsam mit dem Hockey angefangen habe, haben es nur Paddy Breitenstein und Moritz Falcke auch in die Bundesliga geschafft. Nicht zu vergessen Josip Somin, aber der musste dafür leider zum Harvestehuder THC wechseln, was für ihn und den HTHC gut war, für uns aber umso trauriger. Ich erinnere mich sehr gern an meine erste UHC-Clique, zu der auch Jungs wie Benny Plass, Matze Fahrenholtz oder Johannes Müller-Wieland gehörten.
Im Herrenbereich waren es anfangs Jungs wie Philip Sunkel, Bene Köpp und Jörg Schonhardt, die den Ton angaben. Dazu kam irgendwann Eike Duckwitz, ein ganz krasser Typ. Wenn jemand das komplette Gegenteil von mir ist, dann Eike. Er war einer, der spielerisch zunächst nicht weiter auffiel, und der dennoch einen Mörderjob in der Defensive machte. (Das bezieht sich ausschließlich aufs Spielerische und nicht auf den Menschen!) Ein Highlight war 2005 der Zugang von Carlos Nevado. Carlos, der von Frankfurt 1880 kam, war der erste Nationalspieler, den der UHC von außerhalb holen konnte. Später folgten dann mit Olli Korn, Philip Witte und Jan-Philipp Rabente weitere menschliche sowie sportliche Granaten, die den Verein prägten bzw. noch prägen.
Zu allen habe ich heute noch Kontakt, auch wenn Rabbi – Jan-Philipp Rabente – der Einzige ist, mit dem ich noch zusammenspiele. Mo Falcke ist sogar mein Trauzeuge. Und genau das ist es, was ich am Mannschaftssport so liebe: Dass es egal ist, wenn man sich mal Monate oder sogar Jahre nicht sieht, weil die alte Vertrautheit, die man über 25 Jahre aufgebaut hat, sofort wieder zurück ist, wenn man sich trifft. Das fällt mir besonders auf, wenn ich Linus Butt oder Oskar Deecke treffe, die in Krefeld spielen, und die ich trotz der räumlichen Entfernung zu meinen besten Freunden zähle.
In unserem Sport sprechen wir ja gern von der Hockeyfamilie. Vielleicht wird der Begriff manchmal etwas überstrapaziert, und ich weiß, dass Außenstehende über das „Hockeygeklüngel“ bisweilen genervt die Nase rümpfen. Aber wenn es wirklich wichtig ist, kann man immer wieder spüren, dass da viel Wahres dran ist. Ein Beispiel: Als wir im Sommer 2017 im Internet einen Aufruf starteten, um für unseren schottischen Mitspieler Michael Bremner eine Wohnung zu finden, was in Hamburg ungefähr so einfach ist wie die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, hatten wir nach 24 Stunden ein Apartment zum halben Preis.
Und, noch beeindruckender: Als im Herbst 2017 ein Stammzellenspender für die an Leukämie erkrankte Großflottbeker Torhüterin Silja Paul gesucht wurde, hat es innerhalb weniger Wochen in ganz Deutschland Typisierungsaktionen vieler Hockeyspieler/-innen gegeben. Selbst in Mannheim, wo wir an einem Wochenende spielten, gab es diesbezüglich überall Hinweise und Aktionen. Und der Facebook-Post, den ich zu dem Thema geteilt habe, war der erfolgreichste, den ich je gemacht habe. Damit wurden fast 300.000 Menschen erreicht. In solchen Momenten bin ich sehr glücklich, zur Hockeyfamilie zu gehören.
Die DNA des UHC ist die Bodenständigkeit seiner Mitglieder und der Fokus auf die Jugendarbeit. Wir verstehen uns zu 100 Prozent als Familienklub, und auch wenn in den Leistungsmannschaften natürlich versucht wird, in der Spitze Gas zu geben, ist die Maxime, immer wieder Nachwuchs aus der eigenen Jugend an die Bundesliga heranzuführen. Wenn wir einen deutschen Spieler oder eine deutsche Spielerin von auswärts holen, dann muss er/sie internationale Klasse besitzen. Wenn wir jemanden aus dem Ausland holen, muss es ein Nationalspieler sein. Das ist unser Anspruch. Alles andere decken wir aus Eigenmitteln ab, da der UHC ohne große externe finanzielle Hilfe auskommen muss. Klar gibt es Unterstützung durch Sponsoren, das meiste Geld aber fließt immer noch aus Gönnertaschen in die Kassen. Damit basteln wir uns einen Etat, der allerdings mit dem der finanzstarken Klubs wie Rot-Weiß Köln, Mannheimer HC oder auch Club an der Alster nicht mithalten kann. Deshalb argumentieren wir vor allem mit Aspekten wie Zusammenhalt und Klubleben, wenn wir neue Mitglieder für uns begeistern wollen.
Es wäre allerdings eine furchtbare Missachtung ihrer Arbeit, wenn ich nicht die Menschen nennen würde, die alles dafür geben, den UHC auch finanziell angemessen auszustatten. Alles beginnt mit dem „Club der 50“, das ist ein Zusammenschluss von Sponsoren, der vor mehr als 20 Jahren von Tommy Thomsen gegründet wurde. Tommy hat das Modelabel Venice aufgebaut, und mit dem „Club der 50“ sammelt er zweckbezogen Sponsorengeld für die Belange der Ersten Hockeyherren des UHC ein. Wenn wir über Neuzugänge reden, sitzt er noch immer mit am Tisch, obwohl er aus dem hockeyfachlichen Bereich schon viele Jahre raus ist.
Die zweite Generation der Unterstützer wird angeführt von Andy Kutter, dessen Sohn Chrischi mittlerweile auch im Bundesligakader steht. Ohne Andy wäre in den vergangenen zehn Jahren vieles nicht möglich gewesen, weil er wirklich unglaubliche Anstrengungen unternimmt, um uns zu unterstützen. Andy ist nicht nur Förderer, sondern auch einfach ein guter Freund. Und seine „Hamburg-Präsentkörbe“, die er an potenzielle Partner oder Neuzugänge verschickt, um ihnen den UHC schmackhaft zu machen, sind legendär!
Nicht wegzudenken sind auch Christian Kopplow („Stulle“) und Christoph Kreusler („Kreusi“), die sich aufgrund ihrer Expertise in juristischen Dingen und Immobiliengeschäften um Rechtsberatung oder Wohnungssuche für Mitglieder kümmern. Alle drei waren früher schon gute Freunde meines Vaters, was ein Zusammensein umso angenehmer macht. Oder Ilja Steiner und Hartmut Carl, in dessen Firma mein Bruder Jonas seit einigen Jahren arbeitet: Menschen, die ebenfalls alles geben, um unsere Spieler mit Jobangeboten oder ähnlichem Support zu unterstützen. Dazu kommen unsere langjährigen Teammanager. Am Anfang meiner Karriere war das vor allem Tom Plum, Vater meines besten Jugendfreundes Alex, und später jahrelang Thomas Friedemeyer. Thosi ist mein Onkel und war lange Zeit ein riesiger Mehrwert für unser Team. Und das sind Menschen, die sich ausschließlich um die Bundesliga-Hockeyherren kümmern. Im Gesamtverein gibt es noch viel mehr positiv Verrückte.
Peter Müller ist so einer, der mit seinen 80 plus x Jahren – sein genaues Alter verrät er nicht – noch immer fast jedes Heimspiel besucht. Peter hat viele Jahre das Viernationenturnier „Hamburg Masters“, das 2017 leider wohl zum letzten Mal bei uns am Wesselblek ausgetragen wurde, organisiert und sich auch um eine ganze Reihe infrastruktureller Projekte gekümmert. Oder Ingrid Perdoni, die zu dem Kreis derer gehört, die 2008 die „Blaue Wand“ initiiert haben.
Das ist die Gruppe der Unterstützer, die uns im Europapokal ins Ausland begleitet oder zu Endrunden um die deutschen Meisterschaften. Das Beispiel hat Schule gemacht: Heute haben viele Vereine irgendwelche bunten Wände oder Wellen. Und Ingrid kennt die Eltern eines jeden Bundesligaspielers, obwohl ihr Sohn Alexander schon seit 2012 nicht mehr für den UHC spielt. Sie organisiert alle Reisen und lädt Eltern von auswärtigen Spielern zum Essen ein, wenn die in Hamburg zu Besuch sind. All diese Unterstützer machen einfach sensationelle Arbeit und sind für die Außendarstellung unseres Klubs immens wichtig.
Selbstverständlich spielt für die Atmosphäre in einem Verein der Vorstand eine wichtige Rolle. In den fast 30 Jahren, die ich jetzt Mitglied im UHC bin, habe ich mit Axel Schneider und unserem aktuellen Präsidenten Horst Müller-Wieland nur zwei Klubchefs erlebt. Diese Kontinuität ist beispielhaft und belegt den familiären Zusammenhalt. Der UHC-Ansatz ist nicht profitorientiert, jeder weiß, wie viel ehrenamtliches Engagement notwendig ist, damit der Verein so funktioniert, wie er es tut. Der Impuls ist immer, Probleme gemeinsam zu lösen, anstatt anders denkende Mitglieder auszugrenzen oder gar auszuschließen. Und dafür, dass sie diesen Weg mitgehen, anstatt selbstherrlich zu agieren, gebührte früher Axel und gebührt heute Horst und seiner Ehefrau Anja mein größter Respekt.
Selbstverständlich gibt es in jeder Familie auch schlechte Tage und Menschen, die einander nicht mögen. Ein solches Negativbeispiel war die Entlassung des damaligen Herren-Cheftrainers Lutz Reiher im Jahr 2006, der in seinem Urlaub angerufen und von seiner Absetzung in Kenntnis gesetzt wurde. Da seine Frau Steffi und er enge Freunde meiner Mutter sind, war ich dabei und erlebte mit, wie verzweifelt er nach dem Anruf war. Lutz war ein UHC-Eigengewächs par excellence, deshalb war sein Abgang ein harter Schlag, auch für mich. Vor allem weil sich die Wege komplett getrennt haben, was sehr traurig ist. Schön ist, dass er als Sportlicher Leiter beim TTK Sachsenwald neues Glück gefunden hat.
Grundsätzlich aber ist der Fakt, Verlässlichkeit zu haben, zu wissen, was man hat an dem, was man liebt – gerade in Deutschland, wo die Menschen im Allgemeinen wenig Lust auf Veränderung haben, weil es ihnen in ihrem Status Quo gut genug geht – ein wichtiger Aspekt. Und der wird im UHC enorm ernst genommen.
Trotzdem ist nicht wegzudiskutieren, dass sich das Vereinsleben über die vergangenen 25 Jahre gewandelt hat. Ich erinnere mich, dass wir in der Jugend sehr oft auf Veranstaltungen mit allen anderen Jugendmannschaften des Klubs waren. Jedes Jahr gab es in der Tennishalle ein riesiges Herbstfest, wo auch Nichtmitglieder dabei sein konnten. Dafür wurde in den umliegenden Schulen geworben, und regelmäßig kamen 800 bis 1000 Gäste. Ein Megaspaß war das – aber natürlich auch ein enormer Aufwand, und deshalb gibt es von solchen Events heute viel weniger.
Gleiches gilt für das Jugendtraining, das früher für Bundesligaspieler fast Pflichtprogramm war. Als ich 2003 im Herrenbereich anfing, trainierte fast jeder Kaderspieler irgendeine Jugendmannschaft. Das führte zu einer großen Bindung innerhalb des Vereins. Ist doch eine logische Rechnung: Wenn man im Schnitt zehn Spieler nimmt, die durchschnittlich zwölf Kinder trainieren, dann bindet man damit 120 Kinder und 240 Eltern emotional an die Bundesligamannschaft. Das sind für jedes Heimspiel schon einmal fast 400 potenzielle Zuschauer, die durch die persönliche Ansprache auch emotional ganz anders mitfiebern. Ich habe mit 25 noch damit geprahlt, fast jedes Kind im Klub zu kennen. Heute glaube ich kaum, dass irgendein Youngster auch nur ein Zehntel der Jugendlichen kennt. Das ist sehr schade, hat aber gute Gründe.
Von den Jungs, die in den vergangenen Jahren in den Herrenbereich aufgerückt sind, leitet kaum noch jemand ein Jugendtraining, und ich kann und will ihnen das auch gar nicht vorhalten. Wir haben uns durch das Training früher 400 Euro dazuverdient. Die Jungs heute bekommen das Geld so, als Auflauf- oder Siegprämie. Es hat sich eben auch im Hockey eingebürgert, dass wenigstens in der Bundesliga gewisse Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Und wer als junger Spieler dann die Wahl hat, der geht eben dorthin, wo das Geld auch fließt, ohne dass man zusätzlich zu seiner sportlichen Arbeitskraft auch noch anderweitig mitanpacken muss.
Eine weitere Erklärung ist selbstverständlich die Verdichtung des Arbeitslebens und die damit einhergegangene Verknappung der Zeit. Früher war es so, dass die Eltern Mitglieder im Klub waren und ihre Kinder dann selbstverständlich auch anmeldeten. Heute sind viele Eltern gar nicht mehr Mitglied und deshalb auch nicht in das Klubleben eingebunden, sondern geben nur noch ihre Kinder zur Betreuung und Bespaßung ab. Die Zeit, sich freiwillig und ehrenamtlich einzubringen, können immer weniger Erwachsene aufbringen. Und viele wollen es auch gar nicht, weil sie fürchten, sonst die Zeit nicht zu haben, um im Beruf oder im Privatleben mitzukommen.
Früher war der Sportverein der Ort, den Menschen aufsuchten, um zu entschleunigen. Das findet heute entweder in irgendwelchen Wellness-Hotels statt – oder gar nicht mehr. Und daran hat natürlich der technische Fortschritt einen großen Anteil. Ich bin als überzeugter und reger Nutzer der sozialen Medien bekannt und finde viele Dinge, die uns das Internet ermöglicht, enorm spannend, wichtig und segensreich. Dennoch ist der Nachteil von Facebook und Co., dass vielen Menschen die Stunden, die sie früher für geselliges Klubleben aufgewendet haben, heute fehlen. Wenn ich sehe, wie viel Zeit auch ältere und alte Menschen mit ihrem Mobiltelefon oder dem iPad verbringen, dann finde ich das schon manchmal irre.
Es werden jeden Tag unfassbare Datenmengen ins Nichts gejagt, viele mit unsäglich unnötigem Inhalt. Anstatt sich mit seinen Kindern oder Enkeln zu beschäftigen, werden diese beim Spielen gefilmt oder fotografiert, als gelte es, die Speicherkarte so schnell wie möglich zum Überlaufen zu bringen. Ich bin mir sicher, dass sehr viele dieser Aufnahmen später nie mehr angeschaut werden. Aber da ich mich oftmals nicht anders verhalte, ist das schlicht eine Feststellung. Na gut, und vielleicht auch ein Appell, dieses Verhalten zu überdenken, der mich mit einschließt. Wir leben heutzutage viel weniger offline als uns guttäte. Und darunter leidet die Gemeinschaft, zu der Sportvereine zählen, weil Interagieren sich vom realen ins virtuelle Leben verschoben hat.
Ein gewaltiger Faktor, der auf das verknappte Zeitkonto einzahlt, ist zudem das Thema Ganztagsschule und die Verkürzung der Zeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre. Dieser enorme Druck steht dem Vereinsleben total entgegen. Jugendliche müssen heute ihre außerschulischen Aktivitäten, die früher zwischen 14 und 20 Uhr erledigt werden konnten, in die Stunden von 17 bis 20 Uhr quetschen. Wie ich früher fünf Stunden nachmittags im Klub abzuhängen, das kann sich heute kein Kind mehr erlauben – abgesehen davon, dass ich kaum von Computer- oder Videospielen abgelenkt wurde. Wenn ich heute Jugendlichen beim Spielen zuschaue, dann stelle ich fest, dass in den Pausen, wo wir früher einfach nur dasaßen und uns ausruhten oder dummes Zeug redeten, Fotos von sich beim Spielen gepostet und die sozialen Netzwerke gecheckt werden. Die Welt ist schneller geworden, und weil die meisten die Schnellsten, Besten und Coolsten sein wollen, kommt Entschleunigung immer zu kurz.
Das soll nun aber nicht so klingen, als würde ich das alles nur beklagen und wehleidig am Rand stehen, während unsere schöne Welt vor die Hunde geht. Wir sind gefragt, Lösungen zu finden – Wege, die für alle Seiten zum Erfolg führen können. Dafür müssen wir uns aber klarmachen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann, wenn wir im Leistungssport im weltweiten Vergleich nicht den Anschluss verlieren wollen. In Deutschland ist die Kultur auf das Vereinsleben aufgebaut, nicht umsonst unterstützt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit seinen 27 Millionen Mitgliedern in 90.000 Vereinen die Forderung, das deutsche Vereinswesen zum immateriellen Weltkulturerbe zu ernennen. Aber das aktuelle Schulsystem ist kontraproduktiv für das Vereinsleben.
Was also könnte man tun, um das zu ändern? Ein Blick in die USA, nach Australien oder Großbritannien zeigt, wie es möglich wäre, Leistungssport und Ganztagsschule zu vereinen. In diesen Ländern ist Sport Teil des Unterrichts, das bedeutet, dass die Trainingszeiten im Stundenplan stehen und deshalb kein Kind oder Jugendlicher am Ende des Schultags noch in einen Verein hetzen muss, um sein Training zu absolvieren. Der Nachteil ist, dass die Sportlerinnen und Sportler dort für ihre Schulen oder Universitäten antreten und es ein Vereinswesen in der deutschen Form überhaupt nicht gibt. Und das kann hierzulande auch niemand wollen.
Ein Lösungsansatz liegt für mich deshalb darin, dass Schulen und Vereine miteinander ein passendes Konzept ausarbeiten, um das System zu reformieren. Die Vereine könnten ihre Jugendtrainer tagsüber an die Schulen in der Umgebung schicken, damit sie dort zu festgelegten Zeiten Training geben. Sinnvoll wäre dafür ein festes Schema, nach dem die verschiedenen Altersklassen zu gleichbleibenden Uhrzeiten Training haben: zum Beispiel die Achtjährigen von 8 bis 9 Uhr, danach die Neunjährigen von 9 bis 10 Uhr und so weiter. Das würde auch dazu führen, dass die wirtschaftlich nachgewiesene Bedeutung von körperlicher Betätigung für die Entwicklung und das Wohlbefinden der Menschen endlich angemessen in der Schule umgesetzt würde, weil die tägliche Sportstunde Pflicht wäre. Diejenigen, die keinen Sport finden, der zu ihnen passt oder zu dem sie Lust haben, könnten in der Zeit eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben.
Sollte es logistisch nicht möglich sein, dass die Vereinstrainer an die Schulen gehen, weil beispielsweise die Hockeyspieler an verschiedenen Schulen im Einzugsgebiet lernen, dann müssten die Schüler eben zu ihren Vereinen. Die würden sich freuen, dass ihre Anlagen endlich auch mal bis 14 Uhr gut ausgelastet sind. Ich sehe strukturell einen riesigen Bedarf dafür, die Trainingszeiten zu entzerren. Heute sind die Anlagen nachmittags und abends in den Stoßzeiten so überfüllt, dass es viel zu wenig Trainingszeiten gibt. Wenn einige Einheiten davon vormittags ausgetragen würden, wäre allen geholfen. Dafür könnte es sogar sinnvoll sein, einen Shuttledienst einzurichten, um die Kinder von der Schule abzuholen und wieder hinzubringen. Natürlich muss man all das genauer durchrechnen und auf die wirtschaftliche Machbarkeit abklopfen. Aber eine Reform des Leistungssports im Jugendbereich ist unumgänglich, wenn wir nicht immer weiter hinter die vielen Nationen zurückfallen wollen, die alles auf den Sport setzen.
Als Kind des deutschen Vereinswesens im Allgemeinen und des Uhlenhorster HC im Besonderen dürfte es niemanden verwundern, dass mir das Wohlergehen der Vereine sehr am Herzen liegt. Um in eine erfolgreiche Zukunft starten zu können, müssen sich jedoch auch die Vereine deutlich verändern. Im Idealfall ist ein Verein wie eine zweite Heimat, für manche vielleicht sogar die erste. Er muss ein Ort sein, an dem man sich einfach gern aufhält. Wenn meine dreijährige Tochter Emma heute das UHC-Logo sieht, ruft sie mit leuchtenden Augen „UHC!“. Und wenn ich sie anziehe und ihr sage, dass wir in den Klub fahren, dann reißt sie die Arme hoch und ruft: „Hockey, ja!“ Sie spielt mittlerweile selbst schon gern mit anderen Kindern in der Halbzeit meiner Spiele auf dem großen Kunstrasen. Zu sehen, dass sie ähnlich empfindet wie ich in ihrem Alter (und auch noch lange danach), erfüllt mich mit einem großen Glücksgefühl. Wenn ein Verein diese Gefühle auslöst, dann ist es schon fast egal, was er anbietet. Wenn sich dazu auch noch Erfolg einstellt, ist das das Maximum, das ein Verein erreichen kann.
Aber dass sportlicher Erfolg nicht der Maßstab dafür ist, dass Menschen sich an einen Verein gebunden fühlen, ist in Hamburg sicherlich perfekt am HSV abzulesen. Aber auch im Hockey sieht man es daran, dass zu den Spielen der Zweitligateams unseres Nachbarklubs Klipper THC nicht viel weniger Menschen kommen als die 400, die wir im Schnitt bei unseren Bundesligaspielen begrüßen dürfen. Und das liegt daran, dass sich die Menschen dort zu Hause fühlen. Diese emotionale Bindung ist die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Zu unseren Herrenspielen kommen deutlich mehr Zuschauer als zu den Damen, obwohl die sportlich absolut hochwertig abliefern und seit Jahren erfolgreicher sind als wir. Aber dennoch fühlen sich dem Herrenteam mehr Leute verbunden, was aber sicherlich auch daran liegt – und das mögen die Damen mir verzeihen –, dass Herrenhockey einfach rasanter und dadurch spannender anzuschauen ist.
Noch besser kann man dieses emotionale Attachment am Beispiel Fußball erklären. Das Spiel an sich ist ja nicht spannender als viele andere Sportarten. Dennoch pilgern regelmäßig mehr als 50.000 Fans zu den Heimspielen des HSV. Warum? Weil sie emotional mitgenommen werden und weil das Drumherum wesentlich professioneller ist. Es ist also Aufgabe der Vereine, sich die Frage zu stellen, welchen Anreiz wir Sportfans bieten, um uns zuzuschauen, anstatt immer nur zu lamentieren, dass es zu wenige tun. Und wie es uns gelingt, viel mehr Menschen dazu zu bringen, Mitglied zu werden und sich aktiv ins Vereinsleben einzubringen.
Um das zu erreichen, muss sich jeder Verein in Bezug auf seine Angebote zwar nicht stetig neu erfinden, aber der Zeit anpassen. Dazu gehört, dass die Mitglieder Kritik üben, ihr Feedback dann aber auch ernst genommen und umgesetzt wird. Ich verdeutliche das an einem Beispiel aus dem UHC, wo der Wunsch nach einem modernen Fitnessbereich aus der Mitgliedschaft laut wurde und im Jahr 2016 auch umgesetzt wurde. Das hat zu einer enormen Aufwertung unserer Anlage und einem deutlich erhöhten Wohlfühlfaktor geführt. Solche Dinge spielen auch eine Rolle, wenn man die Abwanderung in die Wellness-Oasen eindämmen möchte.
Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist die nach einem Vereinswechsel. Innerhalb Deutschlands habe ich für keinen anderen Klub als den UHC gespielt, und tatsächlich gab es auch nie die Verlockung, es zu versuchen. Es mag manchen komisch vorkommen, aber seit ich in der Bundesliga spiele, gab es noch kein einziges Angebot von einem anderen deutschen Klub, nicht einmal eine vorsichtige Anfrage! In die Niederlande, die die beste Liga der Welt haben, hätte ich jedes Jahr wechseln können, aber wahrscheinlich wussten und wissen die deutschen Vereine, dass ich mit dem UHC verheiratet bin, und respektieren das.
Wobei ich, und da muss man ehrlich sein, einen Wechsel nie ausgeschlossen habe. Ich hätte mir ein Angebot aus Mannheim oder Krefeld in jedem Fall angehört und mir sogar vorstellen können, innerhalb Hamburgs zu wechseln. Natürlich gibt es die Rivalität unter den großen Klubs, und es wäre, gerade aufgrund meiner Verbundenheit und unserer Familiengeschichte sicherlich sehr schwer geworden, einen Wechsel zu einem anderen Hamburger Verein zu erklären. Aber ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die beim Harvestehuder THC oder beim Club an der Alster geleistet wird, und schätze diese Klubs sehr. Deshalb war es für mich nie undenkbar, für sie aufzulaufen.
Tatsächlich hätte es sogar passieren können, allerdings war das noch vor meiner Zeit als Bundesligaspieler. Ich war 18 und stand vor dem Sprung in den Herrenkader, als der UHC mit den argentinischen Nationalspielern German Orozco und Matias Paredes, den schwedischen Auswahlakteuren Magnus Mattson und Anders Eliason und dem deutschen Nationalspieler Christoph Gläser fünf Topspieler verpflichtete. Natürlich befürchtete ich, nachdem ich in der Saison 2002/03 als junges Nachwuchstalent fast keine Spielzeit im Herrenkader bekommen hatte, dass sich meine Lage noch verschlechtern würde.
In dieser Zeit gab es eine Anfrage vom HTHC, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte. Ich bin dann zu dem oben bereits erwähnten Familienfreund Lutz Reiher gegangen und habe ihn um seine ehrliche Meinung gebeten. Und noch heute bin ich dankbar für das, was er sagte. Sein Rat war: „Nimm nicht das erste Angebot an, sondern versuche erst einmal, dich hier durchzubeißen. Wenn es nicht klappt, kannst du in zwei Jahren immer noch gehen. Aber du wirst glücklich sein, dass du es wenigstens versucht hast, um deinen Platz zu kämpfen.“
Genauso ist es gekommen. Ich habe mir Lutz‘ Rat zum Credo gemacht, und heute sehe ich es immens kritisch, dass die Zahl der Wechsel innerhalb Hamburgs und auch allgemein so zugenommen hat. Das mag kontrovers zu dem Fakt erscheinen, dass ich mir einen solchen Wechsel ebenfalls hätte vorstellen können. Aber ich hätte ihn nur gemacht, wenn es sportlich keinen anderen Weg gegeben hätte, um Spielzeit zu bekommen, oder wenn wir mit dem UHC abgestiegen wären, denn dann wäre mein sportlicher Ehrgeiz vielleicht doch größer gewesen als die Vereinsliebe.
Oftmals jedoch werden Wechsel heute vollzogen, weil sie den Weg des geringeren Widerstands bedeuten, oder schlicht, weil der andere Verein ein paar Taler mehr bietet. Und das finde ich fatal. Früher gab es keinen Grund, innerhalb von Hamburg zu wechseln, weil die großen drei auf einem ähnlichen sportlichen Level waren und Geld keine Rolle spielte. Heute sammeln viele Jungs lieber ein paar Euro ein, die sie kurzfristig vielleicht glücklich machen, geben dafür aber ein Netzwerk und eine zweite Familie auf, die ihnen langfristig viel mehr genutzt hätten. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, und ich bin überzeugt davon, dass am Ende diejenigen am meisten Erfolg haben werden, die sich auch mal Widerständen stellen, anstatt vor ihnen wegzulaufen.
Dass es für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig sein kann, sich auch mal in einem anderen Umfeld beweisen zu müssen, möchte ich gar nicht bestreiten. Ich habe es selbst erleben dürfen, als ich in der Saison 2012/13 für den Club de Campo in Madrid spielte. Die vier Saisons in der indischen Profiliga, auf die ich in einem eigenen Kapitel eingehe, zähle ich insofern nicht mit, als diese nur jeweils wenige Wochen eines Jahres umfassten und ich währenddessen ganz normal für den UHC spielen konnte.
In Spanien hatte ich das Glück, in einem Verein zu spielen, in dem die Hockeyabteilung mit der des UHC vergleichbar war. Da waren immer dieselben Leute bei den Heimspielen, man hat gemeinsam gegessen und gefeiert, es war eine tolle Gemeinschaft, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Auch deshalb habe ich kein übermäßiges Heimweh gehabt oder den UHC übertrieben vermisst, obwohl ich noch genau weiß, wie Olli Korn, der mit mir dort war, und ich bei den UHC-Spielen immer am Liveticker mitgefiebert haben. Was mich besonders beeindruckt hat, war der Fakt, dass die Hockeyfamilie sich nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern international ist. Ich behaupte, dass ich von den 208 Ländern, die es auf der Welt gibt, 120 besuchen könnte, in denen ich dank meiner Verbindung zum Hockey sofort irgendwo einen Schlafplatz finden würde.
Ich habe mir schon manches Mal Gedanken darüber gemacht, was ich von meinem UHC in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erwarte. Kurzfristig werden wir im Leistungssport umdenken müssen, weil unser bisheriger Weg langfristig leider nicht erfolgreich bleiben kann. Es wird immer weniger Spieler geben, die kompromisslos ein Leben lang in einem Verein spielen werden. Das bedeutet, dass wir uns auch finanziell Strukturen aufbauen müssen, die es ermöglichen, Spieler an den Verein zu binden und ihnen Perspektiven zu bieten. Die Jugendarbeit bleibt die wichtigste Säule, aber sie allein genügt nicht, wir brauchen immer wieder Top-Verstärkungen, und dafür ist es notwendig, Geld in die Hand zu nehmen. Aber diese Erkenntnis ist bei den Verantwortlichen angekommen.
Ansonsten wünsche ich mir ein Stück weit eine Rückbesinnung auf das Gemeinschaftsgefühl, das den UHC zu dem Familienverein gemacht hat, den wir alle so lieben. Meine Kinder sollen ebenso glücklich am Wesselblek aufwachsen, wie es mir vergönnt war. Ich selbst werde immer versuchen, dem UHC zu helfen, wo es möglich ist. Schon jetzt arbeitet einer unserer Spieler, Michael Bremner, als Grafikdesigner in meinem Unternehmen. Ob ich irgendwann auch einen offiziellen Posten übernehme, weiß ich noch nicht. Es liegt ja auch nicht nur in meiner Hand. Ich strebe es nicht an, schließe es aber auch nicht aus. Was ich ausschließe, ist, dass der UHC irgendwann seinen Platz in meinem Herzen verliert. Er wird immer mein kleines Paradies sein.