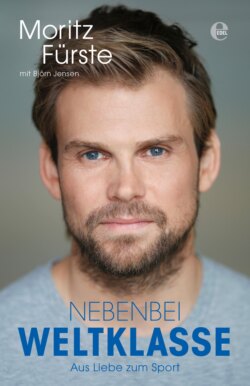Читать книгу Nebenbei Weltklasse - Björn Jensen - Страница 8
K A P I T E L 3 WIE EIN MOMENT ALLES VERÄNDERN KANN
ОглавлениеAn den Moment, der mein Leben auf den Kopf stellte, habe ich keine klaren Erinnerungen mehr. Vielleicht ist es gut, dass man traumatische Erlebnisse nicht so sehr im Gedächtnis behält, sodass sie einen nicht viele Jahre quälen können. Und sehr wahrscheinlich ist es normal, dass man als Neunjähriger nicht auf den Wortlaut achtet, mit dem die eigene Mutter das Unvorstellbare zu erklären versucht.
Ich weiß noch, dass mein Bruder Jonas und ich an jenem 29. September 1994 in bester Laune nach Hause kamen. Am Vortag waren wir zu einem Freund zur Übernachtung ausquartiert worden. Die Sonne schien, als wir mit den Fahrrädern an unserem Haus in Lemsahl-Mellingstedt vorfuhren. Meine Mutter lebt hier heute noch und es ist für uns immer noch der Ort, den wir Heimat nennen. Das Einzige, was anders war als sonst, waren die vielen Autos, die vor der Tür parkten. Das registrierte ich, dachte mir aber nichts dabei.
Im Haus waren viele Leute. Mama nahm uns in Empfang und führte uns ins gemeinsame Kinderzimmer. Und dann hat sie versucht, uns so schonend wie möglich, aber auch so offen wie nötig zu erklären, dass unser Papa Peter am Vortag an Bord der Autofähre Estonia gewesen war, die vor der finnischen Insel Utö gesunken war. Papa galt als vermisst; die Hoffnung, ihn lebend aus der 13 °С kalten Ostsee zu bergen, tendierte gegen null. Als Neunjähriger erfasst man die Tragweite einer solchen Nachricht natürlich nicht in vollem Umfang. Joni und ich weinten gemeinsam mit Mama und versuchten dann, uns mit Fußballspielen abzulenken. Aber das klappte natürlich nicht.
Was macht es mit einem neun Jahre alten Jungen, wenn er das Schlimmste erlebt, was er sich vorstellen konnte – außer vielleicht, beide Eltern auf einen Schlag zu verlieren? Natürlich habe ich mir diese Frage gestellt, noch viel öfter ist sie mir gestellt worden. Und natürlich habe ich auch versucht, Antworten auf diese Frage zu finden. Hat sich mein Charakter durch diesen Schicksalsschlag verändert? Wäre ich ein anderer geworden, wenn ich meinen Vater nicht verloren hätte?
Es mag sich komisch anhören, aber die aktiven Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, sind sehr diffus und auch nicht besonders zahlreich. Einerseits macht mich das manchmal traurig, andererseits ist es eine normale menschliche Reaktion, dass man vor allem negative Erinnerungen verdrängt, um nicht in jeder Situation an den Verlust denken zu müssen. Ein paar Bilder habe ich vor Augen, wenn ich an Papa denke. Wie er Joni hochhebt und ihn durchkitzelt und wir uns alle drei totlachen. Oder wie wir bei Sommerregen in Unterhosen durch den Garten toben und Mama uns dabei fotografiert. Papa hatte eine unheimlich positive, herzenswarme Ausstrahlung, er war ein total verspielter Vater, für den wir zwei Jungs einfach alles waren. Und er war ja selber noch sehr jung. 1994 war er gerade 37 Jahre alt.
Und dann gibt es diese unterbewussten Erinnerungen, die situationsbedingt aufwallen. Zum Beispiel liebe ich es, bei starkem Regen das Fenster zu öffnen und mit diesem Hintergrundgeräusch Tennis zu schauen. Das haben wir nämlich mit unserem Vater getan, im Hamburger Sommer, wenn es draußen schüttete. Dann öffnete er die Terrassentür, und wir saßen gemeinsam auf dem Sofa und schauten Wimbledon. Den Sport-Enthusiasmus, der Teil meiner DNA ist, den habe ich von meinem Vater. Und das ist auch eine meiner Hauptmotivationen, weshalb mir das Thema so sehr am Herzen liegt – glaube ich.
Und sein Hockeytalent habe ich auch geerbt. Auch wenn er nie Bundesliga gespielt hat, beschreiben ihn alte Freunde und Weggefährten als einen sehr talentierten Spieler, der aber vor allem dank seiner Art ein sehr beliebter Teamkollege war, für den bei allem Ehrgeiz immer der Spaß am Spiel im Vordergrund stand. Über die Jahre haben mir immer wieder Menschen, die ihn kannten, gesagt, dass ich ihm nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sehe, sondern auch vom Charakter und als Spielertyp sehr viel von ihm in mir vereinen würde. Ich höre das unheimlich gern und bin darüber sehr glücklich. Manchmal halten diese Weggefährten minutenlange Monologe darüber, was für ein besonderer Mensch mein Vater war. Als ich 25 Jahre alt war, ließ meine Mama mich die Briefe lesen, die Arbeitskollegen ihr nach seinem Tod geschickt hatten. Die waren herzzerreißend und haben mich tief bewegt. In dem Moment nahm ich mir vor: Ich möchte, dass die Leute später auch in dieser Art und Weise über mich sprechen. Dann hätte ich alles erreicht.
Die Monate nach Papas Tod waren selbstverständlich extrem schwer, vor allem jedoch für Mama und meine Oma. Drei Wochen vor dem Estonia-Unglück hatte Mama ihren Vater und Oma ihren Mann verloren. Nun blieb überhaupt keine Zeit mehr, den Verlust unseres Opas zu betrauern, weil es für meine Mama darum ging, Jonas und mir eine starke Stütze zu sein, und für Oma Tordis darum, ihrer Tochter beizustehen. Wenn ich mir heute, als zweifacher Vater, vorstelle, wie viel Kraft das erfordert haben muss, gibt es keine Worte, um den Respekt und die tiefe Dankbarkeit zu beschreiben, die ich dafür empfinde, was die beiden durchgemacht haben.
Man darf ja darüber hinaus nicht vergessen, dass der Tod des voll berufstätigen Vaters auch ein finanzieller Einschnitt ist. Mama hat sich das aber niemals anmerken lassen und uns immer das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung sei.
Natürlich litten Jonas und ich unter der Situation, wenn auch auf unterschiedliche Art. Joni ging mit dem Gefühl der Trauer offener um, er redete darüber und zeigte ohne Scham, wenn es ihm schlecht ging. Ich dagegen reagierte eher introvertiert und versuchte, stark zu sein. Mama hatte uns zwar gesagt, dass wir die Trauer zulassen sollten, wenn sie uns überkam. Aber ich sah, wie traurig Mama selbst war, und da wollte ich sie nicht noch trauriger machen dadurch, dass ich offen meine eigene Betroffenheit zeigte.
In der Schule geschah es bisweilen, dass ich an manchen Tagen aus der Klasse geholt wurde, um Joni zu trösten, wenn er von seiner Trauer übermannt wurde. Damals habe ich mich für ihn verantwortlich gefühlt. Heute denke ich, dass das eine ganz schöne Last für einen Zehnjährigen war. Aber in der Situation war es selbstverständlich: Ich wollte helfen, meine Mama zu entlasten, und ich wollte für meinen Bruder da sein.
Dabei ging es mir selbst manchmal auch sehr schlecht. Der Gedanke der Endlichkeit hat mich einige Jahre beschäftigt. Bis heute ist es für mich die deprimierendste Vorstellung, zu wissen, dass irgendwann das Ende kommt und man selber nicht mehr da ist. Zu wissen, dass mein Papa nicht mehr wiederkommen würde, war dagegen meine Realität. Joni und ich schauten in den Wochen nach dem Unglück manchmal heimlich die Nachrichten oder durchforsteten die Listen mit Namen der Vermissten, in der Hoffnung, irgendwo ein Zeichen zu entdecken, dass Papa doch noch leben könnte. Wir dachten, dass er sich vielleicht auf eine Insel gerettet hatte. Und auch wenn es natürlich völlig unrealistisch ist, verlässt einen diese Hoffnung nie so ganz. Sein Leichnam ist nie gefunden worden, es gibt deshalb auch kein Grab, an das wir gehen können. Mama hielt das nicht für richtig, und ich stimme ihr zu, während Jonas gern einen Ort gehabt hätte, an den er zum Trauern hätte gehen können.
Auch wenn das Leben schon am Tag, nachdem wir von Papas Tod erfahren hatten, weiterging wie zuvor, weil wir wieder in die Schule mussten, beherrschte mich viele Monate lang ein diffuses Gefühl, das ich irgendwann einfach als „Weltschmerz“ bezeichnete. Das äußerte sich darin, dass ich auf Partys bei Freunden von einem auf den anderen Moment in tiefe Traurigkeit fiel. Der Auslöser konnte ein Musikstück sein, das mich berührte, oder irgendeine Situation, die Erinnerungen zurückholte. Ich habe mich dann meist im Badezimmer eingeschlossen und hemmungslos geheult, bis mich irgendwann meine Freunde rausholten, wenn ich mich wieder beruhigt hatte.
Natürlich war mir das unangenehm, aber das war meine Art, das Erlebte zu verarbeiten. Wobei ich den Begriff „verarbeiten“ nicht mag, weil ein solch einschneidendes Erlebnis niemals verarbeitet werden kann, es bleibt für immer prägend. Mama hat sich häufig gefragt, ob ihre Art der Trauerbewältigung die richtige gewesen ist. Sie hat selbst nie professionelle psychologische Hilfe in Anspruch genommen und auch uns nicht damit in Berührung gebracht. Sie sah den Sinn darin nicht, in alten Wunden zu rühren und Erinnerungen heraufzubeschwören, und ich kann das nachvollziehen. Es gibt sowieso nicht den einen, richtigen Weg, mit einem solchen Erlebnis umzugehen. Jeder muss selbst herausfinden, was ihm hilft und was ihm guttut.
Ich selbst rede heute gern und offen über den Tod, allerdings nicht immer, nicht überall und auch nicht mit jedem. Zum 20. Jahrestag der Estonia-Katastrophe haben Mama, Joni und ich dem Hamburger Abendblatt unser einziges Interview zu dem Thema gegeben. Für uns war das eine Art Schlussstrich unter das Kapitel und die Chance, etwas zu haben, auf das wir verweisen können, wenn wieder Fragen dazu kommen. Ansonsten hatte Mama nie einen Sinn darin gesehen, das Private in der Öffentlichkeit auszubreiten.
Für mich kam irgendwann der Moment, als der Weltschmerz verschwand und auch nicht mehr wiederkehrte. Seitdem bin ich ein durchweg positiver Mensch, der sich ungern mit Problemen beschäftigt, sondern lieber in Lösungen denkt. Mein Glas ist immer halb voll. Ich halte es grundsätzlich für verschwendete Zeit, sich über Dinge Gedanken zu machen, die nicht mehr zu ändern sind. Deshalb lebe ich überhaupt nicht in der Vergangenheit, sondern immer im Hier und Jetzt.
Das gilt im Übrigen nicht nur für negative Dinge, sondern auch für Erfolge. Ich habe beispielsweise noch nie Aufzeichnungen der gewonnenen Olympia-Endspiele gesehen. Einzig meine Tore im Rio-Viertelfinale 2016 gegen Neuseeland, als wir in der Schlussminute aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht haben, habe ich mehrfach gesehen, weil sie in Rückblick-Videos immer wieder laufen. Als ich in diesem Frühjahr für die TV-Serie Ewige Helden, an der ich als einer von acht Sportlern teilnehmen durfte, einen Rückblick auf mein Leben gezeigt bekam, gab es viele Bilder, die ich nicht kannte. Und schon beim ersten Video musste ich total losheulen. Es zeigte mich als Sechsjährigen, wie ich auf den Hockeyplatz renne und mein Vater mir als Betreuer unseres Teams auf den Po klopft. Ich hatte das Video selbst noch nie gesehen und war tief berührt.
Überhaupt würde ich mich als sehr emotionalen Menschen bezeichnen. Alles, was meine eigene kleine Familie, meine Frau Stephanie und meine Töchter Emma und Lotta, angeht, nimmt mich mit. Und ich bin ganz nah am Wasser gebaut. Ich habe eine hohe Affinität zu guter Musik und zu Menschen mit besonderen Talenten. Wenn ich in einer Castingshow einen richtig guten Sänger höre, ist es um mich geschehen, dann sind Tränen absolut gesetzt, da kann ich gar nichts machen.
Allerdings, und diese Einschränkung muss ich eingestehen, bin ich beim Thema Tod ziemlich abgestumpft, was mir manchmal Diskussionen mit meiner Frau einbringt. Sie nimmt Anteil daran, wenn eine Verwandte einer entfernten Bekannten stirbt, die sie gar nicht kennt. Ich sage dann immer: „Wenn ich so etwas an mich herankommen lassen würde, müsste ich den ganzen Tag traurig sein!“ Wir leben in einer Zeit, in der in den Nachrichten von 137 Toten bei einem Anschlag in Kabul berichtet und im nächsten Atemzug das Ergebnis des Champions-League-Spiels vom Vorabend verkündet wird. Das ist manchmal verstörend, bedeutet aber schlicht und einfach, dass wir uns um unser eigenes Leben kümmern müssen.
Ich habe deshalb eine Art Schutzschild um mich herum hochgezogen. Wenn jemand im Alter von 25 das erste Mal mit dem Tod konfrontiert wird, weil ein Großelternteil stirbt, dann mag das traurig sein, aber letztlich ist es der normale Lauf des Lebens. Wer dagegen mit neun Jahren seinen Vater verliert, der hat das Furchtbarste erlebt, was ein Kind erleben kann. Daraus ist bei mir eine gewisse Härte entstanden, die mich Negativerlebnisse leichter ertragen lässt. Und wenn man so will, dann ist das das Positive, was ich aus Papas Tod mitgenommen habe, natürlich ohne darüber glücklich zu sein. Aber eine gefährdete Versetzung im Alter von 13 Jahren erscheint einfach weniger bedrohlich, wenn man weiß, was man schon überstanden hat. Und auch wenn dieses Beispiel natürlich sehr plakativ ist, so beschreibt es doch, wie ich über Negatives denke. Ich würde deshalb sagen, dass mich die Erfahrung, Papa zu verlieren, sehr früh hat reifen lassen.
Die Frage, was es mit mir gemacht hat, Papa viel zu früh zu verlieren, kann ich allerdings bis heute nicht schlüssig beantworten. Selbstverständlich war es einschneidend, keinen Mann als Rollenvorbild in der Familie zu haben, an dem man sich ausrichten und später vielleicht auch abarbeiten kann. Auch wenn Mama ihre Rolle als Alleinerziehende sensationell ausgefüllt hat und ich in vielen Lebenslagen Rat bei ihr finden konnte, war das eine Lücke, die da war, und wie ich sie kompensiert habe, kann ich gar nicht sagen.
Einen Vaterersatz gab es für mich nie, und ich meine sagen zu können, dass ich mich danach auch nie gesehnt habe. Wir hatten dank unserer Nachbarn Barbara und Helmut Stobbe, bei denen wir sehr viel Zeit verbrachten, und Steffi und Lutz Reiher, den besten Freunden meiner Mutter, großartige Ansprechpartner, die uns sehr geholfen haben. Und auch Thosi, der Halbbruder meines Vaters, und seine Frau Gerti haben sich sehr um Joni und mich gekümmert. Zudem sind einige ehemalige Mitspieler aus Papas Team heute, trotz des Altersunterschieds, gute Freunde für mich geworden. Das hat sich über die Jahre entwickelt, und wahrscheinlich waren all diese Einflüsse zusammengenommen eine Art Vaterersatz für mich.
Was der Tod meines Vaters für meine Karriere bedeutet hat? Ob die Reife und das Verantwortungsbewusstsein, die ich auf dem Platz ausstrahle, damit zusammenhängen, dass ich so früh erwachsen werden musste? Natürlich sind auch diese Fragen hypothetisch, aber ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Nach Papas Tod wollte ich vielmehr im Hockey Spaß und Glück erleben. Hockey gab mir die Möglichkeit, den Kopf freizubekommen und an schöne Dinge zu denken, deshalb habe ich auch drei Tage nach der schlimmen Todesnachricht schon wieder für den UHC gespielt – und gegen Großflottbek einen entscheidenden Siebenmeter verwandelt.
Ich wollte einfach glücklich sein, und dieses Glück fand ich bei meinen Freunden im Hockeyteam. An Leistung, Verantwortung oder solche Dinge habe ich damals gar nicht gedacht. Das kam erst viel später dazu, deshalb denke ich, dass Papas Tod auf meine Leistungssportkarriere keine konkreten Auswirkungen gehabt hat. Mit der Ausnahme vielleicht: Die Entscheidung für den Teamsport Hockey und gegen den Einzelsport Tennis habe ich auch deshalb getroffen, weil mir das Gefühl, in einem Team aufgefangen zu werden, anstatt auf mich allein gestellt zu sein, umso wichtiger war, weil ich gespürt hatte, wie sehr mir das geholfen hat, als es mir schlecht ging. Mir gefällt der Gedanke, dass alles auch so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, wenn Papa noch leben würde. Ich finde, man kann daraus Trost und Mut schöpfen, dass selbst härteste Einschnitte ein Leben nicht zwangsläufig kaputt machen müssen.
Natürlich wünsche ich mir manchmal, Papa hätte das alles erleben können. Viele, die ihn kannten, sagen, dass er der stolzeste Vater der Welt wäre. Aber nicht vorrangig, weil Joni und ich sportlich so erfolgreich geworden sind. Sondern deshalb, weil wir so geworden sind, wie er es war und wie er es für uns gewollt hätte. In den ersten Monaten nach seinem Tod habe ich ihn mir oft zurückgewünscht, aber nachdem ich die Realität angenommen hatte, habe ich nicht mehr häufig darüber nachgedacht, wie er sich fühlen würde. Dass ich nach beiden Olympiasiegen in den Himmel geschaut habe, ist eher unterbewusst passiert. Aber es zeigt, dass zwischen uns eine Verbindung existiert.
Auch heute noch habe ich Probleme mit dem Gedanken an die Endlichkeit des Lebens. Angst vor dem Tod ist das falsche Wort, es ist eher dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ich furchtbar finde. Der Tod verliert nicht den Schrecken, wenn er einem das genommen hat, was man am meisten liebt. Und seit ich selbst Kinder habe, ist da auch etwas, das ich mir noch schrecklicher vorstelle als den Verlust der eigenen Eltern.
Aber glücklicherweise habe ich die Gabe, solche negativen Gedanken herauszufiltern und sofort wegzuschieben, wenn sie auftreten. Ich finde das Leben so lebenswert, dass ich mir einfach nicht vorstellen will, wie es ist, nicht mehr da zu sein und auf einen Schlag nicht nur einen geliebten Menschen zu verlieren, sondern alle; auch wenn man selbst davon höchstwahrscheinlich gar nichts mitbekommt.
Im Berufsleben muss man Dinge von allen Seiten betrachten und auch einen Plan dafür haben, wenn der schlechteste Fall eintritt. Aber für das Leben und für den Sport braucht man kein Worst-Case-Szenario, sondern nur positive Energie. So wie mein Vater sie hatte. Dass er mir viel davon mit auf meinen Weg gegeben hat, war das Beste, was mir passieren konnte. Und dafür bin ich sehr dankbar.