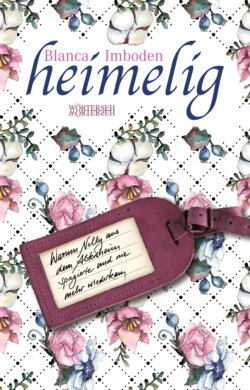Читать книгу heimelig - Blanca Imboden - Страница 10
1 Seniorensammelstelle
Оглавление»Habt ihrs gelesen? Sparen, sparen, sparen! Heute stand in der Zeitung, dass unser Altersheim im nächsten Jahr endlich schwarze Zahlen schreiben müsse, damit man es dann in eine Aktiengesellschaft überführen könne«, berichtet Tobias beim Mittagessen. Etwas Rahmspinat läuft ihm über das Kinn, so sehr empört er sich. »Euch ist schon klar, was das heißt: noch weniger Personal und noch schlechteres Essen. Und am Ende Privatisierung mit Gewinndruck. Mir kanns ja egal sein. Ich sterbe eh vorher. Hoffentlich.«
Ganz ehrlich: Tobias sieht wirklich so aus, als würde er es nicht mehr lange machen, doch den übelsten Diagnosen zum Trotz lebt er fröhlich weiter. Na ja, fröhlich trifft bei ihm nicht wirklich zu. Aber er lebt weiter.
»Und gleichzeitig wollen sie die Zimmerpreise erhöhen!« Tobias ist noch nicht fertig mit seiner Klage. »Diese Logik erschließt sich mir nicht. Und aus den kleinen Aufenthaltsräumen in den Stockwerken will man zusätzliche Zimmer machen. Es wird also gespart, wir leben auf einer Baustelle, und wir zahlen dafür mehr. Es lebe das Altersheim!«
Tobias hebt ironisch sein Wasserglas.
Jetzt mischt sich Marlies ein: »Man sagt nicht mehr Altersheim, sondern Seniorenresidenz.« Sie schiebt den Teller von sich und schimpft: »Dieses Schnitzel ist zu zäh für meine teuren dritten Zähne.«
Hmm. Ist das nicht der eigentliche Sinn von teuren dritten Zähnen? Dass man endlich wieder alles essen kann, was einem hier vorgesetzt wird? Sonst kann man sich doch diese Anschaffung sparen, sich alles püriert vorsetzen lassen, und irgendwann freuen sich dann die Erben.
»Pah – Seniorenresidenz – Blödsinn!« Tobias plustert sich verärgert auf. »Betagtenwohnsitz, Feierabendhaus, Seniorenwohnheim. Am Ende ist es ja dann doch ein Altersheim. Alles andere ist Marketinggeschwafel!«
»Stimmt«, gebe ich Tobias recht und nicke ihm zu, worauf Marlies mich strafend anschaut. Ich könnte sie mit ein paar wenigen weiteren Sätzen so weit bringen, dass sie sich ihre Herzmedikamente bringen lassen muss, aber ich schweige, lächle einfach in mich hinein. Meine Enkelin Kim hat nämlich noch ganz andere Bezeichnungen für meinen neuen Wohnsitz gefunden –
Seniorenzwischenlager.
Runzelsilo.
Mumienbunker.
Faltenlager.
Seniorensammelstelle.
Und – ja, das lässt sich alles noch steigern – Abkratzresidenz.
Zugegeben: Diese frechen Wortschöpfungen haben sogar meinen eigenen Sinn für Humor ein wenig strapaziert. Wo bleibt da der Respekt vor dem Alter? Ich musste zuerst einmal leer schlucken und durchatmen, bevor ich dann doch herzhaft gelacht habe. Marlies hingegen würde wohl vom Stuhl kippen, müsste sie sich das anhören. Sie hat nämlich keinen Humor, nicht nur wenig, nein, gar keinen. Dafür ein schwaches Herz. Und ihre Anfälle sind nicht schön anzuschauen. Die erspare ich mir lieber. Obwohl es mir manchmal einfach Spaß macht, sie ein wenig zu necken. Sie ist so unglaublich engstirnig und kleingeistig, und alle ihre Reaktionen sind exakt vorhersehbar. Auf jede könnte ich schon im Voraus mein Hab und Gut verwetten.
Paul, die Nummer vier unserer erzwungenen Tischgemeinschaft, schüttelt fast unmerklich den Kopf und lächelt. Er hat mich beobachtet. Wie immer. Er sieht alles, hört alles, weiß alles. Paul ist der einzige Mann hier, der mich überhaupt sieht, der mich als Frau wahrnimmt, einer, der sogar ein wenig mit mir flirtet, für den es sich noch lohnt, eine frische Bluse anzuziehen, wenn man sich die alte gerade vor dem Essen noch mit irgendwas ruiniert hat. Er selber kommt immer in Anzug und Krawatte in den Speisesaal. Immer. Anfangs fand ich das ziemlich lächerlich. Aber dann bewunderte ich doch, wie er den Spott der anderen an sich abprallen ließ und sich nicht einen Millimeter anpasste. Solche Leute braucht es hier. Unangepasste.
Die Direktorin tritt auf. Ja, genau: Sie tritt auf. Mit einem Glöckchen wird jeweils angekündigt, wenn sie unseren Speisesaal mit ihrer Anwesenheit beehrt, weil sie uns etwas mitteilen will. Frau Meier, meist Frau Rottenmeier genannt, hat in diesem Heim-Universum den Schwarzen Peter gezogen und liegt auf der Beliebtheitsskala direkt hinter dem lausigen Chefkoch.
Die Mittvierzigerin sieht eigentlich aus wie ein blondes Engelchen, und mitten unter uns alten Leuten wirkt sie, als sei sie ein junges Mädchen. Dies schadet natürlich ihrer Autorität. Sie versucht, ihren ersten Eindruck mit grauen, tristen Kostümen zu kompensieren, und bindet ihre Haare hinter dem Kopf so straff zusammen, dass ihr Lächeln oft etwas gequält wirkt. Gut, das hat vielleicht auch andere Gründe. Was weiß ich denn schon. Möglicherweise hat sie von Grund auf ein sauertöpfisches Wesen.
Heute wirkt sie allerdings ernsthaft verstimmt. Mal wieder.
»Wer war das?«, fragt sie scharf in die Runde und mustert ihre Bewohner – nein, man nennt uns nicht Insassen – mit stechendem Blick.
Das ist doch mal eine interessante Frage.
Wer war was?
Und wenn ja, wie viele?
Und warum?
»Das ist wirklich kein Spaß mehr. Ihr wisst, ich verstehe sehr viel Spaß.«
Ein Raunen geht durch den Saal. Von wegen!
»Doch, das wisst ihr. Aber jetzt hat schon wieder jemand überall im Haus unseren Namen verschandelt.«
Ach das!
Ach du meine Güte.
Ich muss gähnen. Nach dem Mittagessen pflege ich mich meist ein wenig hinzulegen. So was lernt man hier. Aber das Intermezzo der Rottenmeier kann jetzt wohl länger dauern.
Es ist nämlich so: Unser Altersheim heißt heimelig. Immer kleingeschrieben und kursiv. Die schräg gestellte Namensfindung ergab sich vor der Eröffnung des Hauses mit einem Wettbewerb. Ich konnte Kim damals nur schwer davon abhalten, eine ihrer schrägen – nicht kursiven – Ideen einzureichen. Jetzt heißt das Haus eben heimelig. Und seit ein paar Wochen macht sich nun jemand einen Spaß daraus, die Silbe »un« vor heimelig zu malen, wo und wann immer er kann.
»Das Wort unheimelig gibt es gar nicht«, ereifert sich die Direktorin nun. »Wo also bitte ist der Sinn bei diesen Sachbeschädigungen? Jawohl: Sachbeschädigungen!«
Ich gähne noch einmal. Diesmal etwas auffälliger. Das wirkt ansteckend. Einige gähnen mit, reißen dabei ihre Münder auf, bis ihnen fast das Gebiss rausfällt.
»Das waren sicher ein paar Kinder. Von uns Erwachsenen macht doch so was keiner«, sagt Tobias mit treuherzigem Blick.
Er meldet sich immer gern zu Wort, auch wenn er nichts zu sagen hat, ganz so, als müsse er sich und uns allen beweisen, dass er noch da ist und lebt. Jetzt sieht er übrigens so aus, als würde er bedauern, dass er nicht selber diese unheimelige Idee hatte.
Auch ich melde mich zu Wort: »Aber unheimelig, das ist schon ein Wort. Doch, doch. Ich glaube, das ist das Gegenteil von heimelig.« Ich lege meine Stirn in Falten, als würde mich diese Frage nun die nächsten sieben Wochen quälen.
Frau Meier wird nervös. Ihre Stimme wird eine Nuance höher, schriller. »Papperlapapp!«, bringt sie uns zum Schweigen. Sehr unhöflich, wie ich zur Kenntnis nehme. »Wir tun doch hier alles, wirklich alles dafür, dass Sie es gemütlich haben und heimelig. Das wissen Sie. Also bitte!«
Jaja.
Rhabarber, Rhabarber.
Großer Sturm im kleinen Wasserglas.
Es dauert volle zehn Minuten, bis Frau Meier all ihre Empörung und Entrüstung losgeworden ist. Auch einige Bewohner zeigen sich schockiert und schütteln den Kopf. Ich ärgere mich auch, aber eigentlich nur darüber, dass man mir kostbare Zeit raubt. Ich bin siebenundsiebzig Jahre alt. Da rinnt nicht mehr viel Sand durch meine Sanduhr. Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie unsere junge Direktorin. Darum mag ich sie auch nicht mehr bei derartigen Ansprachen verschwenden. Natürlich ist es blöde, irgendwelche Namen zu verschandeln und Plakate zu beschmieren. Ich hasse sinnlose Sachbeschädigungen, und die sind ja immer häufiger und überall anzutreffen. Neulich hat einer aus meiner Lieblingsbank unter den schattigen Bäumen richtiggehend Kleinholz gemacht. Aber das hier? Wenn es wirklich einer von uns war, dann steckt vielleicht eine tiefe Unzufriedenheit dahinter, und die Aktion hilft dem Betroffenen, erspart ihm gar eine Altersdepression. Möglicherweise ist es aber einfach nur ein kindisches Vergnügen eines gelangweilten Bewohners. Ich weiß es nicht und will es auch nicht so genau wissen. Ich habe genug andere Interessen, genug andere Möglichkeiten, mich zu beschäftigen, zu zerstreuen, will mich nicht um diese Thematik kümmern. Das Altersheim ist definitiv nicht mein Universum, dafür bin ich noch zu jung, zu aktiv, zu gesund.
Eigentlich sollte ich nicht hier sein.
Das wird mir jeden Tag mehr bewusst.
Aber wo sonst könnte ich hin?
Ich habe kein anderes Zuhause mehr. Und wie sagte doch Rainer Maria Rilke so schön – wenn auch in anderem Zusammenhang?
Wer jetzt kein Haus hat, baut keines mehr …
Als wir dann endlich aufstehen können und ich mich auf meinen Mittagsschlaf freue, sehe ich meine Tochter Trudi durch das Hauptportal schreiten. Einen winzigen Moment lang regt sich in mir der Mutterstolz. Trudi ist schön und schlank, und eben, sie schreitet. Man sieht ihr an, dass sie glücklich und erfolgreich und reich ist. Dafür tut sie auch viel, besucht Yogakurse, geht regelmäßig zur Kosmetikerin, joggt fast täglich ihre Runde, trägt nur Designerkleider. »Erfolg hat drei Buchstaben: t – u – n!« Das ist ihr Lebensmotto. Ich gönne ihr, dass sie mit fünfzig immer noch daran glauben kann, das Leben selbst in der Hand zu haben. Sie wird bestimmt auch noch lernen müssen, dass es nicht so ist. Jedenfalls nicht immer. Und mit zunehmendem Alter immer weniger.
Je näher sie kommt, desto mehr verhärtet sich etwas in mir, schließt sich ein eiserner Vorhang um mein Mutterherz. Trudi hat mich enttäuscht. So richtig. Wie sie mich aus meinem Haus gedrängt hat, das kann ich ihr nur schwer verzeihen.
»Mama, gut dass du noch nicht schläfst!«, ruft sie erleichtert und gibt mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Aber ich möchte jetzt gern schlafen«, erkläre ich ungnädig.
»Ich wollte ja nur kurz nach dir sehen«, sagt sie, schon etwas beleidigt klingend. Dabei argwöhne ich, dass sie oft mit Absicht zu dieser Uhrzeit hier auftaucht, weil sie dann schnell wieder gehen kann.
»Wir können ja einmal ums Haus spazieren«, schlage ich versöhnlich vor.
Wir umrunden die Anlage zweimal. Und schon ist sie wieder weg und geht zurück ins Leben, während ich hier auf dem Abstellgleis zurückbleibe.
Meine Tochter hat mich nur kurz auf den neusten Stand gebracht: Ihr Mann Joshua ist jetzt in seinem in Zug stationierten Konzern noch mehr aufgestiegen, arbeitet noch mehr, verdient noch mehr. Mister Noch-mehr ist Engländer und nicht nur schön, sondern großartig. Bis heute habe ich nicht durchschaut, was er eigentlich genau arbeitet. Etwas mit Chemie und mit Computern. Etwas in Englisch. Und Trudi unterrichtet Englisch am Gymnasium. Neuerdings kann sie auch in Joshuas Konzern Privatlektionen in Englisch und in Deutsch geben, je nachdem, was gefragt ist. Und dabei verdient sie unglaublich viel Geld. Ich zeige mich begeistert, wie man das von einer Mutter erwartet.
Noch mehr Erfolg, noch mehr Geld, noch mehr Glück.
Friede, Freude, Eierkuchen.
Bin ich wirklich auch schon eine verbitterte Alte geworden, die sich nicht mehr mitfreuen kann, wenn die Jugend Erfolg hat? Hoffentlich nicht.
Das Heimleben verändert.
Es ist ein schleichender Prozess.
Das macht mir Angst.