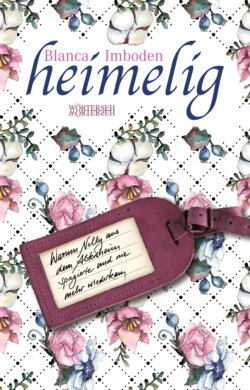Читать книгу heimelig - Blanca Imboden - Страница 15
6 Reise-Wunschkonzert
ОглавлениеNormalerweise sitze ich beim Frühstück um halb acht allein am Tisch. Die anderen schlafen länger. Verständlich. Für die meisten hier hat der Tag sowieso viel zu viele Stunden. Wieso sollten sie ihn also unnötig früh beginnen?
Ich kann nicht anders. Ich bin eine unverbesserliche Frühaufsteherin. Meine innere Uhr weckt mich kurz vor sieben. Außerdem sitze ich am Morgen ganz gern allein am Tisch, schweige vor mich hin und kaue gedankenverloren mein Brötchen. Manchmal lege ich mich dann nach dem Frühstück noch ein wenig aufs Sofa.
Doch heute bleibe ich nicht lange für mich. Alle trudeln früher ein: Tobias, Marlies und Paul. Ich lächle in mich hinein. Die Neugierde hat sie aus dem Bett getrieben.
»Wie wars?«
»Wie geht es dir?«
»Wann bist du heimgekommen?«
»Wirst du wieder verreisen?«
Sie löchern mich mit Fragen.
Und ich erzähle. Ausführlich.
Es tut mir gut, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Meine Tischkameraden hängen an meinen Lippen, speziell an der Stelle der Geschichte, an der ich meinen unerwarteten »Bankrott« feststelle. Da mache ich gekonnt eine kleine Kunstpause und hole mir eine neue Tasse Kaffee, ganz ohne jede Eile. Das nennt man Dramaturgie. Cliffhanger. Spannungsaufbau. So etwas weiß ich.
»Und dann?«
»Machs nicht so spannend!«
»Erzähl weiter!«
»Hast du nichts gegessen?«
Die Fragen prasseln wieder auf mich ein. Und so berichte ich auch noch von Matteo, vom Risotto und dem ganzen schönen Mittag in Ascona. Auch die Ente lasse ich nicht aus.
»Schön«, kommentiert Tobias.
»Gut gemacht«, meint Paul wohlwollend.
»Na ja«, kommt jetzt natürlich Marlies daher. »Sich von einem fremden Mann einladen zu lassen … So etwas käme mir nie in den Sinn.«
Das glaube ich ihr.
»Bei uns gab es gestern Tomaten-Spaghetti«, lenkt Tobias ab.
»Ach ja. Stimmt«, bestätigt Paul und sieht dabei etwas verärgert aus. »Das ist einfach kein Essen für Senioren«, schimpft er.
Ich wüsste jetzt nicht, warum es Altersbeschränkungen für Spaghetti geben sollte.
Auf meinen fragenden Blick fährt Paul fort: »Ich habe mir eine kostbare Seidenkrawatte verdorben.«
»Oh!« Ich verkneife mir ein Lächeln.
»Spaghetti kann man einfach nicht ordentlich essen!«, betont Paul noch einmal. »Du hättest Esther sehen sollen« – Esther ist leicht dement und sitzt im Rollstuhl –, »als sie fertig gegessen hatte, war sie mit Spaghetti behängt wie ein italienischer Christbaum.«
Hängen an italienischen Christbäumen Spaghetti?
Eine lustige Vorstellung.
Wenn es nach Paul ginge, müsste man also auf die Spaghetti-Packungen einen Warnhinweis drucken: »Nicht für Kleinkinder und Senioren geeignet!« Oder: »Kleinkindern und Senioren nur püriert servieren!« Noch besser: »Nur ohne Krawatte einnehmen.«
Manchmal – ich gebs zu – amüsiere ich mich ganz gut mit meinen eigenen Gedankengängen. Ja, ich werde langsam komisch. Immer öfter ertappe ich mich bei Selbstgesprächen. Das mag ja gehen, solange ich allein bin. Aber ich habs nicht mehr wirklich unter Kontrolle und plappere an den unmöglichsten Orten vor mich hin, zum Beispiel im Wartezimmer beim Zahnarzt. Neulich las ich allerdings in irgendeiner Zeitschrift, die ich eben beim Warten irgendwo durchblätterte, einen Spruch, der mich wieder mit meiner neuen Eigenart versöhnte: »Kein Wunder, dass ich Selbstgespräche führe. Ab und zu brauche ich einfach einen intelligenten Gesprächspartner.«
Ha! So kann man es auch sehen.
»Was ist dein nächstes Ziel?«, will Tobias jetzt wissen. »Baden, oder gar Baden-Baden?«
»Bern würde mich reizen«, sage ich spontan. »Gut erreichbar, schöne Altstadt.«
Meine Tischkameraden sind nicht begeistert.
»Brissago, das wäre wunderschön. Es liegt auch im Tessin. Da gibt es eine herrliche kleine Insel«, schlägt Marlies vor.
»Dann könntest du mir einen Brissago-Stumpen mitbringen«, lacht Paul.
»Nein«, wehrt sich Marlies. »Dort fährt man hin, weil man die Insel besucht, den botanischen Garten des Kantons. Sehr sehenswert.«
»Brissago ist mit hundertsiebenundneunzig Metern über Meer der tiefste Punkt der Schweiz«, steuert jetzt auch Tobias sein Wissen bei.
Ich erkläre entschieden: »Nein danke, Tessin, das hatte ich doch gerade.«
Tobias bringt leise einen neuen Vorschlag: »Du könntest für mich nach Buochs fahren.«
Buochs?
Gar nicht so weit weg. Warum nicht?
Ich mustere Tobias, und mir fällt auf, dass er noch schlechter aussieht als sonst. Die Haut spannt über seinen Wangenknochen, die Augen wirken eingefallen.
»Buochs. Gut. Abgemacht!«, sage ich spontan.
Tobias lächelt mir zu, und ich weiß, es steckt bestimmt noch irgendeine Geschichte hinter seinem Vorschlag. Aber ich kann warten.
Nach dem Frühstück nimmt Paul seinen Stock und geht auf seinen täglichen Spaziergang. Marlies schleicht an ihrem Rollator zum Lift, weil sie sich irgendeine Serie im Fernsehen anschauen will.
»Warum soll ich also nach Buochs fahren?«, will ich jetzt, wo wir ganz unter uns sind, von Tobias wissen.
Er rückt seinen Stuhl näher zu mir ran und beginnt zu erzählen.
»Ich war ein schlechter Vater. Ein ganz schlechter.«
»Was? Bist du sicher? Wir haben doch alle Fehler gemacht mit unseren Kindern. Das ist normal. Eltern, die sich später keine Vorwürfe machen, gibt es wohl gar nicht. Und Kinder, die ihren Eltern keine Vorwürfe machen, leider genauso wenig.«
»Das stimmt. Aber ich war richtig schlimm.«
»Oh, aber du hast nicht …«
»… nein, keine Gewalt oder so. Ich bitte dich!«
Ich bin erleichtert.
»Meine Frau ist früh gestorben, und dann habe ich mich einfach von allen und allem abgekapselt und meine Trauer ausgelebt, mich am Ende nur noch selbst bemitleidet. Sogar gesoffen hab ich. Meine Tochter Käthi habe ich alleingelassen, in einer Zeit, in der sie mich dringend gebraucht hätte. Dabei war Käthi bezaubernd. Sie glich immer mehr ihrer Mutter, meiner geliebten Katharina. Ihre Gesten, ihr Lachen, ihre Bewegungen. Ich hielt es genau deshalb kaum mehr aus mit ihr. Und das habe ich sie spüren lassen. Ich war kalt und ungerecht.«
Tobias’ Stimme zittert, wie seine Hände es immer tun.
»Es geht mir schlechter. Ich machs wirklich nicht mehr lange. Das ist okay. Ich muss nicht ewig leben. Ich bin bereit. Ich würde nur gern noch einmal mit meiner Tochter sprechen. Aber sie kommt natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich sie zum letzten Mal gesehen habe.«
»Warum schreibst du ihr nicht? Warum rufst du sie nicht an?«
»Ich kann nicht mehr schreiben, und ein Anruf nach all dieser Zeit scheint mir einfach unangemessen. Sie lebt in Buochs.«
Ach, jetzt verstehe ich langsam, in welche Richtung das hier läuft.
»Du willst, dass ich vermittle?«
»Ja! Du schaffst das. Ich kann das Haus nicht verlassen, weil ich viel zu schwach bin. Bitte Käthi um einen letzten Besuch bei mir. Ich möchte ihr sagen, dass ich heute alle meine Fehler klar erkenne und es mir leidtut.«
Ich nicke und nehme Tobias’ Hände in meine.
»Ich versuche es gern.«
Wir haben beide Tränen in den Augen.
»Der Arzt gibt mir nicht mehr lange«, flüstert er.
»Das hat er doch schon oft gesagt«, beruhige ich ihn.
»Ja, aber jetzt fühlt es sich an, als hätte er recht.«
Er gibt mir einige Informationen zu seiner Tochter. Sie habe das Hotel Schiff geführt, direkt beim Steg. Dort solle ich zuerst nach Käthi fragen. Aber ob sie noch dort arbeite? Sie sei inzwischen ja auch schon siebzig.
»Siebzig? Dann hast du vielleicht schon Enkel und Urenkel, die du noch nicht kennst?«
Er nickt. Tobias ist unser ältester Bewohner: Neunundneunzig Jahre hat er auf dem Buckel. Alle freuen sich schon auf die Party, wenn er hundert wird. »Ich steige dann aus dem Fenster und verschwinde«, droht er immer, wenn die Rede darauf kommt, in Anlehnung an den weltbekannten Roman von Jonas Jonasson, den wir beide gelesen haben.
Ich mag Tobias sehr. Er hat einen extrem wachen Geist, Witz und Gefühl. Mit viel Anstrengung und einer speziellen Lupe liest er jeden Tag die Zeitung und berichtet uns dann das Wesentliche, sodass ich keine eigene Zeitung mehr brauche. Mit ihm kann man diskutieren, er hinterfragt alles und anscheinend auch sich selber. Ich hoffe, er bleibt noch lange unter uns. Wer weiß … wenn Käthi wieder da wäre, hätte er vielleicht wieder mehr Lebensmut? Seinen Kampfgeist hat er ja längst bewiesen.
Die Reise nach Buochs wird ein Klacks: Mit dem Bus nach Gersau, mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee nach Buochs. Da brauche ich nicht einmal die Hilfe von Kim. Vielleicht dann wieder beim Buchstaben C.
Aber zwei, drei Tage Ruhepause gönne ich mir trotzdem, bevor ich wieder losziehe. Ich muss ja nicht schon in zwei Monaten das ganze Abc durchhaben.
Auch Kim nimmt regen Anteil an meinen Reiseerlebnissen, als sie mich das nächste Mal besucht. Für Matteo, den jungen Musiker, interessiert sie sich natürlich besonders, und sie findet schnell seinen Blog, der MatteoMusicista heißt.
»Ein hübscher Kerl«, meint sie anerkennend. »Aber doch eher in meiner Liga als in deiner.«
Wir lachen.
Matteo hat unsere Begegnung – mit Foto – schon publiziert.
»Schau mal, wie viele Leute das schon kommentiert haben! Sie mögen dich! Ich habe immer gesagt, dass du einen Altersheim-Blog schreiben solltest. Stell dir vor, wie nett hier alle zu dir wären, wenn du die ersten tausend Follower hättest. Plötzlich hätte man Angst vor deinen Einträgen und würde sich um dich bemühen.«
Ich erzähle ihr, wie Frau Meier mir die Reise madigmachen wollte. »Sie meinte wirklich, ich bräuchte dazu von irgendjemandem eine Erlaubnis«, berichte ich empört.
»Eine unheimelige Person«, findet Kim.
»Unheimelig – komisches Wort. Denkst du, das gibt es wirklich?«
Über so eine Frage kann Kim nur lachen. »Die Sprache ist im Wandel. Lass uns einfach jeden Tag einmal das Wort in Umlauf bringen, und plötzlich steht es im Duden. In den letzten Jahren kamen so schon Wörter wie liken, googeln oder durchzappen dazu.«
Kim zückt ihr Handy und posaunt dann heraus: »Unheimelig steht längst im Duden! Wird mit unheimlich gleichgesetzt. Sei vor allem im achtzehnten/neunzehnten Jahrhundert verwendet worden und gilt wohl als besonders schweizerisch.«
»Ach was!?«, rufe ich erstaunt aus.
»Genau so könntest du deinen Blog nennen: Unheimelig«, spinnt Kim ihren Faden weiter.
Als ich versuche, mehr über das Wort heimelig im Computer zu finden, ärgere ich mich einmal mehr, dass das W-LAN tot ist. Toter als tot. Kein Netz. Gar keines. Das Schlimme dabei ist, wie ich es schon Melanie bei ihrer Befragung für die Maturaarbeit erzählt habe: Ich bin die Einzige in diesem Heim mit immerhin fast hundert Bewohnern, die sich darüber ärgert. Darum dauert es auch immer so lange, bis es wieder läuft, vor allem, wenn ich mich nicht höchstpersönlich bei der Rottenmeier darüber beschwere. Darum bin ich sicher nicht ihre Lieblingsbewohnerin. Zu oft stehe ich mit einer Beschwerde in ihrem Büro.
»Das ist eine Zumutung«, schimpft Kim. »Wenn dann mal unsere Generation hier wohnt, gibt es garantiert einen heftigen Aufstand, wenn wir kein schnelles, zuverlässiges Netz haben – und zwar rund um die Uhr!«
Das bezweifle ich keinen Moment. Und da Kim Informatikerin ist, würde sie notfalls auch selber Hand anlegen. Doch im heimelig will sie sich nicht wirklich einmischen. Das ist bestimmt besser so.
Als sie sich verabschiedet, verspricht sie mir aber, die Netzstörung ganz und gar höflich und anständig im Büro zu melden.
Kim im Altersheim? Das kann und will ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und doch: Wir alle werden alt und älter – außer wir sterben vorher. Aber daran möchte ich auch nicht denken.