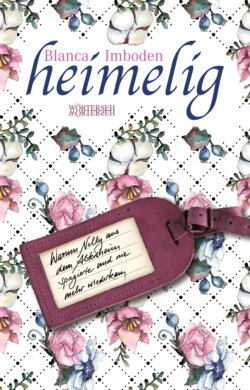Читать книгу heimelig - Blanca Imboden - Страница 11
2 Heimatlos
ОглавлениеIch war nicht immer heimatlos. Vor nicht allzu langer Zeit wohnte ich in einem schönen, großen Haus, umgeben von einem gepflegten Rasen, im Schatten stämmiger Birken. Flieder blühte an der Hausfassade. Lavendel entlang der Einfahrt. Ich hatte ein richtiges Zuhause. Aber nach Xavers Tod setzte mich meine Tochter arg unter Druck: »Das Haus ist zu groß für dich allein. Du brauchst unbedingt einen Neuanfang.«
Dabei wollte vor allem sie einen Neuanfang. Mit ihrem Ehemann Joshua und ihrer liebenswerten Tochter Kim. In meinem Haus.
Ja, ich habe um Xaver getrauert und oft geweint, was ja normal ist, wenn man über fünfzig Jahre verheiratet war und sich geliebt hat. Und schon hieß es wieder: »Siehst du: Das Haus tut dir nicht gut!« War ich mal müde, musste ich mir anhören: »Das Haus macht zu viel Arbeit. Du solltest dich schonen.« Als ich nicht schnell genug wieder fröhlich und gesellig sein konnte, wurde mir erklärt: »Dieses Haus erdrückt dich mit all seinen Erinnerungen.«
Dabei tat das Haus mir gut. Die Erinnerungen waren schließlich alles, was ich noch hatte. Ich badete darin, wenn mir die Realität zu kalt und unwirtlich vorkam. Was wären wir denn ohne unsere Erinnerungen? Die schönen Gedanken an vergangene Zeiten sind doch wie eine warme, kuschelige Höhle, in die man sich ab und zu verkriechen kann. Ich hatte in meinem Haus ja auch meist gute Zeiten verbracht. Und es beschäftigte mich, hielt mich auf Trab. Immer gab es etwas zu tun, im Haus und ums Haus herum.
Trudi und Joshua haben das schöne Haus abreißen und eine garagenähnliche Betonvilla auf das Grundstück bauen lassen. Ein angesehener Architekt übernahm für den Gräuel die Verantwortung. Wo früher mein Garten war, sind jetzt Parkplätze. Die Birken mussten einer Garage weichen. Sicher, Trudi und Joshua hatten mir angeboten, eine Einliegerwohnung für mich einzuplanen. Aber da hatte ich doch auch meinen Stolz. Aus meinem schönen Haus ausziehen und dann in ein fremdes wieder einziehen? Nein, da ging ich lieber freiwillig ins Altersheim.
Trudi und Joshua kauften mir das Haus ab und bezahlten mich fürstlich. Das konnten sie gut, nicht nur weil sie reich sind, sondern weil sie ja mein Geld am Ende wieder erben werden. Falls dann noch was übrig bleibt. Denn eines habe ich mir geschworen: Mit dem Sparen ist es jetzt vorbei. Ich lasse es mir gut gehen.
Und da bin ich jetzt. Mit viel Geld und wenig Heim.
Ich liege in dem Bett, das noch immer nicht richtig meins ist, und der Schlaf will nicht kommen. Dabei ist schlafen so eine Gnade: einfach alle Gedanken ausschalten, ja, sich selber ausschalten. Fast ein bisschen wie sterben. Nur halt anders, nicht so endgültig. Ich starre an die weiße Zimmerdecke, bis ich das Gefühl habe, sie falle auf mich nieder.
Dann, gerade als es mir ansatzweise gelingt, mich zu entspannen, klopft jemand energisch an meine Zimmertür, und bevor ich mir überlegen kann, ob ich überhaupt jemanden sehen möchte, steht die resolute Schwester Yvonne mitten im Zimmer. Im Schlepptau hat sie eine junge Frau, eigentlich eher noch ein Mädchen, das sich neugierig umschaut.
»Hallo, liebe Frau Niederberger, das ist Melanie Zurkirchen. Ihr seid ja verabredet«, erklärt Schwester Yvonne voller Überzeugung, schiebt das Mädchen vor mein Bett und ist schon wieder weg, bevor ich protestieren kann.
Melanie steht da, schaut sich neugierig um, und ich kann nichts dagegen tun. Ein schmales, blasses, ausgehungert wirkendes Mädchen mit einem Laptop unter dem Arm. Ein kleiner Windstoß würde genügen, um das Kind aus meinem Zimmer zu pusten. Aber da ist kein Wind. Nicht einmal ein laues Windchen.
»Guten Tag, Frau Niederberger«, bringt Melanie über die gepiercten Lippen, und ihre großen Augen mustern mich ungeniert. Ich bin wirklich tolerant und offen und alles. Aber wie kann man sich Ringe durch die Lippen stechen lassen? Und was sind das für Eltern, die so etwas zulassen?
Ich bin alt.
Ich muss das nicht mehr verstehen.
»Geht es Ihnen nicht gut? Soll ich an einem anderen Tag vorbeikommen?«, schreit mich das Mädchen jetzt an.
Einen kleinen Moment lang komme ich in Versuchung, die Sterbende zu mimen, reiße mich dann aber zusammen.
»Mir geht es gut. Ich bin das blühende Leben. Sie haben mich nur bei meinem Mittagsschlaf gestört«, raunze ich unfreundlich. Immerhin ergänze ich nicht, dass sie meinetwegen gar nicht mehr wiederkommen müsste, an welchem Tag auch immer.
Melanie schreit weiter auf mich ein: »Aber wir sind verabredet. Haben Sie das vergessen? Sie wollten mir doch für meine Maturaarbeit einige Fragen beantworten. Ich mache eine Studie über das Leben im Altersheim.«
Während ich erkläre, dass mein Gehör noch funktioniert, jedenfalls noch funktioniert hat, bevor sie mich so angeschrien hat, zermartere ich mein Hirn. Ich strenge mich an. Aber da ist nicht der geringste Fetzen von Erinnerung an so eine Abmachung. Melanie Zurkirchen? Das Mädchen habe ich noch nie gesehen, seinen Namen noch nie gehört. Ich bin mir total sicher. Absolut.
Aber ich bin alt.
Was, wenn ich die Abmachung einfach nur vergessen habe?
»Na gut.«
Ich seufze tief und rapple mich hoch, ganz langsam. In meinem Alter hüpft man nicht mehr aus dem Bett wie ein Reh. Man sortiert zuerst vorsichtig seine Knochen, macht eine kurze Bestandsaufnahme, setzt sich dann erst vorsichtig in Bewegung, wenn man weiß, wo es heute zwickt oder schmerzt. Und irgendwo zwickt und schmerzt es fast immer, wenn man das eigene Verfallsdatum langsam erreicht hat.
Melanie und ich setzen uns an den kleinen Tisch, der noch aus meinem alten Haushalt stammt. Gewachste Eiche. Gewachste Erinnerungen.
Mit einer geschickten, fließenden Bewegung knotet das junge Mädchen ihre langen Haare hinter dem Kopf zusammen, klappt den Laptop auf und tippt geschäftig auf der Tastatur herum. Dabei knabbert es an seiner Unterlippe. Ich beobachte Melanie argwöhnisch wie ein exotisches Insekt.
Nein, ich kenne sie nicht.
Wenn sie jetzt nach meinem Bankkonto fragt, rufe ich die Polizei!
Ich bin zwar alt, aber nicht doof.
»Können wir anfangen?«, will Melanie jetzt wissen, und ihre großen Augen richten sich auf mich. Ich nicke nur.
»Sind Sie gern hier? Auf einer Skala von eins – was negativ ist – bis zehn – der Bestnote.«
»Eins«, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Wahrscheinlich habe ich das noch nie so ehrlich jemandem eingestanden. Melanies Augen werden noch größer.
»Was vermissen Sie am meisten?«
»Meinen Mann, mein Haus, meine Küche, mein früheres Leben, meine …«
»Nicht so schnell!«, interveniert das Mädchen. Dabei haut sie rasend schnell in die Tasten.
»Meinen Garten, die Birken, meine Sachen, die vielen Zimmer, die Ruhe, die Selbstbestimmung, meine Freundin Lisa …«
Na ja, ich plappere wie ein Wasserfall. Mir fallen da endlos Dinge ein, die ich vermisse.
»Halt! Stopp! Es tut mir leid, mehr Platz habe ich nicht in meinem Formular. Ich dachte nicht, dass jemand so viel vermissen könnte.« Das ist ihr jetzt sichtlich unangenehm. Unschlüssig kaut sie auf ihrer Unterlippe herum und spielt mit ihren Piercings.
»Schon gut«, winke ich ab. So wichtig ist mir diese Umfrage nun auch wieder nicht.
»Wie alt sind Sie?«
»Auf einer Skala von eins bis zehn?«, frage ich zurück, und das Mädchen schaut überrascht auf. Dann lacht sie und sagt anerkennend, ich hätte wohl Humor.
»Siebenundsiebzig«, antworte ich und ringe mich zu einem Lächeln durch.
»Sind Sie krank – auf einer Skala von eins bis zehn –, wobei zehn extrem krank ist?«
»Zwei«, antworte ich. »Ich bin nur alt, ansonsten gesund.«
Jetzt schaut Melanie mich an wie ein exotisches Insekt.
»Warum sind Sie dann hier? Freiwillig?«, fragt sie, und ich nehme an, das ist keine Frage aus ihrem Katalog.
»Lange Geschichte«, gebe ich zurück. Und eine traurige Geschichte, denke ich für mich.
Melanie schweigt einen Moment und sagt dann: »Sie sind bisher die gesündeste der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, und gleichzeitig die, die am wenigsten gern hier ist.« Sie scheint über etwas nachzudenken und meint dann: »Das ist spannend.«
Ach?
Gern geschehen.
Es ist mir eine Ehre, Melanies jugendlichem Leben etwas Spannung einzuhauchen.
»Fühlen Sie sich einsam, auf einer Skala von eins …«
»Jaja. Schon gut. Ich habe das System verstanden. Sieben.«
Ich nenne willkürlich irgendeine Zahl. Vielleicht wäre es in Tat und Wahrheit eine Zweiundzwanzig? Aber ich will ja nicht schon wieder Melanies selbst gebasteltes Formular sprengen. Und was heißt einsam? Natürlich habe ich hier Gesellschaft, manchmal mehr, als mir lieb ist. Natürlich bin ich nicht allein. Einsamkeit ist nicht der Mangel an Menschen, sondern das Fehlen des einen Menschen, dem man blind vertrauen kann, der einen wortlos versteht, dessen Nähe auch das Herz berührt. Es ist das Fehlen von Xaver. Das Fehlen von Lisa. Ob dieses junge Mädchen das auch nur ansatzweise verstehen könnte? Wusste ich in ihrem Alter, was Einsamkeit ist? Hätte es mich interessiert? Nein.
»An welchen Unterhaltungsangeboten nehmen Sie gern teil?«, lautet Melanies nächste Frage.
Ach Gott! Anfangs ging ich zum Singen, zum Spieltreff, zum Altersturnen. Ich habe in der Gruppe gebacken und gekocht. Nichts davon hat mir wirklich Spaß gemacht.
»Ich gehe zum Gottesdienst – manchmal. Ich besuche den Friseur und die Bibliothek – regelmäßig. Wenn der Therapiehund Chilly vorbeikommt, bin ich gern dabei. Und ich falte Putzlappen zusammen – leidenschaftlich.«
Jetzt fallen Melanie ihre riesigen Augen fast aus dem Kopf. Nur langsam und beinahe ein wenig widerwillig tippt sie meine Antworten ins Formular. Sie hat Bedenken.
»Ich frage mich, ob man den Gottesdienst als Unterhaltungsangebot betrachten kann. Und den Friseur.« Ihr Blick wirkt nun wie ein großes Fragezeichen.
»Aber das Putzlappen-Zusammenfalten, das irritiert Sie nicht?«, frage ich leicht eingeschnappt zurück. »Das hat nämlich mich sehr irritiert, als es erstmals auf dem Tagesprogramm stand. Darum bin ich hingegangen.«
Und – unglaublich, aber wahr – ich nehme immer an diesem Angebot teil, wenn es ausgeschrieben ist. Erschreckend, dass ich so etwas freiwillig tue und als Tagesbereicherung empfinde. So weit ist es mit mir gekommen. Wir sitzen jeweils alle an einem großen Tisch. Die Wäscherei liefert Berge von Putzlappen in den verschiedensten Farben, und wir sortieren und falten sie zusammen. Dazu hören wir Radio oder unterhalten uns. Das ist immerhin ansatzweise eine sinnvolle Beschäftigung. Und ich hatte die besten, persönlichsten Gespräche dabei. Als würde uns diese gemeinsame, monotone Tätigkeit verbinden und einander näherbringen. Das alles sage ich Melanie aber nicht. Sie will es wohl auch nicht wissen.
»Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen«, verkündet sie und beruhigt mich prophylaktisch: »Ich habe große Felder für deren Beantwortung vorgesehen.«
»Na, da bin ich aber gespannt«, gebe ich zurück. »Mal sehen, ob ich die Felder mit meinen Antworten nicht doch sprengen kann.«
»Versuchen Sie es!«, fordert sie mich heraus und fragt dann: »Was würden Sie hier ändern, wenn Sie könnten? Was müsste geändert werden, damit Sie sich hier wohler fühlen könnten? Wie könnte man das Heimleben verbessern?«
Oh.
Ein Heim ist ein Heim. Es ist kein Zuhause, und es wird auch nie eines werden, wenn man auch noch so sehr versucht, sich das einzureden. Es ist eine Übergangsstation, meist eine Endstation, mit der man sich arrangiert, irgendwie. Manchmal denke ich, dass, wer hier einzieht, schon ein ganz klein wenig gestorben ist, weil er sehr viel aufgegeben hat. Und so fällt einem das letzte Sterben dann gar nicht mehr so schwer. Sind das böse Gedanken, falsche? Viele Bewohner sind krank und erleichtert, wenn man sie von den alltäglichen Arbeiten eines Haushalts befreit. Sie brauchen Hilfe und bekommen sie. Einige wenige finden hier sogar Anschluss, Gesellschaft, sind hier weniger allein als zuvor.
Aber klar, jetzt sind Vorschläge gefragt.
Kritisieren ist leicht.
Aber wie könnte man alles besser machen?
Ich atme tief durch, und dann bricht es aus mir heraus, so, dass Melanie beim Tippen ganz schön ins Schwitzen kommt, obwohl ich mir echt Mühe gebe, langsam zu sprechen.
»Zuerst einmal sollte die Politik über die Bücher gehen. Es kann einfach nicht sein, dass wir so wenig Personal im Pflegebereich ausbilden und es dann aus dem Ausland holen, wo es auch wieder fehlt. Irgendwann müssen wir uns dieser Problematik stellen, sonst bricht das ganze System zusammen. Hier sind alle ständig gestresst und überfordert. Natürlich auch, weil die finanziellen Mittel für mehr Personal fehlen. Und im Kleinen: Wir haben hier im heimelig keine gute Küche. Dabei bleiben uns Alten wirklich nicht mehr viele Freuden – die Mahlzeiten sollten eine sein. Unbedingt. Vielleicht ist der Küchenchef ja sogar gut, doch sein Budget zu klein. Ich weiß es nicht. Weiter ist das W-LAN-Netz, das uns Bewohnern zur Verfügung steht, eine Katastrophe. Und leider bin ich wohl die Einzige, die es überhaupt nutzt, daher kämpfe ich auch allein um ein besseres. Dann – das muss auch mal gesagt sein – diese kleinen Konzerte ständig: Die machen sich ja gut auf dem Veranstaltungskalender, aber bloß weil ich alt bin, freue ich mich nicht grundsätzlich über jeden Musikschüler, der hier öffentlich übt. Mein Gehör funktioniert nämlich noch einwandfrei, und selbst wenn ich schlecht hören würde, wäre mein Musikgehör immer noch intakt. Und wenn die Schüler der Sonderschule an Weihnachten hier Weihnachtslieder singen, dann ist das vielleicht etwas Besonderes – aber nur für die Sonderschüler. Übrigens liebt auch nicht jeder über sechzig automatisch Ländlermusik und Blaskapellen. Es gäbe doch Alternativen: Warum nicht mal eine Podiumsdiskussion über unser Heimleben oder das Alter an sich aufs Programm setzen? Eine Lesung? Einen Filmabend mit einem Film, der nicht schon fünfzig Jahre alt ist, und anschließend eine Diskussion darüber? Anfänglich war auch mal eine interne Heimzeitung geplant. Wurde wahrscheinlich weggespart. Die Idee gefiel mir …«
»… Okay! Okay! Sie haben es geschafft. Ich habe keinen Platz mehr.«
Gut, ich hätte noch eine Weile weitermachen können, aber es reicht ja wohl.
»Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage.«
Es scheint, als wäre Melanie genauso froh wie ich, dass das Verhör nun bald beendet ist.
»Wie waren Sie und wo, als Sie so alt waren wie ich? Ich bin achtzehn.«
Ach du meine Güte!
Das ist wirklich schon eine Weile her.
Ich habe ein einziges Foto von damals. Ich stehe auf, krame es umständlich aus einer Schublade und halte es Melanie hin. Ich war eine Schönheit. Eine Prinzessin. Wie Sissi, die Kaiserin. Nur habe ich das damals gar nicht realisiert.
Heute sehe ich eher aus wie die Schwester von Ruth Maria Kubitschek, der uns älteren Semestern aus vielen Fernsehfilmen bekannten Schauspielerin, die seit einigen Jahren einen Schweizer Pass hat und am Bodensee lebt. Ich mag sie – also gefalle auch ich mir? Meine Haare sind mal mehr blond, mal mehr grau – je nachdem, ob ich mehr oder weniger Lust auf einen Besuch beim Friseur habe –, immer sind sie nicht ganz kurz, aber auch nicht lang, mittellang also und unspektakulär. Mein Gesicht ist knitterig und zerfurcht, faltig halt, gezeichnet vom Leben, auch vom guten Leben, mit entsprechenden Lachfalten um meine grünen Augen. Immerhin habe ich noch meine gute Figur, und das, obwohl ich mich mein Leben lang nicht um Sport kümmerte und gegessen habe, was mir schmeckte. Dafür bin ich dankbar.
Aber ich soll ja an früher denken, Melanie wartet, ein bisschen ungeduldig, wie mir scheint, auf meine Antwort.
»Mit achtzehn war ich unerfahren, naiv, schüchtern, arm«, beginne ich also. »Meine Eltern hatten einen Bauernhof in Engelberg. Ich musste arbeiten und habe in Hotels Zimmer geputzt. Ich hatte wenig. Wir hatten wenig. War ich glücklich? Nicht besonders, aber ich habe mich das wohl auch nicht speziell gefragt. Gern hätte ich etwas mit Büchern gearbeitet, eventuell sogar studiert. Das stand aber nie zur Diskussion. Es war einfach, wie es war.«
Melanie klappt den Laptop zu.
»Danke!«, sagt sie und wirkt ein klein wenig erschöpft.
War ich anstrengend?
Meine Tochter Trudi behauptet oft, ich sei anstrengend.
Gerade als ich fragen will, wie denn diese Maturaarbeit eigentlich genau aussehen werde, klopft es wieder an meine Zimmertür, und Schwester Yvonne stürmt herein.
»Das war das falsche Zimmer! Sie waren mit Frau Marty von nebenan verabredet«, erklärt sie Melanie etwas atemlos. »Die arme Frau hat im ganzen Haus nach Ihnen gesucht.«
Dann schaut sie mich vorwurfsvoll an: »Warum haben Sie denn nichts gesagt, Frau Niederberger? Sie mussten doch wissen, dass Sie gar nicht verabredet waren, oder?«
Verständnislos zucke ich mit den Schultern.
Ich bin platt.
Mein Kopf ist also noch klar.
Melanie wollte gar nicht zu mir.
Ha!
Ich freue mich, auf einer Skala von eins bis zehn etwa bei der Neun. Und dass mein Mittagsschlaf ausfallen musste, trage ich mit Fassung.
Man ist ja in meinem Alter so leicht zu verunsichern. Kein Wunder haben Enkeltrickbetrüger und andere Kriminelle so ein leichtes Spiel mit Senioren.
Aber das wird mir eine Lehre sein.
Mein Kopf ist klar. Glasklar. Ich werde nie mehr daran zweifeln.
Ich verabschiede mich von Melanie, und als ich höre, wie sie im Zimmer nebenan auf Frau Marty einschreit und diese in derselben Lautstärke antwortet, lächle ich in mich hinein. Die ist nämlich wirklich schwerhörig, was unsere Nachbarschaft manchmal etwas belastet.
Ich schalte den Fernseher ein und falle bei einer Kochsendung schnell in einen leichten Schlummer. Kochsendungen wirken auf mich immer einschläfernd. Schade, dass sie meist nur tagsüber gezeigt werden.