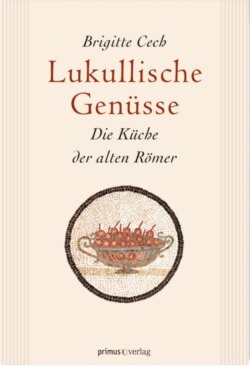Читать книгу Lukullische Genüsse - Brigitte Cech - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Speiseräume
ОглавлениеIn den Häusern der städtischen Oberschicht ebenso wie in den Luxusvillen auf dem Land und in großen Gutshöfen gab es einen, manchmal auch mehrere Speiseräume. Sie dienten der Repräsentation und waren dementsprechend luxuriös mit Fresken und Mosaiken ausgestattet. Das Mobiliar des Esszimmers (triclinium) bestand im Wesentlichen aus drei Speisesofas (lectus triclinaris), die heute als Klinen bezeichnet werden. Die Speisesofas, auf denen Matratzen, Kissen und Decken lagen, waren hufeisenförmig um einen Tisch angeordnet. Jedes Sofa bot Platz für bis zu drei Personen. In einigen der größeren Villen in Pompeii und Herculaneum gibt es zusätzlich zum Esszimmer im Haus auch einen Speiseraum im Freien, das sogenannte Sommertriklinium, mit gemauerten Klinen. Ein sehr schönes Beispiel für ein Sommertriklinium kann in Herculaneum im Haus des Neptun und der Amphitrite bewundert werden. Es erweckt den Eindruck eines intimen, luxuriös und liebevoll gestalteten Speiseraumes, in dem man gerne in guter Gesellschaft einen gemütlichen Nachmittag und Abend bei Speis und Trank verbringen möchte. Besonders begüterte Herrschaften, die auch über einen großen Fischteich verfügten, statteten diesen gerne mit einer in den Teich hineinragenden Plattform aus, die ebenfalls zum Speisen genutzt wurde.
In den Häusern der einfachen Leute wurde der Hauptraum auch als Esszimmer genutzt. In derartig beengten Verhältnissen war kaum Platz für Speisesofas, und die Mahlzeiten wurden auf Sesseln oder Bänken um den Tisch sitzend eingenommen.
Außer Speisesofas gehörten auch Tische zum Abstellen der Speisen zum Mobiliar eines Esszimmers. Meist handelt es sich dabei um dreibeinige Tische mit runder Platte. Diese Tische bestanden aus Holz, aber auch aus Bronze, wobei Tische aus Metall auch in der Form von Klapptischen nachgewiesen sind. Des Weiteren gab es einbeinige Tische aus Stein. Material und Verzierung der Tische hing, wie so vieles, von den finanziellen Möglichkeiten des Hausherrn ab. Ebenfalls zur Ausstattung der Speiseräume gehörte geschmackvolles Geschirr. Wer etwas auf sich hielt und natürlich über die finanziellen Mittel verfügte, servierte den Gästen Speis und Trank in Schüsseln, Schalen, Näpfen, Tellern, Krügen, Kannen und Bechern aus Bronze, Silber oder Glas. Schönes Geschirr aus feiner Keramik, wie es im archäologischen Fundgut römischer Siedlungen und Militärlager gang und gäbe ist, konnten sich auch Bürger mit etwas bescheidenerem Geldbeutel leisten. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang Gefäße aus Terra sigillata, wörtlich „gestempelte Erde“, ein Begriff aus der Archäologie, der auf die in die Böden der Gefäße eingepressten Töpfermarken zurückgeht. Die antike Bezeichnung für dieses rote, mit feiner glänzender Engobe überzogene Geschirr, das meist mit Reliefverzierungen geschmückt ist, ist nicht überliefert. Terra sigillata wurde in der Nähe geeigneter Tonlagerstätten in Oberitalien, Frankreich, im Rheinland, im Saarland und in Bayern in großen Töpfereibetrieben als Massenware erzeugt und in alle Teile des Römischen Reiches verhandelt.
Mit zahlreichen Mosaiken verzierter Speiseraum: Das Sommertriklinium im Haus des Neptun und der Amphitrite in Herculaneum.
Feines Tafelgeschirr auch für den kleineren Geldbeutel: Terra-Sigillata-Becher aus Rheinzabern.