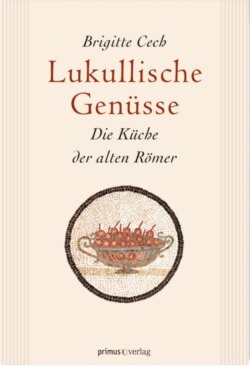Читать книгу Lukullische Genüsse - Brigitte Cech - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Trinkgelage
ОглавлениеAuf das Gastmahl folgte traditionellerweise das Trinkgelage (comissatio), an dem ursprünglich nur Männer und allenfalls leichte Mädchen teilnahmen. Für ehrbare Frauen geziemte sich die Teilnahme am Trinkgelage nicht. Nach den Regeln altväterlicher Sittenstrenge war es Frauen sogar verboten, Wein zu trinken. Plinius führt einige Beispiele für die drakonischen Strafen an, die den Damen drohten, wenn sie sich dennoch über den Weinkeller hermachten:
„Unter den Beispielen finden wir, dass die Frau des Egnatius Maetennus, weil sie Wein aus einem Fass getrunken hatte, mit dem Knüppel von ihrem Mann getötet und dieser von Romulus von dem Morde freigesprochen wurde. Fabius Pictor schrieb in seinen Annalen, dass eine Frau, weil sie das Schränkchen mit dem Schlüssel zum Weinkeller geöffnet hatte, von den Ihrigen gezwungen wurde, Hungers zu sterben.“32
Nicht immer gerne gesehen: Männer und Frauen gemeinsam beim Trinkgelage. Fresko im Haus der keuschen Liebenden in Pompeii.
Der für seine Sittenstrenge berüchtigte Cato der Ältere begründete den Brauch, dass Männer ihre weiblichen Verwandten mit einem Kuss begrüßten, damit, dass die Herren feststellen konnten, ob die Damen eine Weinfahne hätten.33 Ab der ausgehenden Republik lockerten sich die Sitten und es war auch ehrbaren Frauen gestattet, am Trinkgelage teilzunehmen und Wein zu trinken, allerdings in Maßen. Trunkenheit wurde bei Angehörigen des weiblichen Geschlechtes nicht gerne gesehen. „Sie [die Frauen] durchschwärmen nicht weniger die Nächte, […] und nehmen es im Genuss von Wein mit den Männern auf“, wettert Seneca gegen trinkfeste Damen.34
Die Sitten und Gebräuche beim Trinkgelage übernahmen die Römer von den Griechen. Um eine festliche Atmosphäre zu erzeugen, wurden wohlriechende Essenzen gereicht, mit denen sich die Gäste die Haare und die Haut parfümierten. Das Tragen von Kränzen aus Blumen und Laubwerk trug nicht nur zur festlichen Stimmung bei, sondern sollte auch die Auswirkungen allzu intensiven Weinkonsums lindern: „Aus diesem Grunde, meine ich, hat unsere Kultur [gemeint ist die griechische] den Kranz dem Dionysos geweiht, wollte sie doch, dass der Erfinder des Trunks zugleich der Abwender der von ihm verursachten Nachteile sei.“35 Als besonders wirksam galten Efeu, Lorbeer, Myrte, Majoran, Rosen und Veilchen. Wenn sich ein Kranz im Laufe des Gelages auflöste, galt das als untrügliches Zeichen für Verliebtheit.36
Das Weinservice bestand aus einem großen Mischgefäß, in das zunächst das Wasser und anschließend der Wein gegeben wurde. Dabei wurde der Wein durch ein Sieb gegossen, um etwaige Rückstände abzufiltern. Mit einem Schöpflöffel wurde der gewässerte Wein in Krüge abgefüllt und vom Mundschenk ausgeschenkt. Eine weitere wichtige Person beim Trinkgelage war der Trinkkönig (magister oder rex bibendi), der meist durch das Los bestimmt wurde.37 Er moderierte sozusagen den Ablauf des Trinkgelages, und seine Anordnungen mussten widerspruchslos befolgt werden. Er entschied über das Mischungsverhältnis von Wasser und Wein und legte die „Regeln“ für das Trinkgelage fest. Seine Aufgabe war es, das Thema für die Tischgespräche zu bestimmen und ausgesuchte Teilnehmer dazu zu verdonnern, ihre Trinkgenossen mit unterhaltsamen Reden, Gedichten, Rätseln, Witzen oder der Erfüllung gewisser Aufgaben zu unterhalten.38 Im Idealfall hatte der Trinkkönig dafür zu sorgen, dass es beim Gelage kultiviert zuging. Bei der Bestimmung des Mischungsverhältnisses von Wasser und Wein sollte er auf die Kapazität der schwächsten Trinker Rücksicht nehmen. Die Themen für die Tischgespräche sollten so gewählt werden, dass jeder Gast sich daran beteiligen konnte, ohne sich zu blamieren, und auch die von den Gästen beigesteuerte Unterhaltung sollte ein gewisses Niveau haben. Wenn es nach übermäßigem Weinkonsum zu Streitereien kam, sollte er mit viel Fingerspitzengefühl die Streithähne zur Vernunft bringen und verhindern, dass es zu gröberen Ausschreitungen kam.
In der Realität erfüllten die Trinkkönige römischer Gelage nur selten diese hohen an sie gestellten Ansprüche, die in vielen Fällen wahrscheinlich auch nicht den Vorstellungen der Zecher von einem ausgelassenen Gelage entsprachen, da sie sich lieber dem Würfelspiel hingaben oder sich an Darbietungen von Possenreißern und Tänzerinnen erfreuten. Bei den „Partyspielen“, die eine beliebte Unterhaltung beim Gelage waren, konnte es durchaus vorkommen, dass die Regeln des guten Geschmacks vollkommen ignoriert wurden und beispielsweise ein Stotterer zum Singen aufgefordert wurde, ein Kahlköpfiger dazu, sich die Haare zu kämmen, und ein Gehbehinderter zum Tanzen.39
Ebenso wie noch heute war es beim Trinkgelage üblich, Trinksprüche auszubringen. Unser gängiger Trinkspruch „Prosit“ oder „Prost“ leitet sich vom lateinischen Wort prodesse (nützlich sein, nützen) her und bedeutet „Es möge [dir] nützen“, ein Trinkspruch, der im deutschsprachigen Raum ab dem 16. Jh. bezeugt ist. In der römischen Antike prostete man sich mit bene tibi, bene te („Auf dein Wohl“) oder mit vivas („Du sollst leben“) zu. Etwas aufwendigere Trinksprüche sind auf den sogenannten Spruchbechern überliefert, wie zum Beispiel hilaris vivas („Lebe heiter“) oder bibe, vivas multis annis („Trinke und lebe viele Jahre“).
Dem Trinkkönig oblag es, festzulegen, wie viele Becher welcher Maßeinheit beim Trinkspruch in einem Zug auszutrinken waren. Eine beliebte Variante war, so viele Becher in einem Zug zu leeren, wie der Name des Gefeierten Buchstaben enthielt.40 Die gängigen „Maßeinheiten“ für Wein waren der cyathus (0,046 l),41 der sextans (0,092 l)42 und der triens (0,184 l).43 Da beim römischen Trinkgelage grundsätzlich auf ex getrunken wurde, schaffte man es auch mit diesen für unsere Begriffe kleinen Maßeinheiten, sich im Laufe eines Gelages, das sich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen konnte, einen Rausch anzutrinken.
Weniger erfreulich war dann der Katzenjammer am nächsten Tag. Doch auch dagegen konnte man sich wappnen, wenn man die Ratschläge des athenischen Arztes Mnesitheos befolgte:
„Drei Dinge aber beachte, wenn du dich volltrinkst: Erstens: Trinke keinen schlechten und keinen unverdünnten Wein und iss kein Naschwerk dazu. Zweitens: Wenn du genug hast, lege dich nicht hin, bevor du nicht mehr oder weniger gründlich erbrochen hast. Drittens: Wenn du reichlich erbrochen hast, wasche dich kurz ab und lege dich zur Ruhe. Wenn du dich nicht genügend entleeren kannst, nimm ein längeres Bad und strecke dich in der Wanne in möglichst heißem Wasser aus.“44
Sich mit Freunden in der Kneipe oder bei einem Gelage gelegentlich einen Schwips oder Rausch anzutrinken, war gesellschaftlich durchaus akzeptabel. Für sinnloses Kampftrinken bis zur Bewusstlosigkeit hingegen hatte man weniger Verständnis: „Wir sehen, dass die Vorsichtigeren von ihnen sich in den Bädern erhitzen und ohnmächtig heraustragen lassen, dass andere wiederum nicht einmal die Lagerstatt erwarten können, ja nicht einmal ihre Tunika, und nackt sogleich dort, wie um ihre Kräfte zu zeigen, keuchend ungeheuer große Gefäße ergreifen und in einem Zug in sich hineinschütten, um sich anschließend zu erbrechen, und dann wieder zu trinken und so zum zweiten und dritten Male, gerade als ob es ihr Lebenszweck wäre, den Wein zu vertilgen, und als ob dieser nicht anders als durch den menschlichen Körper völlig verschüttet werden könnte“45, kritisiert Plinius die Unsitte des Um-die-Wette-Trinkens.