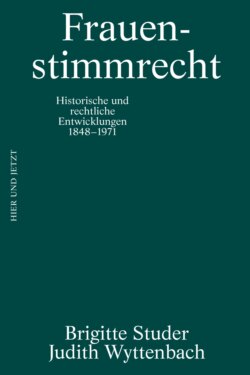Читать книгу Frauenstimmrecht - Brigitte Studer - Страница 20
Aufbruch in der zweiten Kriegshälfte
ОглавлениеDer Erste Weltkrieg ertränkte vorerst jegliche progressive Reformbemühung unter einer Welle patriotischen Enthusiasmus. Doch bereits ab 1915 erwachte international wieder der Geist pazifistischen und antimilitaristischen Protests, zuerst bei den sozialistischen Frauen und der Jugend, die in der Schweiz internationale Kongresse abhielten. Wie vor dem Krieg waren es sozialdemokratische Parlamentarier, die erste Anträge zugunsten des Frauenstimmrechts einbrachten, so im November 1915 in Neuenburg, dann im Mai 1916 in Bern. In beiden Fällen sollte die Einführung des Frauenstimmrechts, in Neuenburg kantonal, in Bern kommunal, ohne Verfassungsrevision im Rahmen der Debatten über das Gesetz über die politischen Rechte geschehen. In beiden Fällen arbeiteten die Aktivistinnen und Aktivisten eng mit den Antragstellern zusammen. In Neuenburg war der Sozialdemokrat Charles Schürch (1882–1951), der auch Gründungsmitglied des Frauenstimmrechtsvereins von La Chaux-de-Fonds war, der institutionelle Vermittler einer Petition der kantonalen Stimmrechtsvereine. In Bern reagierte Eugen Münch (1880–1919) sehr wahrscheinlich auf das Anliegen des sozialdemokratischen Frauenvereins Bern, der ein Jahr zuvor den Antrag gestellt hatte, dass die SP eine Initiative auf Bundesebene lancieren sollte. Obschon er sein Vorgehen mit der Berner Stimmrechtsbewegung nicht abgesprochen hatte, wurde er von dieser durch die Lancierung einer Petition und anderen Aktionen sofort unterstützt.45 In beiden Fällen hatten die Anträge ebenso wenig Chancen wie zwei frühere Versuchsballone von zwei sozialdemokratischen Abgeordneten in den Kantonen St. Gallen und Bern.
1917 kam das Frauenstimmrecht in vier weiteren Kantonen auf die politische Traktandenliste. Im August verlangte eine Motion des Sozialdemokraten Greulich und 49 Mitunterzeichnern das integrale Frauenstimmrecht auf Kantons-, Distrikt- und Gemeindeebene im Kanton Zürich (später durch eine parlamentarische Initiative des Sozialdemokraten Otto Lang, 1863–1936, und 74 Mitunterzeichner ersetzt). Im November folgte eine Motion des Waadtländer Sozialdemokraten Anton Suter (1863–1942). Im Dezember war es am Basler Grossen Rat, die schon ältere Motion des sozialdemokratischen Anwalts Franz Welti (1879–1934) und Konsorten zu akzeptieren. In Genf hingegen kam dem Sozialdemokraten Jean Sigg (1865–1922) der Vertreter der Parti indépendant, Louis Guillermin (1845–1924), zuvor, allerdings mit einer beschränkten Formel: ein Stimmrecht nur auf Gemeindeebene und für Frauen über 25 (während Männer mit 20 Jahren abstimmen durften). Knapp zwei Wochen nach dem Landesstreik, am 28. November 1918, schlug im Kanton Aargau der freisinnige Anwalt Arthur Widmer (1877–1947), der auch im Nationalrat sass, ein «aktives und passives Wahlrecht und Stimmrecht in Kirchen-, Schul-, Armen- und Krankensachen» vor. Der Regierungsrat erklärte sich im Januar 1919 nur bereit, die Frage des Frauenstimmrechts als Anregung anlässlich einer Behandlung der Totalrevision der Staatsverfassung zu prüfen, womit das Problem auf unbestimmte Zeit vertagt war. Eine Petition mit 7327 Unterschriften der aargauischen Frauenorganisationen, die zum Ziel hatte, den Frauen wenigstens das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht im Sozialbereich einzuräumen, blieb ungehört.46 Von den Grossräten abgeschmettert wurden auch die Motionen in den Kantonen Genf und Waadt. (Im Kanton Waadt allerdings erst am 15. Februar 1921, da der Regierungsrat die Behandlung des Anliegens bis dahin hinausgezögert hatte.)
Der SVF hatte sich inzwischen auf nationaler Ebene in eine Sackgasse manövriert. Am 13. Mai 1917 hatte die Delegiertenversammlung zwar die Lancierung einer Volksinitiative beschlossen, doch die Präsidentin, die Genferin Emilie Gourd (1876–1946), war bezüglich der Opportunität skeptisch und liess die Dinge liegen. Seit März 1918 hoffte der SVF stattdessen auf die Motion zur Totalrevision der Bundesverfassung des St. Galler Nationalrats Josef Scherrer-Füllemann (1847–1924) von der Demokratischen Partei. Als am 12. November 1918 der Generalstreik begann und das Neun-Punkte-Programm der Streikenden bekannt wurde, richtete Gourd sofort ein Telegramm an den Bundesrat,47 dass der SVF die Forderung des Frauenstimmrechts unterstützen würde, nicht aber die Methoden der Streikenden. Doch die Delegiertenversammlung vom 25. November desavouierte die Präsidentin mit 27 zu 17 Stimmen. Mit diesem Entscheid, sich von der Frauenstimmrechts-Forderung zu distanzieren, da sie von der falschen Seite kam, dürften die Aktivistinnen paradoxerweise das Gegenteil dessen erreicht haben, was sie wollten. Statt die Forderung zu entpolitisieren, politisierten sie diese: Das Frauenstimmrecht war nun keine parteipolitisch neutrale Forderung mehr. Als Scherrer-Füllemann am 3. Dezember seine Motion einführte, wurde zudem klar, dass er überhaupt nicht an das Frauenstimmrecht dachte. Am 4. und 5. Dezember folgten zwar die beiden Motionen Greulich und Göttisheim, doch wurden sie vom Nationalrat nur als unverbindlichere Postulate überwiesen. Beide verschwanden daraufhin für Jahrzehnte in der Schublade. Der damals im Bundesrat hegemoniale Freisinn verzichtete in den folgenden Jahrzehnten auf seine Handlungskompetenz, denn ansonsten hätte er seine beiden Verbündeten im bürgerlichen Machtblock vor den Kopf gestossen, so meine These: Die Katholisch-Konservativen und die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) waren die vehementesten Gegner.48
Es blieb also nur die kantonale Ebene.