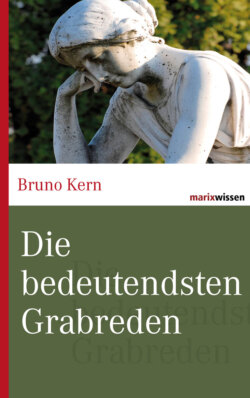Читать книгу Die bedeutendsten Grabreden - Bruno Kern - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление„Der Tod ist schweigsam. Nur wenn wir gegen ihn anreden, nur wenn wir den Dialog mit den Toten in uns fortsetzen, bleibt etwas, was er uns nicht nehmen kann.“1
Genau in diesem Spannungsverhältnis zwischen unserem ratlosen und erschrockenen Verstummen angesichts des brutalen Faktums des Todes und der Notwendigkeit, selbst diese Situation noch sprachlich bewältigen zu müssen, bewegen sich die in diesem Band dokumentierten Grabreden. Totenreden sind also lebensnotwendig. Der Mensch als das der Sprache fähige Lebewesen besteht die Wirklichkeit, indem er sie benennt. Und da die Dynamik seines Denkens, Wollens und Fühlens über den Horizont des unmittelbar Gegebenen hinausreicht, da er, wie Thomas von Aquin sagt, „quodammodo omnia“, in gewisser Weise alles, ist, sozusagen aufs Ganze geht, sucht er auch da noch nach Sinn, wo jede Empirie ihn scheinbar versagt. Grabreden sind deshalb als ein Ausdruck des Bewältigungsversuches unserer Endlichkeit Teil einer Kulturgeschichte des Todes, wie sie etwa der französische Historiker Philippe Ariès2 zu entwerfen versucht hat. Bereits der erste in diesem Band dokumentierte Text aus dem Gilgamesch-Epos zeigt, dass die existenzielle Beunruhigung aufgrund der Endlichkeit unseres Daseins die Geschichte des Menschen von Anfang an begleitet. Diese Grundkonstante der Menschheitsgeschichte unterliegt jedoch gleichzeitig dem historischen Wandel. Unser konkretes Verhältnis zum Tod wird durch die jeweilige Lebenssituation und historische Ereignisse geprägt: Der Grad der Gefährdetheit des Lebens, die allgemeine Lebenserwartung, die Höhe der Kindersterblichkeit etc. bestimmen die Erfahrung des Todes und den Umgang mit ihm ebenso wie etwa die große Pestepidemie im 14. Jahrhundert, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahinraffte, die Kriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts oder die tiefe Verletzung jeglicher Humanität durch industriell durchgeführte Massenvernichtung. Der Tod, der unmittelbar das einzelne Individuum betrifft, ist keine Privatangelegenheit, ganz im Gegenteil: Da er jeden Sinnstiftungsversuch mit einer absoluten Grenze konfrontiert, gefährdet er auch das prekäre Gleichgewicht des sozialen Zusammenlebens. Im Tod steckt ein anarchisches Potenzial. Auch das ist eine Erklärung für den Aufwand an Mythen, Riten, philosophischen und religiösen Systemen, um ihn gleichsam zu zähmen und ihm seinen subversiven Stachel zu ziehen.
Die Grab- oder Trauerrede als Ansprache direkt am Beisetzungsort oder bei einer religiösen oder säkularen Trauerfeier lässt sich auf eine alte Tradition zurückführen. Sie geht unmittelbar aus der – bereits poetisch gestalteten – Totenklage hervor. Die ersten beiden in diesen Band aufgenommenen Textbeispiele – die Totenklage des Gilgamesch aus dem ältesten literarischen Dokument der Menschheit überhaupt und das Klagelied des David für Saul und Jonatan aus der hebräischen Bibel – sollen diesen Ursprung deutlich machen. Die hier wiedergegebene Leichenrede der Aspasia aus der griechischen Antike beruft sich – ebenso wie die berühmte „Gefallenenrede des Perikles“3 – auf einen schon bestehenden Brauch. Man nimmt an, dass diese Sitte bereits zu Zeiten des Homer (8. Jh. v. Chr.) bestand.4 Am Beispiel der Leichenrede der Aspasia wird deutlich, dass wir es hier mit einem stark typisierten literarischen Genus zu tun haben, der in der antiken Rhetorik fest verankert ist. Es handelt sich beim Enkomion (oder in der lateinischen Spielart: laudatio funebris) um Lobreden für Verstorbene, denen ein festgefügtes Schema zugrunde liegt. Der im Lateinischen auch gebräuchliche Ausdruck consolatio deutet auf den Trost als einen wesentlichen Zweck der Rede hin. Gerade in der lateinischen Antike gilt das Trostspenden als eine der nobelsten Aufgaben des Rhetors. Die gängigen, immer wieder anzutreffenden Topoi nehmen vor allem in späterer Zeit auch häufig die Zerrform des Klischees an. In der späten Kaiserzeit erreicht die Form der rhetorisch durchkomponierten Totenrede einen Höhepunkt. Die christliche Antike knüpft in Form und Inhalt direkt an diese Tradition an. Dies wird in diesem Band anhand der Rede des Ambrosius von Mailand für Kaiser Theodosius exemplarisch gezeigt. Aus dem Mittelalter sind uns insgesamt nur sehr wenige Grabreden überliefert. Neben den „Sermones funebres“ des Johann de St. Germiniano in Lyon (14. Jahrhundert) finden sich nur vereinzelt auch deutsche Beispiele. Mit der Predigterlaubnis für die Bettelorden (13. Jahrhundert) findet die Predigt am Grab wieder stärkere Verbreitung. Doch erst mit der Reformation wird die Leichenrede wieder allgemein. Um diesen Epochenumbruch deutlich zu markieren, habe ich aus der Reformationszeit zwei prominente Reden aufgenommen. In der Folgezeit lässt sich auch – noch vor der eigentlichen Säkularisierung – eine Tendenz zu geistlich verbrämten Lobreden feststellen. Die Beispiele für vom christlichen Kontext völlig losgelöste Grabreden stammen in diesem Band aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der exemplarische Längsschnitt durch die abendländische Geschichte erlaubt es nicht zuletzt, den Wandel der ästhetischen Kriterien nachzuvollziehen.
Ein Großteil der hier gesammelten Grabreden hat, wie die europäische Geschichte insgesamt, einen christlichen Hintergrund. Kern des Christentums ist die Hoffnung auf eine individuelle, leibliche Auferstehung der Toten: Mit kaum zu übertreffender Präzision formulierte bereits der frühchristliche Schriftsteller Tertullian, dass dieser Glaubensartikel das Wesen des Christentums selbst ausmacht: Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus – Der Glaube der Christen ist die Auferstehung der Toten; sofern wir dieses glauben, sind wir [Christen].5 Bereits in der Barockzeit ist allerdings zu beobachten, dass dieser Bezug nicht immer dominierend ist. Die Geschichte des Abendlandes ist ja gleichzeitig auch die Geschichte der Emanzipation von seinen religiösen Wurzeln und eines Säkularisierungsprozesses, den es in anderen kulturellen und religiösen Kontexten in dieser Weise nicht gegeben hat. Im vorliegenden Band zeugen vor allem die Grabreden aus dem 20. Jahrhundert davon. An ihnen ist allerdings auch deutlich abzulesen, dass auch das säkularisierte Bewusstsein nicht ohne mythologische Bezüge auskommt. An die Stelle konkreter Jenseitsvorstellungen treten etwa Beschwörungen eines kollektiven Sinnzusammenhangs, in dem das verstorbene Individuum seine bleibende Bedeutung behält.
Es ist paradox: Gerade da, wo menschliches Fassungsvermögen an seine deutlichste Grenze stößt, entfaltet die sprachliche Gestaltungskraft häufig in besonders eindrucksvoller Weise ihre Fähigkeiten. So sind gerade Grabreden oftmals Höhepunkte der Rhetorik. Dies gilt von den hier ausgewählten Reden in besonderem Maß etwa für Daniel Casper von Lohensteins Abdankung für Hofmann von Hofmannswaldau, für die „Oraisons funèbres“ des französischen Bischofs Jacques-Bénigne Bossuet, der seine Bedeutung ja weniger als Theologe denn vielmehr als Klassiker der französischen Literatur erlangt hat, für Ludwig Börnes Denkrede für Jean Paul oder auch für Karl Kraus’ Rede am Grabe Peter Altenbergs. Aber auch das genaue Gegenteil lässt sich beobachten! Nicht selten nehmen Totenreden, Nekrologe, Predigten und säkulare Gedenkreden Zuflucht ins Klischee, ins hohle Pathos, manchmal auch in gefährliche Demagogie. Auch hierfür finden sich in diesem Band einige Beispiele. Dazu zählen etwa die Beschwörung von fragwürdigen patriotischen Tugenden in der griechischen Antike (in der „Leichenrede der Aspasia“ nicht ohne ironisierende Absicht dargestellt), die „bestellte“ Rede für Ludwig van Beethoven und natürlich Versatzstücke einer bestimmten Form von christlicher Frömmigkeit. Letztere habe ich hier durch die Aufnahme einer „Modellpredigt“ aus einer Handreichung für professionelle Verkündiger des christlichen Glaubens exemplarisch deutlich zu machen versucht. Als „Antidot“ dazu seien die „Leichenreden“ des schweizerischen reformatorischen Dichterpfarrers Kurt Marti wärmstens empfohlen, der gerade aus einer tiefen Gläubigkeit heraus solche Klischees im wahrsten Sinn des Wortes durchkreuzt. Das hört sich dann etwa folgendermaßen an:
dem herrn unserem gott
hat es gar nicht gefallen
dass gustav e. lips
durch einen verkehrsunfall starb
erstens war er zu jung
zweitens seiner frau ein zärtlicher mann
drittens zwei kindern ein lustiger vater
viertens den freunden ein guter freund
fünftens erfüllt von vielen ideen
was soll jetzt ohne ihn werden?
was ist seine frau ohne ihn?
wer spielt mit den kindern?
wer ersetzt einen freund?
wer hat die neuen ideen?
dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
dass einige von euch dachten
es habe ihm gefallen […]6
Man möge dies als „Gegentext“ neben die in diesem Band wiedergegebene Predigt M.K.F. Gerstners legen. Sein Beharren auf dem „Was Gott tut, das ist wohl getan“ wird damit geradezu als blasphemisch entlarvt. Dabei kann sich Kurt Marti auf die beste biblische Tradition berufen, für die angesichts von Leid und Tod nicht nur die Klage eine angemessene Reaktion ist, sondern auch der anklagende Protest – gegen Gott selbst (vgl. etwa das Buch Ijob). Gerade um die Würde des Leidenden nicht zu verletzen und die Solidarität im Leid zu ermöglichen, darf es nicht religiös überhöht und „ruhiggestellt“ werden. „Protestleute gegen den Tod“ lautet denn auch Martis Definition für die Christen.
Allzu billiger Trost ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der christlichen Religion. Er begegnet in völlig religionsfernen Totenreden mindestens ebenso deutlich. Das machen in diesem Band nicht zuletzt die hier wiedergegebenen Totenreden von und für prominente SozialistInnen deutlich. Wenn Friedrich Engels am Grab von Karl Marx als Hoffnungsinhalt das Fortleben seines Namens in der Geschichte angibt, dann drängt sich die Frage nach den vielen namenlosen Opfern der Geschichte auf und dann stellt sich gerade für die Vertreter der Utopie einer solidarischen Gesellschaft die Frage nach dem, was Helmut Peukert das „Paradox anamnetischer Solidarität“7 genannt hat: Wie soll diese Solidarität letztlich, ohne sich in einen Selbstwiderspruch zu verstricken, möglich sein, wenn sie die Opfer und die Toten, denen sie sich ja verdankt, ausklammern muss? Und was kann die kompromisslose Praxis für eine Utopie letztlich motivieren, die innerweltlich doch nicht einzulösen ist? Möglicherweise lässt sich der ethische Anspruch, dass der Mörder nicht ewig über sein Opfer triumphieren darf, doch nur, wie Max Horkheimer vermutet, theologisch aufrecht erhalten.
Überzeugender sind da jene Totenreden, die ihre Ratlosigkeit und ihren Schmerz einfach aushalten, auf vorgefertigte Formeln verzichten und keinen anderen Trost gelten lassen als den, dass die verlorene nahestehende Person gelebt hat. In diesem Sinne kann man Karl Kraus’ Rede am Grab Peter Altenbergs lesen.
Dass unser heutiger Anspruch an Authentizität auch das alte Wort De mortuis nil nisi bene in Frage stellt und an dessen Stelle die Ehrlichkeit gegenüber dem Toten treten lässt – auch dafür gibt es Beispiele in diesem Band, etwa Melanchthons Rede für Luther, oder Emersons Totenrede für Henry Thoreau, denen es beiden gelingt, auch kritikwürdige Züge des Verstorbenen angemessen zur Sprache zu bringen.
Grabreden, zumal, wenn es sich um „berühmte“ handelt, haben einen öffentlichen Charakter. Ihr Adressat ist in den meisten der hier dokumentierten Fälle nicht nur ein kleiner Kreis von Hinterbliebenen, sondern die „Öffentlichkeit“ in irgendeiner Form. Das bestimmt auch den vom Redner verfolgten Zweck. Der Tod einer prominenten Person kann so zum Anlass werden, eine öffentliche „Sache“ zu vertreten, wie es etwa Abraham Lincoln in seiner Rede für Henry Clay tat. Das ehrende Gedenken des Toten benutzte er vor allem, um in der Sklavenfrage Stellung zu beziehen. Was hier legitim ist, weil es hinreichend von den Intentionen des Verstorbenen selbst gedeckt ist, birgt jedoch auch die Gefahr des Missbrauchs und der Instrumentalisierung in sich. Auch dies ist im vorliegenden Band belegt. Grabreden partizipieren also auch an der jeweiligen Kultur oder Unkultur politischer Rede. Gerade angesichts der allzu bekannten unrühmlichen Beispiele aus jüngster Zeit in dieser Hinsicht habe ich zum Abschluss dieses Bandes Richard von Weizsäckers Totenrede für Willy Brandt gewählt – ein Beispiel verantworteter öffentlicher Rede, die Ehrung eines Verstorbenen, die zugleich dem zur Ehre gereicht, der ihn würdigt.
Es handelt sich hier – mit einer begründeten Ausnahme – um „berühmte“ Grabreden8: berühmt aufgrund der Qualität der Rede selbst, aufgrund ihres besonderen historischen Kontextes, aufgrund der herausragenden Stellung des Verstorbenen, dem die Rede gilt, oder dessen, dem es zufällt, die Totenrede zu halten. Der Band kann also auch als kleiner Streifzug durch die abendländische Geschichte gelesen werden, illustriert anhand von Grabreden, in denen der Geist einer Epoche, einer Tendenz etc. oftmals in besonders dichter Form zum Ausdruck kommt. So manches Schulwissen aus dem Geschichtsunterricht mag durch die Lektüre dieser Reden Farbe und Anschaulichkeit gewinnen.
Das Adjektiv „berühmt“ wird, sofern es sich auf große Persönlichkeiten bezieht, allerdings durch die Sache selbst Lügen gestraft. So weist auch in diesem Band gerade Jacques-Bénigne Bossuet auf die nivellierende Wirkung des Todes hin, vor der alle sozialen Unterschiede verschwinden, und er wagt es, dem Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. entgegenzuhalten: „Gott allein ist groß, auch Könige müssen sterben!“ Inmitten des Prunks dieser glänzenden Epoche macht er die Stimme des alttestamentlichen Predigers (Kohelet) vernehmbar: Vanitas vanitatum – nichtig und eitel ist alles!
Bruno Kern
1 Schultz, Hans Jürgen, Sprache ist Hoffnung, gehört zu werden, in: ders. (Hg.), Einsamkeit, Stuttgart 1980, 239.
2 Ariès, Philippe, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland, München 1981.
3 Dokumentiert in: Kaufhold, Martin, Die großen Reden der Weltgeschichte, Wiesbaden52010, 19 – 29.
4 Vgl. dazu Otto, Gert, Über Totenreden, in: Oesterreich, Peter L./Sloane, Thoas O. (Hg.), Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett, Brill 1999, 505 – 507.
5 Mit einer etwas anders lautenden Übersetzung zitiert bei Greshake, Gisbert/Kremer, Jacob, Ressurectio mortuorum. Zum theologischen Verständnis der leiblichen Auferstehung, Darmstadt 1992, 3.
6 Marti, Kurt, Leichenreden, München 2004; das zitierte Gedicht ist auch im Internet zugänglich unter: www.lyrikwelt.de/gedichte/martig1.htm.
7 Vgl. Peukert, Helmut, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, Frankfurt a.M. 1976, 308 – 310.
8 Bei etlichen Grabreden waren aufgrund des übermäßigen Umfangs Kürzungen unvermeidlich. Sie wurden jedoch so vorgenommen, dass nicht nur die zentralen Inhalte, sondern auch die Gesamtanlage der Rede deutlich nachvollziehbar bleiben.