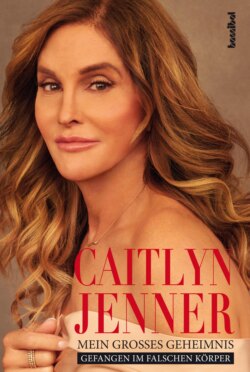Читать книгу Mein großes Geheimnis - Buzz Bissinger - Страница 10
ОглавлениеSportunterricht in meiner Grundschule in Tarrytown. Unser Sportlehrer hatte auf dem Parkplatz ein paar Hütchen aufgestellt, um die Strecke für einen Wettlauf zu markieren.
Schauen wir also mal, wie wir uns dabei schlagen.
Bisher hatte ich mich noch nie für eine Sportmannschaft gemeldet, und ich hatte keine Ahnung, ob ich in Sport gut oder schlecht war. Ehrlich gesagt, war ich nicht besonders ehrgeizig. Wenn ich etwas tat, dann meistens, weil es einfach Spaß machte und mir von Natur aus lag. Und dieser Wettlauf schien so etwas zu sein.
Jeder in der Klasse rannte um die orangenen Hütchen herum, und der Lehrer stoppte die Zeit und schrieb sie für uns alle auf. Dann sah er mich an. Klassenkameraden, die mich noch nie beachtet hatten, klopften mir auf die Schulter. Und die Stoppuhr des Lehrers bestätigte es: Ich bin der Schnellste der ganzen Schule!
Vielleicht gab es also doch ein Gebiet, auf dem ich glänzen konnte. Und die sportlichen Erfolge brachten ja nicht nur Anerkennung. Was gab es Besseres, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen? Oder um diese komische Sache irgendwie wegzuschieben? Sportskanonen zogen keine Frauenkleider an. Sportskanonen liefen auch nicht mit einem Kopftuch durch die Straßen. Die standen in der Umkleide und zeigten stolz, wie lang ihr Ding war. Wir waren die Größten.
Sport war in den Sechzigern (wie heute übrigens auch noch) die perfekte Tarnung. Hier regierte die Männlichkeit, besonders die weiße. Eine gesetzlich geregelte Gleichberechtigung der Geschlechter gab es nicht. Eine Integration fand im College-Sport nur langsam und gegen viele innere Widerstände statt. Für alles, was mit dem Geschlecht oder der Sexualität zu tun hatte, bot Sport wiederum den perfekten Schutz. Ein Sportler, der sich in den Sechzigern als transgender outete? Unmöglich. Das Netzwerk existierte nur im Untergrund: Wer offen lebte, riskierte, belästigt oder verhaftet zu werden. Stonewall, das große Schicksalsereignis der LGBTQ-Bewegung, fand erst 1969 statt, als ich schon aufs College ging. Damals kam es bei einer Razzia im New Yorker Stonewall Inn zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die weltweit Schlagzeilen machten. Besonders Transfrauen waren bei der Durchsuchung des Clubs mit den üblichen Polizeimethoden schikaniert worden: In New York war es damals gesetzlich vorgeschrieben, mindestens drei Kleidungsstücke zu tragen, die eindeutig dem biologischen Geschlecht zugeordnet werden konnten, und wenn die Polizei jemanden im Verdacht hatte, das nicht zu tun, kam er in Gewahrsam und musste sich abtasten lassen oder ausziehen.
Eines der ersten Outings im Sport gab es 1975, als ich 26 Jahre alt war. Damals bekannte der Footballer Dave Kopay in einem Interview mit dem Washington Star, homosexuell zu sein. Zuvor hatte die Zeitung in einer Serie einen anonymen schwulen Footballer zitiert, und Kopay erkannte, dass es jemand war, mit dem er einmal geschlafen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seine Profikarriere schon seit zwei Jahren beendet – hätte er das vorher getan, wäre seine Karriere automatisch vorbei gewesen. (Selbst heute gibt es in einer der großen Basketball-Ligen oder im American Football kaum offen schwule Sportler. Weibliche Profis gehen wesentlich offener mit ihrer sexuellen Orientierung um, was darauf hindeutet, dass die Atmosphäre dort nicht so feindselig ist, und die Athletinnen gehen viel ehrlicher und wertschätzender mit sich um.)
Aber zurück zu diesem Schicksalstag in der fünften Klasse. Es war für mich tatsächlich ein Wendepunkt: Ganz unerwartet hatte ich meine Berufung gefunden.
Als ich wenig später in die Junior High School kam, sprach sich schnell herum, dass ich schnell laufen konnte, und irgendwann kamen drei ältere Jungen auf mich zu.
„Du bist also schnell, was?“
„Denke schon.“
„Dann lass uns doch mal gucken. Laufen wir um die Wette.“
Ich bin schnell. Aber ich war nicht blöd.
Klar lief ich.
Aber nach Hause.
Während ich mich als Jugendlicher mit diesen ganzen verwirrenden Gefühlen herumschlagen musste, war ich am meisten mit mir selbst im Einklang, wenn ich auf dem Footballfeld stand und mich mit jemandem messen konnte. Mit Aggression hatte das gar nicht viel zu tun, es war vor allem eine Möglichkeit, das eigene Ego auszuleben: Man hat das Gefühl, etwas beherrschen zu können, und will nicht mehr damit aufhören.
Ich war nicht von Natur aus ein großartiger Sportler. Aber im Laufe der folgenden Jahre wuchs in mir das Bedürfnis, meine Stärken zu zeigen und andere Sportler zu überrunden, und dabei wurde der Zehnkampf immer wichtiger für mich. Der Wettbewerb mit anderen war dabei natürlich eine große Motivation, aber da war auch noch etwas anderes – der Drang, dass da in mir etwas ist, von dem ich mich immer wieder reinigen muss. Dieses Gefühl der Minderwertigkeit konnte ich nur durch die Zurschaustellung der eigenen Überlegenheit bekämpfen.
Da mir natürlich bewusst war, dass man als Sportskanone ein großes Ansehen genoss, spielte ich an der Sleepy Hollow High School von Tarrytown auch die beliebten Mannschaftssportarten wie Football oder Basketball. Und das durchaus gern. Es machte mir Spaß. Aber lieber noch waren mir Wettkämpfe, bei denen alles nur von mir allein abhing. Ich wollte mein Schicksal selbst in der Hand haben – vielleicht, weil Kontrolle in meinem Leben ohnehin eine große Rolle spielte.
Wenn ich gewann, war das mein Verdienst. Wenn ich verlor, war es meine Schuld. Anschließend konnte ich allein nach Hause gehen und mich damit auseinandersetzen, ich musste nicht noch mit meinen Mannschaftskameraden über die Niederlage lamentieren oder aber einen Sieg feiern. Letztlich war ich ein Einzelgänger, was vermutlich typisch ist für jemanden, der ein Geheimnis in sich trägt, das er nicht teilen darf. Zwar war ich immer freundlich, aber auch distanziert; ich hielt immer eine Armlänge Abstand. Und weil ich in dem, was ich tat, ziemlich gut war, ließ man mich in Ruhe. Ich hatte Freunde in den Football- und Basketball-Mannschaften, aber ich verbrachte nicht allzu viel Zeit mit ihnen. Die anderen mochten mich, wahrscheinlich, weil mein erstes Auto ein zum Leichenwagen umgebauter Cadillac Baujahr 1954 war (kein Witz) und bis zu 24 meiner High-School-Kumpels auf die für den Sarg vorgesehene Ladefläche passten (auch kein Witz). Aber ich wollte nicht, dass andere wussten, wer ich war, worüber ich nachdachte und womit ich mich herumschlagen musste. Vorsichtshalber gab ich mich ein bisschen tollpatschig, weil mich das noch weiter aus der Schusslinie brachte. Der Jenner tickte halt ein bisschen komisch.
Dabei war es nicht so, dass ich nichts empfinden konnte, ich hatte nur Angst davor. Gefühle brachten mich immer nur durcheinander, sonst nichts. Ich stand gerne ein wenig abseits, weil mir das so gefiel. Es war sicherer, leichter, besser. Und ich war eben ein Einzelgänger.
Der Sportbereich, der meinen Fähigkeiten am meisten entgegenkam, war die Leichtathletik. Vor allem der Stabhochsprung. Damit fing ich als Freshman in der High School an. Die Freiheit und das wie eine Spirale ansteigende Gefühl, mit sich selbst allein zu sein, sprachen mich an. Es war unvergleichlich, mit dem langen Stab in der Hand eine schmale Bahn hinunterzulaufen, die Spitze in den Einstichkasten zu stoßen und in einer langsamen Kurve emporzusteigen, um über die Latte zu federn. Körper und Geist waren beide gefordert, und der innere Aufruhr ließ dabei etwas nach. Mein Vater legte im Garten eine Sandgrube an, damit ich trainieren konnte. Noch zu High-School-Zeiten wurde ich Bester bei den Meisterschaften von Connecticut und zweimal herausragender Sportler meines Leichtathletik-Teams.
Ich trieb allerdings nicht nur an der Schule Sport. Mein Vater war immer auf der Suche nach Aktivitäten, an denen sich die ganze Familie am Wochenende beteiligen konnte. Nachdem er sich für Wasserski entschieden hatte, kaufte er ein Boot. Damit ging es hinaus auf den Candlewood Lake in Connecticut. Ich hatte Angst, oder vielmehr, ich fürchtete mich vor einer neuerlichen Blamage, die meine Unsicherheit nur noch weiter vertiefen würde. Als Kind war ich oft genug bloßgestellt worden. Mein Vater kannte mich besser und bewunderte meine sportlichen Fähigkeiten viel mehr, als ich selbst es tat; meiner Meinung nach war ich nichts Besonderes. Nur ein verwirrtes Kind, das sich irgendwie durchzumogeln versuchte. Von meiner Legasthenie wusste mein Vater, aber er hatte keine Ahnung von meiner Faszination für den Kleiderschrank meiner Mutter, die mein Selbstbild zusätzlich beeinträchtigte. Und davon sollte er auch nie erfahren. Niemals. Das hätte ich ihm nie erzählt. Und es durfte nicht passieren, dass er mich erwischte. Niemals. Denn das war ja nur so ein komischer Tick, den ich damals gerade hatte. Irgendwann würde das schon wieder vergehen, warum sollte ich es also jemandem erzählen.
Bei den Touren auf dem Candlewood Lake hatte er besonderen Spaß mit der so genannten „Peitschen-Technik“. Indem er einen weiten Kreis zog, wurden die Skier durch die Radialkraft immer schneller und schneller. Als er das zum ersten Mal tat, war ich erst zehn oder elf, und ich schrie, er solle aufhören. Er machte aber weiter, sodass ich noch mehr schrie. Meine Schwester Pam hatte dagegen den Bogen schnell raus, und das machte die Sache für mich nur noch schlimmer. Bis es dann plötzlich Klick machte und ich wusste, wie es ging. Dann aber wollte Vater, dass ich einen Ski ablege, um nur noch auf einem übers Wasser zu gleiten, und damit ging das Ganze von vorn los. Ich wollte das nicht. Ich konnte das nicht. Ich hatte mich gerade erst an zwei Skier gewöhnt und flehte ihn an:
Bitte, Dad, zwing mich nicht, das zu versuchen. Ich ertrage es nicht, wenn ich versage. Das habe ich schon viel zu oft erleben müssen. Ich bin sowieso schon komisch. Das merke ich doch jeden Tag. Bitte Dad, mach es nicht noch schlimmer.
Er gab jedoch nicht nach.
„Nimm den verdammten Ski ab.“
„Na gut, ich mach’s, aber hör auf, das zu sagen.“
„Nimm den verdammten Ski ab.“
„Ist ja gut, ich habe ja gesagt, dass ich es tue.“
„Nimm einfach den verdammten Ski ab.“
Ich probierte es aus. Ich tat es.
Anschließend schwebte ich auf Wolke sieben. Als Jugendlicher gewann ich später dreimal die Wasserski-Meisterschaft der Oststaaten. Diese Siege waren an sich ein großartiges Gefühl, aber beim Wasserski lernte ich dank meinem Vater noch etwas viel Wichtigeres – eine Demut, die mich durch mein restliches Leben führen sollte. Sein Credo war ganz einfach: Taten sprechen für sich, mehr als Worte.
Lass sie alle zeigen, was sie können, und dann machst du es, ohne vorher ein Wort zu sagen. Erzähle ihnen nicht einmal, dass du Wasserskilaufen kannst. Das werden sie schon merken, wenn du es getan hast.
Aber natürlich ging es auf der High School nicht nur um Sport. Zensuren spielten auch eine Rolle, aber mir reichte es, im unteren Durchschnitt zu bleiben, gerade gut genug zu sein, damit ich weiterhin für die Sportmannschaften ausgewählt werden konnte. Und ansonsten dachte man auf der High School natürlich an erste Treffen mit Mädchen und an Sex, was beides Hand in Hand ging, wenn man eine große Nummer auf dem Campus war.
Ich war einer der Stars im Football-Team, dem beliebtesten Sport an der High School. Natürlich ging man da mit Mädchen aus. Aber gleichzeitig war ich schüchtern und verklemmt, weswegen ich nur eine Handvoll Verabredungen hatte, aus denen nichts weiter wurde. Von Sex redeten die Jungs ständig, also hatte ich das Gefühl, dass auch ich etwas tun musste. Das Problem war allerdings, dass ich Frauen eher auf einen Sockel stellte und sie bewunderte und beneidete, sodass ich nicht unbedingt der typische, aggressive Muskelprotz war. Zudem lag ich beim Sex eigentlich lieber unten als oben – in einer amerikanischen Vorstadt damals eine völlig ketzerische Vorstellung. Also übernahm ich notgedrungen die scheinbar aktivere Position oben, wie es sich gehörte, und tat mein Bestes.
In der Oberstufe der Newtown High School in Sandy Hook, Connecticut, wohin wir inzwischen umgezogen waren, schlief ich zum ersten Mal mit einem Mädchen. Das Ganze fand auf dem Rücksitz eines schwarzen Ford Falcon Kombi statt, der meiner Mutter gehörte. Ich war ein totaler Romantiker. Das Einzige, woran ich mich heute noch ganz deutlich erinnere, war, dass sie viel besser Bescheid wusste als ich. Sie gefiel mir wirklich sehr, aber meine Hauptmotivation war Neugier. Und vielleicht fühlte ich mich auch ein bisschen unter Zugzwang und war bemüht, den äußeren Schein aufrecht zu erhalten. In der High School wusste halt jeder, wer mit wem schlief, und da war dies doch sehr förderlich für meine Tarnung.
Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern, die ich nach der High School noch kennenlernen sollte, führte ich über meine Eroberungen nicht Buch. Es wäre auch eine ziemlich kurze Liste gewesen.
Mein Bedürfnis nach Sex war einfach nicht sehr groß. Deswegen regt es mich auch so auf, wenn heutzutage dauernd über mein Sexleben spekuliert wird. Da spielt auch wieder diese uralte, falsche Annahme mit hinein, der Grund für eine Transition läge vor allem in der sexuellen Orientierung. Dauernd geht es um die Frage, was passiert, wenn ein Mann zur Frau wird und immer noch Sex mit Frauen hat, ob sie dann eine Lesbe ist oder nicht. Wen interessiert das? Warum muss auf alles immer gleich irgendein Etikett geklebt werden?
Meine Vorlieben haben sich nach meiner Transition nicht verändert. Warum sollten sie auch? Ich habe immer gern mit Frauen geschlafen, ohne viel darüber nachzudenken. Auf der Rangliste von Dingen, die in meinem Leben wichtig sind, hat Sex keinen großen Stellenwert, und das ist schon seit langer Zeit so. Ob ich in Zukunft gern eine Partnerin hätte? Ja, durchaus. Eine Partnerin, mit der ich dann auch schlafe? Im Augenblick gibt es sie nicht, und ich weiß auch nicht, ob sich das je ändern wird.
Und wie wäre es mit einem Partner, einem Mann? Bisher habe ich kein Verlangen danach gespürt. Aber vielleicht ändert sich auch das mit der abschließenden, geschlechtsangleichenden Operation. Vielleicht werde ich mich anders fühlen, wenn die letzten körperlichen Anhängsel meiner Männlichkeit, oder vielmehr meiner medizinisch definierten Männlichkeit, verschwunden sind. Manche meinen, dass es für eine Transfrau keinen Grund gäbe, eine solche OP durchführen zu lassen, wenn sie nicht beabsichtigt, Sex mit Männern zu haben. Ich möchte sie aber aus einem anderen Grund machen lassen – um mich so authentisch wie möglich zu fühlen.
Auf der High School ließ ich mich weitgehend treiben. Selbst im Sport hatte ich keinen brennenden Ehrgeiz, da sich noch nicht herauskristallisiert hatte, wie ich meine Vielseitigkeit am besten zum Einsatz bringen konnte. Im Stabhochsprung war ich gut, aber ich trat noch nicht in nationalen Wettkämpfen an. Und der Zehnkampf, der Decathlon? Das war für mich damals nichts weiter als ein Wort, von dem ich nicht einmal wusste, wie man es richtig schrieb. Ich gehörte nicht zu denen, die zum Sportler geboren wurden. Sicher, ich gewann gerne, aber ich war nicht nur auf Wettbewerb gepolt. Eine gewisse Unbeschwertheit blieb mir, sogar so sehr, dass ich nach dem Sieg im landesweiten Leichtathletik-Wettbewerb vergaß, meine Sportschuhe zu einem Fototermin der Lokalzeitung mitzubringen, sodass ich in Halbschuhen zwischen den anderen Athleten stand.
Nein, ich war wirklich nicht der Typ, dem eine große Sportlerkarriere vorherbestimmt war. Allerdings hatte ich Selbstdisziplin. Und ich konnte Dinge ausblenden, beispielsweise das Gender-Problem. Es war zwar unterschwellig immer da, aber in der High School hatte ich die Lage recht gut im Griff. Ja gut, wenn sich die Möglichkeit sich bot, zog ich immer noch Frauenkleider an. Aber das ergab sich nicht mehr so häufig. Da mir Moms Sachen inzwischen viel zu klein waren, ging ich jetzt an Pams Kleiderschrank. Ich bewunderte Frauen, und gleichzeitig war ich neidisch auf sie – nicht auf ihr Aussehen an sich, sondern darauf, wie sie in ihrem Frausein ruhten und mit sich eins waren, wo ich doch wusste, dass ich dieses Gefühl nie kennenlernen würde. Mit Männern war das genauso, auch sie waren zufrieden mit sich, auf eine Art, die ich niemals spüren würde. Mir kam es so vor, als hätte ich gar kein Geschlecht, als sei ich in der schlimmsten Position überhaupt gefangen – zwischen allen Stühlen.
Ella, die später auch regelmäßig in I Am Cait zu sehen war, hat andere Erfahrungen in ihrer High-School-Zeit gemacht. Sie hatte nie versucht, sich anzupassen, oder darauf geachtet, nicht aufzufallen. Sie färbte sich das Haar lila. Sie trug manchmal Kleider. Sie machte von Anfang an deutlich, dass sie ihre männliche Haut abstreifte. Sie feierte sich selbst, egal, was die anderen Schüler dachten.
Ihre Furchtlosigkeit habe ich immer unglaublich bewundert. Sie hat ihre wahre Gender-Identität nicht als Fluch, sondern als Segen und Befreiung verstanden. Manchmal frage ich mich, wieso ich das nicht auch getan habe, warum ich auf der High School nicht auch einfach gesagt habe, Scheiß drauf, ich mache mein Ding. Es gab dafür natürlich Gründe – die Zeiten waren anders, und nicht nur in meiner unmittelbaren Umgebung, sondern in ganz Amerika war die Gesellschaft sehr konservativ. Man hätte mich zu Seelenklempnern geschickt, die noch immer glaubten, dass es sich bei Genderdysphorie genau wie bei Homosexualität um eine Krankheit handele, die man mit barbarischen Methoden heilen könne, indem man den „Patienten“ mit Elektroschocks behandelt oder ihn dazu bringt, sich zu übergeben, während er sich homoerotische Bilder ansieht. Sicher hätte ich keinen Leistungssport mehr treiben dürfen. Wahrscheinlich hätte man mich auch von der Schule verwiesen. Aber vielleicht gab es davon abgesehen noch einen anderen, entscheidenderen Grund.
Ich hatte einfach nicht den Mut. Deswegen habe ich so lange gebraucht.
Ich wollte einfach nur dazugehören.
Als mein Schulabschluss näher rückte, wusste ich immer noch nicht wirklich, was ich einmal machen wollte, außer erst einmal zu studieren – unter anderem, weil das bedeutete, dass ich vom Kriegsdienst in Vietnam zurückgestellt würde. Obwohl ich in den fünf Semestern an der Newtown High in allen Sportarten, in denen ich dort aktiv war (Basketball, Football und Leichtathletik), immer wieder als herausragender Spieler ausgezeichnet wurde, rissen sich die Colleges nicht um mich.
Nur das Graceland College in Lamoni, Iowa, zeigte echtes Interesse. Ich wiederum fand Graceland nicht so prickelnd. Von Iowa wusste ich nur, dass die Winter dort kalt und die Landschaft flach sein sollen. Die Schule stand in enger Verbindung mit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, heute bekannt als Gemeinschaft Christi. Auch über sie wusste ich nicht viel, außer, dass sie es mit der Religion verdammt ernst meinte.
Bis dahin war ich noch nie weiter im Westen gewesen als in Ohio. Und ich war auch erst einmal in meinem Leben geflogen. New York City erschien mir noch so weit weg wie die dunkle Seite des Mondes. Mit den Hippies hatte ich nichts am Hut, ich war so obrigkeitshörig und konservativ wie meine Eltern. Mein Plan sah daher zunächst vor, weiter daheim zu wohnen, um die Kosten gering zu halten, mir ein Junior College in der Nähe zu suchen, um meine Zensuren zu verbessern, schließlich einen vierjährigen Studiengang anzufangen und am Wochenende für die Baumschnitt-Firma meines Vaters zu arbeiten, um mir ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Eigentlich hatte ich gar kein richtiges Ziel. Vielleicht war technisches Zeichnen was für mich. Ich wusste es einfach nicht so recht.
Als ich am ersten Tag von meinem Junior College zurückkam, erhielt ich einen Anruf.
„Hallo?“
„Können Sie morgen hier sein und für uns Football spielen?“
„Wer ist denn dran?“
„L.D. Weldon. Ich bin Trainer am Graceland College.“
„Äh … ich weiß nicht.“
„Wissen Sie, eigentlich hatten wir einen Quarterback von einem Junior College angeheuert, aber der kommt nicht auf die erforderliche Punktzahl für seinen Abschluss und steht uns daher nicht zur Verfügung. Wir haben nur noch einen Quarterback auf der Reservebank, also brauchen wir noch jemand anderen.“
„Okay.“ Football machte mir immer noch Spaß. „Rufen Sie mich doch morgen noch einmal an, dann sage ich Ihnen, ob es klappt.“
Am Abend sprach ich mit meinen Eltern. Sie konnten es sich nicht leisten, mich aufs College zu schicken, also ging ich am nächsten Tag zur Bank und beantragte einen Ausbildungskredit, da das Stipendium nicht alle Kosten abdeckte. Als Weldon mich anrief, teilte ich ihm meine Entscheidung mit.
„Okay, dann bin ich morgen da.“
Er legte auf.