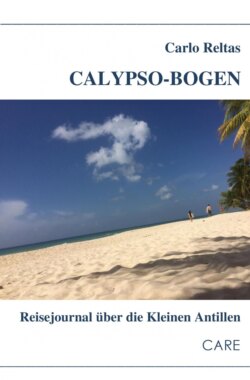Читать книгу Calypso-Bogen - Carlo Reltas - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bonaire – Bunte Welt unter Wasser
Оглавление„So, jetzt will ich’s aber wissen“, erinnert Kosimar ihren Mann an sein Versprechen, als sie am Sonntagmorgen im Flugzeug nach Bonaire sitzen. „Was ist denn nun der Unterschied zwischen den karibischen Niederlanden und der niederländischen Karibik?“ Karl holt tief Luft und versucht zu erklären: „Die Niederländischen Antillen wurden im Oktober 2010 nach diversen Volksabstimmungen aufgelöst. Curaçao und Sint Maarten haben – wie zuvor 1986 bereits Aruba – den Status von autonomen Ländern innerhalb des Königreichs der Niederlande erhalten. Das Königreich besteht seitdem aus vier Ländern: den Niederlanden im engeren Sinne, aus Aruba, Curaçao und Sint Maarten. Die kleineren Inseln Bonaire, Saba und Sint Eustatius, deren Einwohner bei den Referenden gegen die volle Autonomie gestimmt hatten, gelten seitdem als ,Besondere Gemeinden‘ innerhalb der Niederlande im engeren Sinne. Diese drei Inseln bilden also die Karibischen Niederlande. Alle ehemaligen Kolonialgebiete des Königreichs in der Karibik zusammen, also inklusive der autonomen Länder, werden seitdem als niederländische Karibik bezeichnet.“
„Puh“, stöhnt Kosimar, „nach so vielen Spitzfindigkeiten will ich jetzt endlich die karibischen Niederlande ganz real kennenlernen.“ Kaum gesagt, geht dieser Wunsch in Erfüllung. Nach nur 25 Minuten Flug landet die kleine Maschine der Insel Air auf dem Flamingo Airport am Rand von Bonaires „Hauptstadt“ Kralendijk. Das Flughafengebäude ist so pinkfarben wie der Vogel, nach dem er benannt ist. Der Farbton sorgt sogleich für Urlaubsstimmung.
Flamingo Airport
Vom so freundlich wirkenden Airport ist es nur etwa ein Kilometer Fahrt bis zum The Bonarian, K und K’s etwas südlich des Flughafens direkt an der Küste gelegenem Hotel. Bei der dreiminütigen Taxifahrt bekommen die beiden gleich eine Hörprobe des hier gesprochenen Papiamentu. Gustavo, der Fahrer, doziert: „Die Straße vorm Flughafen heißt übrigens Kaya International – Kaya wie Calle auf Spanisch, ausgesprochen ,kaje‘. Wir haben hier viele Wörter mit spanischen Wurzeln.“
Die beiden Ankömmlinge sind gleich vom Komfort und der Eleganz der Anlage angetan. Von der teils fliesen-, teils holzdielengedeckten Terrasse, auf der sie die Begrüßungsdrinks einnehmen, schauen sie hinüber zur Bucht von Kralendijk. Sie zieht sich halbmondförmig weit nach Norden. Hinter dem Hauptort, der zusammen mit seinen Vororten etwa 16.000 der insgesamt zirka 18.000 Inselbewohner beherbergt, erheben sich sanfte Hügel. Vor Kralendijk, dessen Name auf das niederländische Wort für Korallendeich zurückgeht, ist in der Sichel der Bucht die flache und unbewohnte Insel Klein Bonaire zu erkennen. „Schau“, sagt Karl und zeigt auf das Faltblatt mit der Inselkarte. „Sie ist quasi kreisrund und – was wir von hier natürlich nicht sehen können – sie ist unter Wasser ringsherum von einem Korallenriff umgeben. Ein wahres Tauchparadies. Dieses runde Eiland hat sozusagen einen natürlichen Deich, einen Korallendeich.“
Der Hotelmanager muss sowieso in die Stadt. Also nimmt er die beiden in seinem Pick-up mit zum „Korallendeich“. An der Plasa Wilhelmina setzt er sie aus. Der Platz ist nach König Willem-Alexanders Urgroßmutter benannt. Vor dem gelbweißen, im Kolonialstil errichteten Regierungsgebäude herrscht Sonntagsruhe wie in einer holländischen Kleinstadt zur Zeit des Kirchgangs. Das ändert sich nicht, als sie die Uferstraße entlang zu der Häuserzeile mit Geschäften und bunten Restaurants gehen. Die Lokale haben fast alle geschlossen. Lediglich Karel’s Beach Bar macht eine Ausnahme. Ein breiter Steg führt zu einer in der See aufgeständerten Plattform mit Bar. Die Fische, sie kennen keine Sonntagsruhe. Sie tummeln sich in vielen Farben und Größen vor der Plattform wie zum Greifen nah, während die Gäste an ihren Morgendrinks nippen. Ein bisschen Brot, ins Wasser gekrümelt, verstärkt den Andrang. In ihrem umtriebigen Hin und Her lassen sie sich auch nicht von ein paar Kindern und einem Terrier irritieren, die ihnen im türkisfarbenen flachen Wasser in die Quere schwimmen.
Uferpromenade von Kralendijk
Nach ausgiebigem Fischebestaunen schlendern die beiden die Uferpromenade weiter hinauf, vorbei an Palmen, die in der Mittagssonne nur unzureichend Schatten bieten, und an schneeweißen Katamaranen sowie dem Wassertaxi nach Klein Bonaire, die alle ebenfalls der Sonntagsruhe frönen. Auf dem Rückweg kehren sie in einer hellen Creperia ein, wo zwei geschäftstüchtige junge Belgier den Sonntagsbummlern sowohl salzige, als auch süße Pfannkuchen bieten. Die Belgier bestellen nach dem Lunch freundlicher Weise auch das Taxi, mit dem K und K zur Siesta ins Hotel fahren. Hinterm Lenkrad sitzt erneut, als gäbe es sonntags nur einen Fahrer am Korallendeich – der redselige Gustavo.
Er empfiehlt ihnen für den späteren Nachmittag die Playa Palu di Mangel, den „Mandelbaumstrand“, an dem sie auf dem Rückweg zum Hotel vorbeifahren. „Hier ist richtig was los, wie Ihr seht“, sagt er und zeigt auf die lange Reihe parkender Autos am Straßenrand. Und tatsächlich, als K und K ihr „Mittagspäuschen“ beendet haben und am Strand entlangbummeln, finden sie Gustavos Worte bestätigt. Am Anfang nur ein paar Taucher im Sektor Windsock, dann braune Kinder, die im Wasser spielen, ja ganze Familien Einheimischer, die unter den Bäumen am Rand des Strands den Grill angeworfen haben. Manche haben sich für ihr Sonntagsidyll Bretterbuden zurechtgezimmert, vor denen sie speisen – Bonaires Pendant zum Sonntagskuchenklatsch vor der deutschen Gartenlaube. Auf die Familien folgen die Windsurfer und die Scuba Diver. Für jeden ist hier Platz.
Kurz vor der von vielen Möwen bewachten Hafeneinfahrt wird der vorher felsige Strand feinsandiger. „Te Amo Beach“ heißt dieser Ort für Verliebte. Am Rande steht der Food Truck von „Kite City“, wie dieser Platz auch genannt wird, und sorgt für kühle Drinks und Thunfisch-Burger. „In der Tat, hier ist richtig was los. Schön, dass die Bonairer zumindest am Sonntag das Strandvergnügen mit den Touristen teilen“, meint auch Kosimar auf dem Rückmarsch. Wieder am Hotel machen es sich die beiden in einer der palmblattgedeckten offenen Strandlauben des „Bonarian“ bequem. Mit dem Bonaire-Plan auf den Knien, einem Drink an der Seite und dem Sonnenuntergang über dem Meer vor Augen bereiten sie den nächsten Tag vor.
Beim Frühstück am nächsten Morgen kommen sie mit einem deutsch-amerikanischen Ehepaar am Nebentisch ins Gespräch, das ihnen schon am Vorabend aufgefallen war. Von der Premium-Suite am Ende der Anlage waren sie zum Dinner auf der Terrasse herüberspaziert gekommen, tief gebräunt und in lässiger, kostspieliger Eleganz. Teure Schuhe, goldene Uhren und exquisiter Schmuck signalisierten gediegenen Wohlstand. Als die blondierte Dame sie auf Deutsch fragt, woher sie kommen, stellt sich heraus, dass Inge, als die sie sich vorstellt, wie Karl aus dem Emsland stammt, aber schon seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten lebt. Ihr Mann ist gebürtiger Amerikaner, jedoch ebenfalls deutschstämmig. Heute trägt Bernard Bermuda-Shorts und ein weit aufgeknöpftes Hawaii-Hemd. In New York, wo er lange als Generalmanager eines großen Hotels fungiert hat, wird er anders aufgetreten sein. Inzwischen leben sie in Florida am Rande der Karibik. Als Inhaber einer Firma für Hotel-Consulting ist er aber auch viel auf den Karibikinseln unterwegs. „Bonaire ist eindeutig unser Favorit. Hierher kommen wir seit Jahren immer wieder. Wir schätzen die Ruhe hier. Außerdem hat Bernard hier auch in eine Hotelanlage investiert“, erklärt Inge. „Dann müssen Sie ja die Insel wie Ihre Westentasche kennen. Wir wollen heute schnorcheln gehen. Welches der vielen Tauchgebiete würden Sie denn empfehlen“, fragt Karl den professionellen Touristen und Hotelberater.
„Da gibt es für mich nur eine Wahl, die 1000 Steps“, antwortet Bernard, „Rings um Klein Bonaire herum haben Sie zwar ein Tauchgebiet nach dem anderen genauso wie fast durchgehend an der gesamten Westküste. All das zählt zum geschützten Bonaire Marine Park. Aber ich würde zu den 1000 Steps fahren, wenn ich einen Platz stellvertretend für alle sehen wollte.“
„Und wo liegt das?“ will Kosimar wissen. „Sie fahren von Kralendijk die Hauptstraße weiter nach Norden. Am Ende des Stadtgebiets schwenkt die Straße etwas ins Land. Wenn sie wieder durch Dickicht parallel zum Ufer verläuft, ist es der vierte oder fünfte Tauchplatz. Sie sind dann schon auf der Hochküste“, erläutert Bernard. „Wieso heißt der Platz denn 1000 Steps?“ fragt Karl. „Tja, ihr müsst über eine lange geschwungene Steintreppe hinunter an den Kieselstrand. Das sind zwar keine tausend Stufen, aber doch eine ganze Menge. Das schafft ihr schon“, meint Inge lachend.
K und K steigen in den Leihwagen, den Karl am frühen Morgen vom Car Rental am nahen Flughafen geholt hat. Nach einem Abstecher an den Nordrand Kralendijks zu der hübschen Marina des Harbour Village fahren sie noch einmal zur Innenstadt des kleinen Inselhauptorts. Montagmorgen – Shopping ist angesagt. Während Kosimar das überschaubare Angebot in den Läden an der Uferstraße und der parallelen Kaya Grandi sondiert, macht sich Karl im liebevoll eingerichteten Terramar-Museum mit der Historie der Insel vertraut. Am nachhaltigsten beeindruckt ihn das Modell, das Kinder einer örtlichen Schule gebastelt haben. Es zeigt das Profil der Insel und den Weg der Sklavenarbeiter von den Salzfeldern im Süden quer über die Insel zur Siedlung Rincon (Winkel) im Hügelgebiet im Norden. Dort lebten ihre Frauen und Kinder. Am Samstag nach der Arbeit wanderten sie stundenlang nach Norden, um ihre Familien zu treffen und gemeinsam mit ihnen den Sonntag zu begehen. Mit neuem Proviant für die nächste Woche mussten sie schon am Sonntagnachmittag den Rückweg zu den Salzfeldern antreten, wo sie wieder sechs Tage schuften und abends in niedrigen, kargen Hütten hausen mussten.
Aus deutscher Sicht überrascht ein Schwarzweißfoto aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es zeigt ein abgezäuntes Lager, ein Internierungscamp, in dem während des 2. Weltkriegs die Deutschen aus den niederländischen Kolonialgebieten zusammengezogen worden waren. Sie lebten dort jahrelang in Unfreiheit, aber unter vergleichsweise humanen Bedingungen. Heute ist auf der Insel keine Spur des Lagers mehr zu entdecken.
Nach dem Lunch in Karel’s Beach Bar fahren auch K und K in den Süden, zunächst nach Südosten zur Lac Bay an der Atlantikküste. Die Insel ist hier nur um die zehn Kilometer breit. So erreichen sie schon nach wenigen Minuten die Ausläufer eines von Wasseradern durchzogenen riesigen Mangrovengebietes. Bei geführten Kanufahrten kann man hier eine interessante Flora und Fauna erkunden. K und K kutschieren über eine löchrige Nebenstraße zur Spitze der Sorobon-Halbinsel. Von dort blicken sie auf das Mangrovendickicht zur Linken, auf die Bay mit rasanten Windsurfern direkt vor ihnen und auf den Atlantik zur Rechten, von dem eine so kräftige Brise in die Bucht weht, dass Sonnenhüte und Kappen davonzufliegen drohen.
Schon um die Lac Bay herum ist die Insel total flach, erst recht der tiefere Süden. Unterhalb der Bay wird nahezu der gesamte Süden von Salzfeldern, sogenannten Pfannen eingenommen. An der Westküste waren zur Zeit der Salzproduktion durch Sklaven die Lagerplätze der verschiedenen Salzsorten durch farbige Obelisken markiert. Die Kapitäne ankerten jenseits des Riffs vor dem jeweiligen Obelisk. Das Salz wurde in kleinen Booten zu den Frachtern geschafft, indem je vier starke Männer an Bord eines Boots dieses zum Frachter schleppten, und zwar an einem zwischen Schiff und Anlegestelle gespannten Treidelseil entlang.
Leuchtturm
Der erste Obelisk, den die Schiffsbesatzungen zu sehen bekamen, wenn sie vom Atlantik kommend die Südspitze der Insel umrundet hatten, war der orangene Obelisk für die Oranje Pan, zu Ehren natürlich des Königshauses der Oranier. Danach kommen, wenn man der Westküste nach Norden folgt, die Rode, die Witte und die Blauwe Pan – alle weiteren Salzpfannen also mit Obelisken in den Farben der rot-weiß-blauen niederländischen Nationalflagge. Genauso wie den Kapitänen ergeht es auch K und K, als sie im Leihwagen an der Südspitze ankommen. Dort bestaunen sie zwar zunächst den modernisierten Leuchtturm, der leuchtend weiß, aber mit penibel rostbraun angepinseltem Treppenhaus vom kargen farblosen Boden in den stahlblauen Himmel ragt und zu einem der Wahrzeichen der Insel geworden ist. Aber dann sehen sie sie schon, den orangenen Obelisken und davor winzige, gelb angemalte Behausungen – Sklavenhütten.
Sklavenhütten an Oranje Pan
Unter praller Sonne, die in den riesigen Kondensierungsbecken das Wasser verdunsten ließ, floss der Schweiß der Arbeiter. Abends nach getaner Arbeit konnten sie sich in die kargen Hütten zurückziehen, darin aber nicht einmal stehen. Immerhin herrschte hinter den steinernen Mauern eine gewisse Kühle. Ihre Laune besserten die Sklaven – hier an den Salzpfannen nicht anders als auf den Baumwollfeldern der US-Südstaaten – mit ihren Gesängen auf. Einer schildert die Arbeit an den Umladestellen bei den Obelisken und wurde auf der Insel zum Volkslied: „Man pa makutu di Maria“ (Geh Maria mit dem Korb zur Hand). Auf einer Tafel neben dem Obelisken der Oranje Pan wird die Geschichte des Lieds erklärt. Frauen waren es, die auf ihren Köpfen salzgefüllte Körbe über Planken balancierten, die auf Holzböcken im seichten Wasser auflagen und zu den Booten führten. Eine Zeichnung zeigt, wie eine Plankenläuferin am Ufer ihren Rock rafft und niederkniet. Zwei Männer heben ihr den Korb auf den Kopf und helfen ihr auf. „Geh Maria mit dem Korb zur Hand“ singen sie dabei. Die Kapitäne an Bord der Salzfrachter schauten dabei genüsslich zu. Romantisierend schildert einer die Schönheit der Insel mit dem gleißenden Licht auf den in verschiedenen Farben schimmernden Salzfeldern, mit den über den Salzpfannen auffliegenden pinken Flamingos und den singenden Korbträgerinnen auf den Planken der Anlegestelle, die ihm im Gegenlicht des Sonnenuntergangs wie verzauberte Meerjungfrauen vorkamen.
Die Meerjungfrauen sind verschwunden. Aber die langbeinigen Vögel sind noch immer da. „Schau“, sagt Karl und zeigt landeinwärts. „Dahinten steht fast ein Dutzend Flamingos. In dem flachen Salzwasser finden sie ein Biotop mit Algen und anderen Kleintieren vor, das ihnen reichlich Nahrung bietet.“ Die verschiedenen Grade von Salzhaltigkeit ermöglichen das Gedeihen unterschiedlicher Einzeller und Bakterien, was in verschiedenen Farbtönen der Wasseroberflächen resultiert, manche gehen sogar von Pink in Violett über, so die weite Fläche vor den riesigen weißen Salzbergen, die in Höhe der Blauwe Pan zum Abtransport bereit liegen. Die Salzproduktion erlebte zwar nach dem Ende der Sklaverei einen Niedergang. Doch inzwischen, genau seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wird er industriell betrieben. Der jetzige Eigentümer, der amerikanische Konzern Cargill, produziert die verschiedensten Salzsorten, vom Tafelsalz für den Hausgebrauch bis zu Spezialsalzen für die Textil- und Erdölindustrie. Saubere Luft und sauberes Wasser, das trockene Klima und die sanften Passatwinde seien das Geheimnis, so heißt es auf der Cargill-Website, für die Qualität des Bonaire-Salzes und den relativ schnellen Bearbeitungsprozess in den Kondensierbecken – und das gelingt mit nur etwas mehr als 40 Mitarbeitern.
„Guck dir diesen Giganten an“, staunt Kosimar, als sie auf dem Weg nach Norden unter dem riesigen Cargill-Transportband durchfahren. Es schafft die Salze von den weißen Bergen, die hinter der Cargill-Absperrung im rechten Winkel zur Küste hintereinander aufgereiht sind, über die Straße hinüber zum Salz-Pier im Meer, wo ein enorm großer Frachter angelegt hat. „Tja, das ist ein Unterschied zu den Anfängen des Salzexports, als es noch hieß: Geh Maria mit dem Korb zur Hand“, konstatiert Karl. „Statt der kleinen Holzböcke und Holzplanken steht hier jetzt eine lange Reihe riesiger Eisenträger mit einem hunderte Meter langen Förderband obendrauf, über das die Schiffe quasi automatisch beladen werden.“
Den industriellen Fortschritt verbindet Cargill aber auch mit der Pflege der Fauna. Am Rand des Pekelmeers, der natürlichen Lagune an der Südspitze Bonaires, von der das Meerwasser mit Windkraft in die Dehydrierungs- und weiter in die Kristallisierungsbecken gepumpt wird, schirmt die Firma ein Flamingo-Schutzgebiet vor Besuchern ab. Mehr als 2000 der pinken Vögel sollen dort schätzungsweise leben und dazu viele Seeschwalben, Reiher und Pelikane sowie Zugvögel, die hier alljährlich als Saisongäste aufkreuzen. „Da kommen wir natürlich nicht hin. Cargill tut gut daran, den Zugang zu diesem Schutzgebiet zu verwehren. Fahren wir nach Norden zum Goto-Meer. Dort sollen die Flamingos leichter zu beobachten sein“, schlägt Karl vor.
Durch das Villenviertel Belnem, vorbei an ihrem eigenen Hotel The Bonarian sowie am Flamingo-Flughafen, nochmals durch die ruhige Kleinstadt Kralendijk geht die Fahrt nach Norden. „Da wo die Hauptstraße wieder parallel zur Küste verläuft, müssen wir aufpassen. Auf Steinen am Rande der Zugänge stehen die Namen der Tauchplätze, hat Bernard gesagt“, erinnert Kosimar ihren Fahrer. Tatsächlich, am Straßenrand stehen Menschen in Neoprenanzügen und bugsieren Sauerstoffflaschen von der Ladefläche ihres Pick-ups. Zunächst tauchen noch andere Namen auf. „Ah, da muss es sein. Da geht eine Steintreppe runter“, bemerkt Karl. Und wirklich, da liegen links und rechts des Eingangs zum Abstieg jeweils ein gelb bemalter Stein mit der Aufschrift „1000 STEPS“. Sie parken ein.
Tauchplatz 1000 Steps
Im Bogen schwingt sich die ummauerte Treppe aus Naturstein an der Steilküste zum Strand runter. Unten finden sie einen Strand vor, der aus etwas weißem Sand und vielen Korallenstückchen besteht. Die zumeist wie steinerne Cevapcici geformten Stückchen sind porös und leicht wie Bimsstein. Decke drüber – und ein angenehmes Lager im Schatten der Bäume am Rande der Steilwand ist bereitet, nicht so weich wie Sand, aber im Vergleich zu harten und schweren Kieselsteinen eine Schlaraffia-Matratze. Aber die große Offenbarung erleben sie, als sie mit Taucherbrille und Schnorchel ins Wasser steigen. „Es ist einfach überwältigend, so schön!“ prustet Kosimar, als sie nach der ersten Schnorchelphase wieder auftaucht. Schon zuvor haben sie sich mit stummen Fingerzeigen unter Wasser gegenseitig auf die schwimmenden Schönheiten aufmerksam gemacht: Schwarzweißgestreifte Fische, gelbschwarz-gestreifte Exemplare (bei Karl heißen sie BVB-Fans), grünschillernde Schwimmer, eine ganze Horde silbrig-quasitransparenter Sonderlinge, ein tiefblauer Mitternachtspapageifisch und ein Regenbogenpapageifisch, die an dem Bewuchs der Unterwasserfelsen knabbern, ein Seepferdchen, das seinen Schwanz um ein penisartiges Gewächs kringelt, ein Schwarm von Gelbschwanzschnappern. Aber auch die Flora ist eine Augenweide: Schwämme in allen Variationen, darunter die Röhrenschwämme in verschiedenen Farben und natürlich der verzweigte Vasenschwamm (Callyspongia vaginalis). Es war wohl so ein Vasenschwamm, den das Seepferdchen umgarnt hatte.
K und K haben nur im ufernahen Bereich geschnorchelt, wo das flache Wasser türkis schimmert. Da, wo das Wasser tiefblau wird, geht es über die Kante des Korallenriffs in tiefere Regionen, wohin die sauerstoffflaschenbepackten Scuba Diver unterwegs sind. Als sich die beiden Schnorchler in der Sonne aufwärmen, kommt ein Trupp von Neopren-Menschen aus dem Wasser. Sie sprechen Deutsch … aber unterhalten sich weniger über die Schönheiten der Unterwasserwelt als über die technischen Details ihrer Ausrüstung. K und K verschwinden ins Wasser. Unter der Oberfläche sehen sie erneut eine bunte und friedliche Welt. Fische und Flora scheinen in perfekter Symbiose zu leben. Sie sehen keine Jäger. Die Kiemenatmer schwimmen lautlos und gemächlich dahin. Hingebungsvoll mümmeln sie am Korallenbewuchs. Anscheinend sind sie mehrheitlich, wenn nicht alle Veganer.
Als K und K dem Türkis wieder entsteigen – noch ganz begeistert, ja geradezu beseelt von der Schönheit und der Friedlichkeit der Unterwasserwelt – hat sich der Strand inzwischen nahezu geleert. Es ist schon halb fünf Uhr nachmittags. Auch sie packen ihre Sachen zusammen. Schließlich haben sie noch ein Ziel. Sie fahren auf der Hochküste weiter nach Westen. Es geht wieder hinunter. Auf Normalnull-Niveau überqueren sie den Meereszugang zur Lagune Gotomeer. Und dann ist auf einmal Schluss.
Vor dem verschlossenen Tor der BOPEC (Bonaire Petrol Company) müssen sie kehrt machen. Wie Curaçao so profitiert auch Bonaire indirekt von den gewaltigen Erdölvorkommen Venezuelas. Anders als in Curaçao stehen hier jedoch keine Raffinerien, sondern lediglich ein Zwischenlager und eine Umladestation für raffiniertes und nicht-raffiniertes Öl aus Venezuela sowie von den Raffinerien auf Curaçao und Aruba. Hinter dem Zaun befinden sich ein Dutzend riesiger Öltanks sowie einige kleinere. In einer Mischanlage können Blends verschiedener Ölsorten hergestellt werden. Am Pier 1 können Tanker bis zu einer Gesamtlast von 500.000 Tonnen anlegen.
Angesichts der Tankgiganten jenseits der Absperrung treten K und K den Rückzug an. Hinter dem schmalen Meereszugang biegen sie landeinwärts ein und folgen dem natürlichen Kanal, der zum eigentlichen Gotomeer führt. Es geht wieder bergauf. Die Straße gabelt sich, damit sich auf der kurvigen Hügelstrecke die beiden Fahrtrichtungen keine Probleme bereiten. Als sie wieder abwärts fahren, bietet sich ihnen ein malerisches Bild: Im Hintergrund die bis zu 240 Meter hohen Berge des Nordteils der Insel, im Vordergrund inmitten einer grünen Landschaft und auch schon Teil des Nationalparks das 155 Hektar große Gotomeer. Vom Hügel sieht es aus wie ein Binnensee, aber es ist letztlich eine Lagune mit Salzwasser. Hier lebt eine der größten Flamingo-Populationen der Karibik. Als sich die beiden dem See nähern, erkennen sie die pinken Vögel, ein Trio im See schwimmend, andere im flachen Wasser staksend. Am Ostrand des Sees, wo die Straße nach einer Abfahrt vom Hügel die Uferlinie berührt, führt ein kleiner Damm zu einer nahen Insel mit Brutstation. In extrem langsamem Schritttempo rollen die beiden Touristen über den Damm. Am Uferrand schreitet eine Pink Lady einher. Karl macht ein paar Aufnahmen. „Schau mal, welch eine stolze, elegante Haltung. Sie sieht gut aus. Und sie weiß es“, flüstert er, während er an den ein Dutzend Meter entfernten Vogel heranpirscht. Aber die scheue Pink Lady denkt nicht daran, für ihn zu posieren. Ohne Hektik stolziert sie vom Damm hinüber zum Inselufer.
Pink Lady
Auf der Rückfahrt durchqueren K und K das kleine Dorf Rincon, das mit etwa 2000 Einwohnern neben Kralendijk und seinen Vororten die einzige Agglomeration der Insel ist. Den „Winkel“, so die Übersetzung des spanischen Worts Rincón, haben die Spanier 1527 in die Hügel des nördlichen Inselteils gesetzt. An diesem Ort war die erste von Europäern auf Bonaire angelegte Siedlung von See nicht sichtbar und so vor Piraten geschützt. Die von Westafrika zur Insel geschafften Männer, die als Sklaven in den Salinen des südlichen Inselteils arbeiten mussten, wurden zusammen mit ihren Familien hier angesiedelt.
Karl erinnert sich an seinen Besuch im Terramar-Museum. Dort hat er am Morgen ein Inselmodell gesehen, das bonairische Schulkinder gefertigt haben, unter ihnen gewiss auch Nachfahren der Sklaven. Quer über die Insel haben sie darauf den Weg ihrer Vorfahren markiert: Von den Salzpfannen im Süden über den Mittelteil, wo heute in und um Kralendijk die Mehrheit der Insulaner lebt, bis zu den Hütten im „Winkel“ in den Hügeln des Nordens. „Unglaublich“, sagt Karl zu Kosimar. „Diese zirka 30 Kilometer, wenn sie an der südlichsten Pfanne, der Oranje pan, arbeiteten, sind sie am Samstag nach der Arbeit marschiert. Nur, um nach einem Abend mit ihren Familien und einem Sonntagmorgen mit Kirchgang die gleiche Strecke zurückzumarschieren, mit neuem Proviant für eine neue Arbeitswoche. Unglaublich!“
Die beiden Touristen fahren den Rückweg nach Kralendijk bequem im Leihwagen. Einige Kilometer hinter Rincon führt er an der rauen, windigen Nordostküste vorbei. Zwischen 40 und 50 Prozent ihrer Energie beziehen die Bonairer inzwischen aus den dort installierten Windkraftanlagen. Das Ziel der Inselregierung ist es, den Strombedarf auf mittlere Sicht zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie zu decken. Solarkraft und Biodiesel sollen ebenfalls dazu beitragen.
Zum Abschied von Bonaire haben sich K und K ein Restaurant mit verheißungsvollem Namen ausgewählt. Es heißt „It rains fishes“, liegt direkt an Kralendijks Uferstraße mit Blick auf die See und macht sie, was Qualität der Speisen und Freundlichkeit des Services anbetrifft, rundherum zufrieden. Als sie am nächsten Morgen endgültig vom Divers Paradise, wie es wahrheitsgemäß auf jeder Autoplakette von Bonaire steht, Abschied nehmen und vom Flamingo Airport abheben, schwärmt Kosimar: „Ich habe noch immer die prächtigen Farben der Fische bei den 1000 Steps vor Augen. Aber weißt du: Eigentlich müssten wir nach Curaçao und Bonaire mit Aruba auch noch zur dritten der niederländischen ABC-Inseln.“ „Ich weiß nicht“, erwidert Karl. „Es mag übertrieben sein. Aber nach allem, was ich gehört habe, locken dort praktisch nur ein durchgehend langer Strand an der gesamten Westküste, viele Hotelburgen und vor allem viel Remmidemmi für Partygänger. Danach steht mir nicht unbedingt der Sinn. Da lob ich mir doch unser Bonaire. Statt Jubel, Trubel, Heiterkeit hat’s dort Ruhe, Schönheit und Beschaulichkeit!“