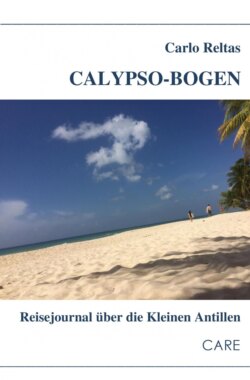Читать книгу Calypso-Bogen - Carlo Reltas - Страница 12
Trinidad – trübe Geschäfte mit Souldog
ОглавлениеTrinidad hat einen Ruf wie Donnerhall in puncto Kriminalität. Karls Skipper auf dem Törn zu den Tobago Cays hatte seinen Liegeplatz in Port of Spain längst aufgegeben, weil er sich im heimischen Bottrop sorgte, ob er seine neu eingebaute Kücheneinrichtung noch in seiner Kombüse vorfinden würde, wenn er nach ein paar Wochen im deutschen Sommer auf seine Yacht in der Karibik zurückkehren würde. Im Reiseführer wurde vor bestimmten Vierteln von Trinidads Hauptstadt als No-go-areas für Touristen gewarnt. Und mit Schaudern las Karl vom sportlichen Spross einer der reichsten Familien des Inselstaats, der nach einer fabelhaften Karriere als Cricket-Star im hohen Alter an den Folgen von Verletzungen starb, die ihm ein Einbrecher beim Überfall auf seine Luxusvilla zugefügt hatte. So stand es nicht zu erwarten, dass es ausgerechnet ein scheinbar zwielichtiger Fischer mit dem mafiös klingenden Namen Souldog sein würde, der ihn in seinem Glauben an das Gute im Menschen bestärken würde.
Karl ist an diesem Morgen im April in aller Herrgottsfrühe von Piarco International abgeflogen, dem Flughafen in der Ebene südöstlich von Port of Spain. Von Curaçao kommend, war er erst am Vorabend dort gelandet, war gar nicht erst in die Hauptstadt gefahren, sondern war in einer Pension für Umsteiger zwischen zwei Flügen in der Nähe des Flughafens abgestiegen und hatte sich die Zeit bis zum Sonnenuntergang mit einem Spaziergang zwischen grünen Feldern vertrieben. Jetzt sitzt er in einer Maschine von „Verlässt die Insel irgendwann“, dem Spottnamen für LIAT (Leeward Islands Air Transport aka Leave Island Any Time) nach Saint Lucia. Die kleine zweimotorige Propellermaschine fliegt von der West-Ost-Startbahn in die Morgensonne und biegt bald nach Norden ab. Unter sich erkennt er das scheinbar unendliche Grün der Wälder an den sanften Südhängen der Northern Range, des Mittelgebirges, das sich hundert Kilometer von West nach Ost an der Nordküste Trinidads entlangzieht.
Irgendwo dort im urwald-ähnlichen Naturschutzgebiet hat ihm und seinem norwegischen Freund Kent Ove die aparte Ornithologin Olivia die seltenen Vögel der Insel im Blättergewirr der Baumveteranen gezeigt. Er erinnert sich mehr an ihre kunstvoll geflochtene Frisur als an ihre gefiederten Freunde. Das ist nun 16 Monate her. Es war im Dezember. Und in der Lounge des Asa Wright Nature Centre inmitten des tropischen Regenwalds stand eine vorweihnachtlich geschmückte europäische Fichte. Das Flugzeug überquert den Kamm der Northern Range. Zum schmalen Küstenstreifen fällt das Gebirge steiler ab. Das Blau des Karibischen Meers folgt auf das Grün der Wälder. Am Ufer ist das Weiß der Brandung zu sehen. Dort unten in den Wellen am Strand von Las Cuevas hat er ihn an einem Adventssonntag kennengelernt, seinen „Freund“ Souldog.
Es war ein warmer, aber trüber vierter Advent. Die Wolken wollten sich gar nicht lichten. Gleichwohl stellten sich unten am Strand die sonntäglichen Badegäste ein, wie Karl von seiner Beach Lodge auf dem Hügel beobachten konnte. Nach und nach füllte sich der Parkplatz. „Wo kommen die wohl alle her?“ fragte sich der Neuankömmling, der sich erst am Vorabend im Taxi vom Flughafen zunächst in die Hauptstadt und dann weiter über eine kurvige Straße etwa 30 Kilometer am Nordhang des Küstengebirges hat entlangfahren lassen. Der feinsandige Strand von Las Cuevas ist bei Familien recht beliebt, auch wenn die Anfahrt aus der Hauptstadt hügelaufwärts, hügelabwärts und herum um zahlreiche Felsvorsprünge der North Range führt. Aber gerade bei wechselhaftem Wetter bietet Las Cuevas (zu Deutsch: Die Höhlen) den Vorteil, dass man sich bei Regen unter die Felsen am Ufer zurückziehen kann.
Las Cuevas Bay on a Rainy Day
Karl hatte sich unter die Sonntagsausflügler gemischt. Er genoss das Schwimmen und das Spiel in der Brandung. Es fing zwar an zu nieseln, aber das spielte ja keine Rolle – nicht für die Badenden und nicht für die jungen Burschen, die am Strand Fußball spielten. Als langsam die Flut kam, machten sich ein paar Fischer an ihren Booten zu schaffen. Es waren nur zwei, die versuchten, ein auf dem Sand liegendes Boot wieder ins Wasser zu bugsieren. Souldog war einer von ihnen. Aber das konnte Karl noch nicht wissen. Er kannte noch nicht einmal diesen Namen. Ein dritter kam hinzu, um ihnen zu helfen. Zwei schoben an der rechten Seite, einer an der Linken. Geradeaus ging noch gar nichts. Mal schoben sie leicht nach links, dann wieder nach rechts. So ging es Stück für Stück und immer wieder schräg vorwärts. Karl gesellte sich zu dem Bärtigen an der linken Seite und fasste mit an, fasste an die Ruderpinne, drückte das Boot, vereint mit den Kräften der drei anderen, nach vorne. Da rannten auch schon die schmächtigen Fußballspieler herbei und schoben von hinten.
Allmählich kam das Boot etwas mehr in Bewegung. Schon klatschte Wasser an die vorderen Seitenwände, aber hinten lag der Kiel noch auf. Karl rutschte, verlor einen Moment den festen Stand im Sand, während ihm das Wasser schon bis zum Oberschenkel stand, dann fasste er wieder Tritt. Noch ein gemeinsamer Ruck auf Kommando seines Vordermanns – und das Boot schwamm im freien Wasser. Die beiden Fischer schwangen sich an Bord und ruderten hinaus. „Thank you, thanks a lot“, riefen sie und winkten. Sie wussten, wer den meisten Druck gemacht hatte – nicht die nicht die Teenager-Hänflinge, sondern der Mann im Running-Shirt.
Einen der winkenden Fischer sollte Karl schneller wiedersehen als erwartet. Für den nächsten Morgen hatte er den Trip in die Hauptstadt von Trinidad und Tobago geplant. Da er seine letzten TT-Dollar dem indischstämmigen Taxifahrer ausgehändigt hatte, der ihn am späten Samstagabend durch die Dunkelheit nach Las Cuevas chauffiert hatte, stand er jedoch ohne ausreichende Landeswährung da. Anstatt eines Kredits, den sie auf die Hotelrechnung hätte setzen können, gab ihm die Dame im Sari an der Rezeption ein paar Wertmarken für den Bus. Er müsse die Straße nur ein paar Schritte den Hügel runter gehen. „Dort ein Stück hinter der Zufahrt zum Strandparkplatz hält auf der Gegenseite der Bus nach Port of Spain“, erklärte die Frau des indischstämmigen Hotelbesitzers. Wann der Bus kommen würde, konnte sie allerdings nicht genau sagen. „Das hängt davon ab, wann der in Blanchisseuse losfährt und wie oft er unterwegs halten muss“, gab sie zu verstehen.
Karl schlenderte den Hügel hinab. Die Wolken des Vortags waren verschwunden. An diesem Montagmorgen strahlte die Sonne. Schließlich hatte es am Sonntag genieselt und dann auch noch heftig geregnet. Der Rasen des Fußballplatzes, auf den er vom Busstopp durch frisch blühende Rispen alter Palmen schaute, dampfte sogar ein wenig. Hier am Rande des tropischen Regenwaldes spross es an allen Ecken. Hinter den grün überwucherten, gemauerten Sitzreihen am anderen Ende des Sportplatzes erkannte er die Straße, die hier nach einer landeinwärts führenden Rechtskurve leicht den Hügel ansteigt, um dann wieder links im Palmendickicht zu verschwinden auf dem Weg zum nächsten Küstenort Blanchisseuse. Dort aus dem grünen Hain kam immer wieder ein Fahrzeug, ein klappernder Kleinlaster, ein knatterndes Motorrad, aber nicht der ersehnte Bus nach Port of Spain. Inzwischen hatte er Gesellschaft bekommen, zwei mit großen Korbtaschen ausgestattete Frauen, die ihn höflich grüßten und dann munter weiter in einem ihm unverständlichen Kauderwelsch aus Englisch und Spanisch miteinander plauderten. Allmählich wird Karl ungeduldig. Da kam ein bärtiger Typ aus der Einfahrt der Fischer-Kooperative hervor, die kurz vor der Straßenkurve liegt. Gemächlich ging er über die asphaltierte Fahrbahn hinüber zur Sportplatzseite.
„Hi, how are you doing?“ fragte er Karl, der einen der Fischer erkannte, mit denen er am Vortag seinen Spaß beim Bootanschieben hatte. „Mir geht’s prima. Ich fahr‘ mit dem Bus in die Hauptstadt und hab‘ dazu einen blauen Himmel. Und wie geht’s selber?“ Der Bärtige antwortete nicht, steckte sich stattdessen eine Zigarette an und bietet auch Karl eine an. Der dankte und bekannte, Nichtraucher zu sein. „Sag mal, willst du wirklich mit dem Bus fahren? Da kannst du lange warten. Nimm doch ein Sammeltaxi. Das geht schneller“, sagte der Fischer schließlich nach einigen genießerischen Zügen. „Das mag sein. Ich habe auch schon eins vorbeifahren sehen. Aber ich muss mit dem Bus fahren. Ich hab‘ keine TT-Dollar mehr und muss mir in Port of Spain welche aus einem ATM ziehen. Für den Bus hat mir die Wirtin der Lodge drei Wertmarken gegeben“, erklärte er dem paffenden Fischer. „Weißt du was, ich kann dir ein paar Dollar geben“, sagte daraufhin Karls sonnengegerbter Gesprächspartner. Er griff in die Tasche seines Arbeitsanzugs, holte ein paar Scheine hervor und blätterte Karl einen Zehner und zwei Einer in die Hand. Der war ganz verdattert. „Toll, ich bring‘ sie dir heute Abend zurück. Wo finde ich dich?“ Sein Kreditgeber reagierte ganz tiefenentspannt: „Das hat keine Eile. Kannste mir auch morgen geben. Komm auf das Gelände der Kooperative und frag einfach nach Souldog!“ „Ist das dein Name?“ fragt Karl verblüfft nach. „Yep! Oh, look! There’s a taxi comin‘.“ Sagte es und schlurfte wieder hinüber zu seinen Kollegen in der Kooperative.
Der japanische Kleinbus hielt und die Schiebetür in der Mitte wurde aufgeschwungen. Heraus sprang ein junger Typ mit einem dicken Portemonnaie in der Gesäßtasche. Den beiden mit Karl wartenden Frauen öffnete er die Tür zur Vorderreihe neben dem rechts sitzenden Fahrer. Für Karl klappte er, nachdem er ihn nach seinem Fahrtziel gefragt hatte, die Rückenlehne des äußeren Sitzes der Mittelreihe zurück, so dass dieser auf die hintere Sitzbank krabbeln konnte. Er selber nahm wieder in der mittleren Reihe Platz, zog die Tür zu. Und schon brauste der Fahrer wieder los. Weiter ging seine eilige Fahrt auf der linken Straßenseite. Der junge Schaffner drehte sich zu Karl um. Der hatte ja von Souldog erfahren, dass der Fahrpreis zwölf TT-Dollar beträgt, und hielt seine abgezählten Scheine hin. Der Kondukteur steckte Karls einzige TT-Barschaft ein und wandte sich den beiden Frauen auf der Vorderreihe zu. Kaum hatten sie ihm das Fahrgeld über ihre Schultern gereicht, musste er schon wieder rausspringen. Drei Kurven hinter der Cuevas Lodge hatte der Fahrer abrupt gehalten. Mitten in der Landschaft zwischen Palmen und anderem wuchernden Grün stand Bob Marley am Straßenrand. Zusammen mit seinen vier bis fünf Jahre alten Zwillingen bestieg er den Küstenstraßen-Expressbus. Vor Karl, der wegen des weitest möglichen Fahrtziels ganz nach hinten verbannt war, saßen nun neben dem Kassierer der dunkelhäutige König des Reggaes und sein Nachwuchs, zwei hübsche milchkaffeefarbene Rangen, die sich brav den Fensterplatz hinter dem Fahrer teilten.
Doch die Reisegesellschaft war noch nicht komplett. Am nächsten Stopp wartete Fidel Castro. Respektvoll verzog sich der junge Geldeintreiber zu Karl auf die Rückbank und überließ seinen Platz neben Bob Marley dem graubärtigen Kubaner im marineblau-weiß gestreiften Polohemd. Sogleich begann dieser eine angeregte Unterhaltung mit dem Rastalockenkopf im roten T-Shirt zu seiner Rechten. Im nächsten größeren Ort Maracas an der gleichnamigen Bucht stieg der beredsame, soigniert wirkende Herr bereits wieder aus. Ein stiegen zwar weniger prominente Gäste, dafür blieben sie aber für den Rest der Strecke an Bord.
Nach einigem Geschaukel in den Kurven der North Coast Road bog der Fahrer schließlich in die Saddle Road ein, die in der Tat wie ein Sattel nördlich der Hauptstadt einen weiten Bogen um einige Gebirgszüge herum beschreibt. Bald schon durchquerte der Fahrer die ersten Vororte. Erst in den schmalen Gassen des Stadtzentrums verminderte er sein Tempo. In einer engen Einbahnstraße war Endstation. Karl wurde sich dessen erst bewusst, als auch die letzten Fahrgäste ausstiegen und er bemerkte, dass der Kleinbus nach zweimaligem rechtwinkligem Abbiegen bereits wieder in Gegenfahrtrichtung stand. Schnell sprang er raus. Er befand sich in einer trubeligen Gasse, wo Einkäufer hektisch von einer Seite zur anderen liefen und Lastenträger mit nackten Oberkörpern Säcke in einen Laden schleppten. Er wandte sich südlich in Richtung Hafen und stand nach etwa 200 Metern auf dem Unabhängigkeitsplatz, direkt vor der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis.
Der Independence Square ist in Wirklichkeit ein langgestreckter Boulevard mit einer begrünten und gepflasterten Promenade in der Mitte. Der Platz vor der kleinen katholischen Hauptkirche ist nicht gerade unbefleckt, auch wenn auf den mit schwarzen Müllsäcken ausgekleideten, voluminösen grünen Abfallbehältern in großen Lettern KEEP THE PROMENADE CLEAN steht. Von der Kathedrale, die den Platz am östlichen Kopfende abschließt, wanderte Karl zwischen Müßiggängern und Konsumenten mit Plastiktüten und Einkaufsrollwägelchen an den Platanenreihen des Squares entlang. Er schaute mal kurz in die New City Mall hinein. Aber sie ist von bescheidenem Ausmaß und weckte sein Interesse nicht sonderlich. Am besten gefiel ihm noch der karnevalesk bunte Weihnachtsbaum hinter dem Eingangsgitter.
„Wo eine Mall, da auch ein Geldautomat“, sagte sich der bargeldlose Tourist. Und richtig. Neben dem Excellent City Centre stieß er auf eine Scotia Bank. Als er wieder auf den belebten Boulevard trat, plagte ihn dann doch eine gewisse Unruhe – nämlich die Furcht vor Taschendieben, obwohl er sich geschworen hatte, nicht allzu viel auf den üblen Leumund der Stadt zu geben. Bis zum Ende des Boulevards hielt er sich und seine frisch gefüllte Börse aus jeglichem Gedrängel heraus, was zur Mittagszeit im Herz der Hauptstadt gar nicht so einfach war. Dennoch brachte der Argwöhnische seine Barschaft ungeschmälert bis zum International Waterfront Centre, wo der Independence Square auf die am Wasser entlang führende Wrightson Road stößt. Auf dem Platz am Wasser steht der berühmte „Frühstücksschuppen“.
Am ursprünglichen Breakfeast Shed hatte die Sozialarbeiterin Audrey L. Jeffers Gratismahlzeiten für bedürftige Schulkinder angeboten. 1926 war das. Diese gute Idee machte Schule. Bald gab es solche Schuppen in mehreren Orten auf Trinidad und auch auf Tobago. Irgendwann waren es dann auch nicht mehr nur Werke der Barmherzigkeit, sondern kommerziell betriebene Imbissstuben. Auch am Hafen gab es so einen Shed, ein Stück westlich vom jetzigen Standort. Dockarbeiter und andere Leute mit wenig Geld in den Taschen kamen dorthin für ein preiswertes Frühstück und einen billigen Lunch. Der neue Breakfeast Shed ist ein Kind der nuller Jahre und schnieke. White Collar Workers aus den nebenan stehenden Hochhäusern des Waterfront Centres und aus der City gehen hier ein und aus ... und natürlich Touristen wie Karl.
International Waterfront Centre in Port of Spain
Der Waterfront-Gebäudekomplex selber, ein Leuchtturmprojekt des Stadtentwicklungsplans Vision 2020, ist 2009 fertiggestellt worden. Seitdem ist es „chic“, im neuen Schuppen zu essen, wobei Schuppen natürlich eine Untertreibung ist. Unter dem Dach des offenen Rondells stehen propere Holzbänke und -tische. Rundherum am Außenrand des Rondells sind die Küchen der diversen Speisenanbieter aufgebaut: Cuisine Creole steht bei ihnen allen auf der Karte. Für Karl war es zu spät für das Frühstück und zu früh für den Lunch. An einem Saftstand, wo alle erdenklichen tropischen Früchte ausgepresst werden, ließ er sich einen Passion Fruit Juice kredenzen. Und dann genoss er, was alle Shed-Besucher neben dem Essen hier so schätzen, den entspannenden Blick auf das Hafentreiben und das Karibische Meer. Nebenan ein paar Stufen tiefer gehen die Fähren nach Tobago ab. Dort unten flanierten Spaziergänger über die Uferpromenade.
Der Flaneur Karl setzte seinen Erkundungsgang in Richtung von Newtown fort, dem neuen Szeneviertel. Sein Taxifahrer hatte ihn am Samstagabend dort bei seiner Hauptstadtdurchquerung auf dem Weg vom Flughafen zur Nordküste vorbeigefahren. Im Vorbeirauschen war ihm die Schickeria im Schein bunter Lampen auf der Terrasse des Town aufgefallen. Diese Location am Cipriani Boulevard steuerte er nun an. Unterwegs schlich er in praller Sonne an den langen Mauern des riesigen Lapeyrouse-Cemetery entlang. Die Inschrift in der Nähe des Südtors dieses bald 200 Jahre alten Friedhofs munterte ihn nicht gerade auf:
Stop, traveler, e’er you go by.
So are you now, so once was I.
As I am now, soon you will be.
Prepare yourself to follow me.
„Einen Teufel werde ich tun, hier zu verweilen“, brummte Karl vor sich hin und beschleunigte instinktiv seinen Schritt. Beim Lunch auf dem Freisitz des Town fand er schnell seine Lebensfreude wieder. Allerdings waren der Trubel und die Saturday night party people verschwunden, die er bei seiner Taxipassage bestaunt hatte. Außer ihm saßen auf der Veranda nur zwei Paare, die hier ihr Mittagsmahl einnahmen. Der Boulevard gab sich an diesem Mittag wie eine Vorstadtstraße, die die Cipriani letztlich ja auch ist. Gegenüber dem Town verströmt eine blauweiße, hölzerne Villa mit überdachten Veranden vor beiden Etagen eine gediegene Südstaatenatmosphäre. Ab und an trat jemand aus dem Restaurant hervor, mal ein Anzugträger mit Dreitagebart, mal eine dezent geschminkte, elegante Dame. Neugierig geworden, ging Frischluftfanatiker Karl nach seinem leichten Mahl dann doch mal hinein. Und da saßen sie in einem weiten, halb abgedunkelten Raum, die pretty people von Port of Spain und speisten bei Weißwein und Aircondition.
Von den pretty people war es nicht weit bis zu den prächtigen Bauten der Glorreichen Sieben. Als Karl aus dem dunklen Zombie-Ambiente des Town-Innenraums wieder ans Tageslicht getreten war, musste er sich nur nach links wenden, die amerikanische Botschaft passieren und noch um zwei Ecken gehen – und schon war er bei ihnen angelangt, den Magnificent Seven. Die Sieben sind eine Reihe von pompösen Villen, ja Palästen an dem oberen Teil der Maraval Road, da wo die Ostseite unbebaut ist. Alle Nobelbauten an der Westseite schauen hinüber auf die riesige Grünfläche der Queen’s Park Savannah. Staunend, hingerissen schritt Karl auf der Maraval, die in dieser Monopoly-Welt eigentlich Parkstraße heißen sollte, an den Magnifizenzen entlang.
Als zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts das Land gegenüber dem schon bestehenden Queen’s Park in sieben Grundstücke parzelliert worden war, hatte man drei für öffentliche Bauten vorbehalten und vier unter reichen Einheimischen versteigert. In der attraktiven Parklage entstanden innerhalb weniger Jahre sieben Bauten ganz unterschiedlichen Stils. Die sieben Perlen sind das Queen‘s Royal College, der anglikanische Bischofssitz Hayes Court, das Mille Fleurs genannte Haus eines Bürgermeisters, die Villa eines Kakaoplantagenbesitzers mit dem Namen Ambard’s House nach dem Erstbesitzer, der Palast des katholischen Erzbischofs, die an venezianische Paläste erinnernde Whitehall eines weiteren Kakao-Barons sowie schließlich Stollmeyer’s Castle, das sich der deutschstämmige Industrielle Charles Fourier Stollmeyer hatte bauen lassen, der damalige Asphaltkönig von Trinidad.
Jedes dieser Häuser hat seine eigene Geschichte. Der Ruhm seines berühmtesten Schülers, des Nobelpreisträgers von 2001, V.S. Naipaul, färbt auch auf das Queen’s College ab, das am Anfang der Reihe durch seinen 20 Meter hohen Glocken- und Uhrturm in der Mitte des roten Gebäudes denen Hayes Court sind die beiden zur Straßenseite hervorstehenden Giebel. Beim danebenstehenden Mille Fleurs ist dies der sechseckige Erker. Das vierte Haus, das ursprünglich Ambard’s House hieß, wurde 1940 vom Geschäftsmann Timothy Roodal gekauft, dessen Enkelin Yvonne Morgan das Haus fortan „Roomor“ nannte. Was wie ein Gerücht raunt (rumour!), ist in Wirklichkeit die Kombination der Nachnamen ihres Vorfahren und ihres eigenen. Roomor ist als einziges der Häuser noch in Privatbesitz und verbreitet - halb verborgen hinter Bäumen und mit seinen schnörkeligen schmiedeeisernen Geländern an den rundum laufenden Balkonen - noch immer den „diskreten Charme der Bourgeoisie“, wie Luis-Buñuel-Fan Karl in sein Notizbuch schrieb.
Magnificent Seven I: Erzbischöfliches Palais
Der Hang zu Pracht kommt natürlich auch in dem Erzbischöflichen Palais aus rotem Granit und irischem Marmor zum Ausdruck. „Der Clou des neuromanischen Baus mit vielen Bögen“, so notierte der deutsche Stadtwanderer, „ist der viereckige Turm, den an seiner südöstlichen Ecke ein achteckiger Erkerturm ziert, der den Hauptturm um ein oben mit Zinnen besetztes Turmzimmerchen überragt.“ Der sechste und größte Bau in der Reihe, die Whitehall, hat in seiner wechselvollen Geschichte unter anderem als Kulturzentrum des British Council und als Regierungssitz der Kolonialherrschaft sowie bis 2009 auch als Premierminister-Amtssitz des unabhängigen Staates Trinidad und Tobago gedient.
Magnificent Seven II: Stollmeyer’s Castle
„Das letzte Haus in der Reihe setzt dem Ganzen die Krone auf, zwar nicht wegen des Bauherrn, sondern wegen des architektonischen Vorbilds“, kommentierte Karl in seine Kladde, nachdem er lange und dabei fassungslos, ja fast ungläubig Stollmeyer’s Castle betrachtet hatte: Ein schottisches Schlösschen in den Tropen, ein Teil von Balmoral Castle, dem Sommersitz der Windsors, nachgebaut auf dem Terrain einer ehemaligen Plantage. Die Stollmeyers hatten ihren als Plantagenbesitzer aufgebauten Wohlstand durch den Export von Asphalt aus dem Pitch Lake (Pech-See) im Südwesten der Insel gemehrt. Importierte blassgelbe Ziegel im Wechsel mit graublauen einheimischen Kalksteinen für die Verzierungen an Kanten und um Fenster herum, Türme und Zinnen schaffen ein geradezu märchenhaftes Architektur-Kleinod, passend zum damals fabelhaften Reichtum des Klans. Beides, die Rechte am Asphalt-Abbau im Pitch Lake und das denkmalgeschützte Gebäude, befindet sich mittlerweile in staatlicher Hand. Siebzehn Jahre, nachdem die Familie ihr Castle verkauft hatte, starb eines der berühmtesten Mitglieder des Klans 1989 unter tragischen Umständen. Jeff Stollmeyer, Captain des Cricket-Teams der West Indies in den 50er Jahren sowie Senator und hoher Cricket-Funktionär in den 70ern, erlag im Alter von 68 Jahren in einem Krankenhaus in Melbourne (Florida) den Verletzungen, die ihm ein Einbrecher in seinem Haus in Port of Spain zugefügt hatte.
Pracht und Kriminalität, Reichtum und Elend liegen auch in Trinidad nah beieinander, stellte der Flaneur auf seinem weiteren Weg fest. Nachdem Karl die Weite der Queen’s Park Savannah durchquert und kurz auf die große Tribüne Grand Stand an deren Südrand geschaut hatte, wo sich während Trinidads Karneval das Auge des Sturms aus Calypso-Musik und Leidenschaft befindet, sah er auf der stadteinwärts führenden Straße mit ihren vielen schicken Rechtsanwaltskanzleien einen „Penner“ auf dem Gehsteig liegen. Das unschöne Wort hatte dort seine Berechtigung. Der Mann in T-Shirt und Shorts krümmte sich auf einer Pappunterlage am Hausrand in Embryo-Stellung und gab keinen Laut von sich. Er schlief oder döste zumindest. Neben ihm lagen eine Umhängetasche und ein verknoteter grüner Müllsack mit seinem Hab und Gut.
Quietschgrün ist auch das zweistöckige Holzhaus an der nächsten Ecke der Dundonald Street, ein Solitär aus kolonialer Vergangenheit mit seinen geschnitzten Zierleisten am Giebel und Verandadach, seiner mit schmiedeeisernen Gittern bewehrten halbhohen Mauer am Gehsteig und den Palmen im kleinen Vorgarten. Durch ein kunstvoll geschmiedetes Tor zwischen zwei grünen Steinpfosten kann man eintreten in ein Boardinghouse.
Doch Karl wollte die Nacht nicht in der Hauptstadt verbringen, sondern zurück an die Nordküste. Auf dem Weg an den Hafen und zum Busbahnhof begegnete er noch dem „Prince of Port of Spain“. Er steht auf einer Erdkugel, hebt sein rechtes Bein, um Schwung aufzunehmen, und holt mit einer Keule zum Schlag aus. Es ist der 1969 geborene Cricket-Weltstar Brian Charles Lara, dem seine Landsleute schon zu Lebzeiten hier auf dem westlichsten Teil des Independence Square ein Denkmal errichtet haben. Der begnadete Batsman (Schläger) hält mehrere Weltrekorde. Überhaupt pflegt der Inselstaat den Stolz auf seine Sportler. In Laras Sichtweise vor dem höchsten Gebäude der Stadt, dem 120 Meter hohen Büroturm des Waterfront Centre, prangt ein Relief mit sportlichen Motiven und der Inschrift „Trinidad & Tobago – Olympic Medalists“: Eine andere Tafel an diesem Gebäudekomplex ruft auf zu gemeinsamen Anstrengungen. „Trinidad and Tobago – one Nation. Discipline, Production, Tolerance, Together we aspire, together we achieve.”
Die starke Verbundenheit zumindest zwischen den beiden Inseln des Staates konnte Karl mit eigenen Augen verfolgen. Für einen zweiten Passionsfruchtsaft hatte er sich nochmals ins Rondell des Breakfeast Shed gesetzt. Es war zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. Aus den Büros kamen fortwährend Frauen und Männer in business wear und bestiegen unten die Schnellfähren von Trinidad nach Tobago. Ein wesentlich gemischteres Publikum sammelte sich am nahen Busbahnhof, wo sich gegen fünf Uhr auch Karl einfand. Er ertappte sich dabei, wie er drei Frauen anstarrte, die sich unter die Wartenden mischten, eine Mutter und zwei Töchter, alle drei mit extrem hervorstehenden Augen, die fast aus den Augenhöhlen zu treten drohten. Es fiel ihm schwer, seinen Blick von den Bemitleidenswerten zu lösen. Ein Betreuer führte sie zu der richtigen Warteschlange.
Die im Fahrplan angegebene Abfahrtszeit seines Busses war längst verstrichen, so dass Karl sich fragte, ob er vielleicht in der falschen Schlange stünde, obwohl an der Parkbucht, wo er wartete, unter anderem sein Fahrtziel Blanchisseuse angegeben war. Aber alle ankommenden autocars hatten andere Destinationen. Sein Vordermann in der Schlange, der in einen nahen Vorort wollte, wusste auch nichts Genaues über die Verbindung zur Nordküste. Karl erkundigte sich am Informationsschalter. Zu seiner Verwunderung erhielt er dort von einer jungen Frau die Auskunft: „Heute fährt kein Bus mehr nach Las Cuevas!“ Offenbar war er dem in der Dritten Welt nicht seltenen Phänomen zum Opfer gefallen, dass Busse nicht nur verspätet, sondern öfters auch leicht verfrüht abfahren, wenn sie ziemlich voll sind. „Und was soll ich jetzt tun?“ fragte er die Dame hinter der Glasscheibe verzweifelt. Ohne Umschweife bekam er eine klare Ansage: „Gehen Sie zur George Street und nehmen Sie ein Sammeltaxi!“
Karl ahnte, was mit der George Street gemeint war. Ganz wohl wurde ihm beim Gedanken an diese lebensvolle und schmutzige Nebenstraße des Independence Square nicht. Wenn er sich nicht täuschte, war er dort am Morgen ausgestiegen. Vom Busbahnhof in der Nähe der Wasserfront zog er hinüber zum Boulevard, durchquerte das feierabendliche Menschengewimmel auf dem Square und bog in die nicht minder prall gefüllte George Street ein. Dieses Viertel nordöstlich des Platzes wird Touristen nicht gerade zum Besuch empfohlen. Deutschlands Auswärtiges Amt rät sogar explizit vom Gebiet östlich der Henry Street ab. Die George verläuft parallel zur Henry – zwei Straßen weiter östlich. Karl kannte diese konkrete Warnung nicht, aber in dieser ärmlichen Umgebung fühlte er sich mit seinem gerade am Morgen frisch gefüllten Portemonnaie nicht wirklich sicher. „Wo um Himmels Willen ist denn hier der Abfahrtspunkt fürs Sammeltaxi nach Blanchisseuse?“ fragte er sich. Am Morgen hatte er gesehen, dass der Kleinbus, nachdem mit ihm auch alle anderen Passagiere „von Bord“ gegangen waren, die enge Straße zunächst leer weiter hochgefahren war. Der Einstiegspunkt musste also an einer der nächsten Ecken sein.
An der Ecke George und Prince Street stellte Karl sich auf die verdreckte Bordsteinkante und schaute sich um. In dem zweistöckigen Eckhaus schräg gegenüber war unten ein rotgestrichener asiatischer Supermarkt mit Gittern vor dem Schaufenster und der Eingangstür. Im ersten Stock waren unverputzte graue Mauern und wenige Fenster zu sehen. Auf der Kreuzung herrschte ein Kommen und Gehen. Nachdem er eine ganze Weile vergeblich nach einem Kleinbus Ausschau gehalten und schon eine Hotelübernachtung in der Hauptstadt erwogen hatte, fragte Karl einen dunkelhäutigen älteren Herrn mit Gehstock: „Können Sie mir sagen, wo hier die Maxi-Taxis zur Nordküste abfahren?“ Der grauhaarige Farbige wies mit seinem Stock auf die andere Straßenseite. Tatsächlich, dort warteten einige mit Einkaufstaschen bepackte Frauen auf dem Gehsteig. Karl stand auf der falschen Straßenseite. Der bei hereinbrechender Dunkelheit nervös gewordene Deutsche hatte einen Moment den Linksverkehr vergessen und sich wie ein tumber Traumwandler automatisch nach rechts gestellt.
Kaum hatte sich Karl zu dem halben Dutzend Wartender gestellt, da bog ein Kleinbus mit Schwung von der Prince in die George Street ein und kam abrupt vor dem Haltepunkt zum Stehen. Die mittlere Schiebetür flog auf, und die Frauen bestiegen das Gefährt. Karl, der schon daran gedacht hatte, die Nacht in der Hauptstadt zu verbringen, mochte der Lösung seines Problems noch nicht so recht trauen. Durch die geöffnete Seitenscheibe der Vorderreihe des kleinen Japaners befragte er den Mittzwanziger am Rechtssteuer: „Fahren Sie nach Las Cuevas?“ - „Yep“, lautete die Antwort des jungen Adonis. „Nehmen Sie Platz.“ Los ging die wilde Fahrt. Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reisehinweisen vor der „unorthodoxen Fahrweise“ der Trinidader. Nun erfuhr er, was das heißt: Risikofreudig, ja abenteuerlich. „Senna“, wie Karl ihn insgeheim taufte, raste wie ein Getriebener. „Hat er eine Verabredung oder jagt er dem nachfolgenden Maxi-Taxi vorweg, um ja nicht eingeholt zu werden“, mutmaßte sein deutscher Beifahrer.
Eine Teilantwort sollte Karl bald erhalten: „Senna“ war nach einer Bergauffahrt mit zwei Überholmanövern und einer Hatz um die Queens Park Savannah in eine Nebenstraße der ins Umland führenden Saddle Road eingebogen. Plötzlich hielt er an. Am Straßenrand stand eine jugendliche Schönheit in engen Jeans und knappem Top. Mit einer nach außen wegklappenden Handbewegung gab der Fahrer Karl zu verstehen, dass er aussteigen müsse. Diesem unmissverständlichen Wunsch gab jener natürlich nach. Raus, die Tür galant aufgehalten und wieder rein. Nun saß das Herzblatt von „Alfonso“, wie sie den Chauffeur nannte, auf dem Mittelsitz, Karl ganz außen am Fenster. Sofort entspann sich ein angeregter Wortwechsel zwischen dem Paar. Das hielt „Senna“ jedoch nicht davon ab, dem Stau auf der Saddle Road durch hurtiges Kreuzen über steile Nebenstraßen auszuweichen. Die kurvige Reise durch die Berge und entlang der Nordküste war im Vergleich dazu geradezu erholsam. Im hübschen Badeort Maracas verließ Alfonsos Freundin den Bus. Zehn Minuten später konnte dann auch Karl an seiner Las Cuevas Beach Lodge aus Alfonso „Sennas“ Kleinbus-Boliden springen.
Mit Kent Ove aus Norwegen sollte es am nächsten Tag über die Höhen der North Range nach Süden gehen. Karl hatte sich mit dem 30-jährigen Werkmeister einer Nordsee-Ölplattform beim Abendessen auf der Veranda der Lodge angefreundet. Der rundliche, blonde Wikinger hatte gleich zugestimmt, als Karl ihm vorgeschlagen hatte, am nächsten Tag im eh schon bestellten Taxi zum Asa Wright Nature Centre mitzufahren. Der indischstämmige Chauffeur kam früh wie bestellt. Doch vor der Abfahrt hatte Karl noch etwas zu erledigen. Er ging hinüber zur Fischer-Kooperative und erkundigte sich nach Souldog. Keiner wusste, wo er im Moment steckte. Karl händigte mit der Bitte um Weitergabe einem der Fischer die zwölf Dollar aus, die er Souldog schuldig war. Er ahnte nicht, dass er seinem Kreditgeber doch noch begegnen sollte.
Rajiv, der indischstämmige Chauffeur, war ein drahtiger älterer Herr. Man hätte ihn eher hinter einem Bankschalter vermutet als am Steuer eines Taxis. „Die Führungen durch den Naturpark beginnen erst nach dem Mittagessen“, gab er zu bedenken. „Das weiß ich von früheren Touren. Ich schlage vor, wir machen zunächst einen kleinen Abstecher zur Spring Bridge bei Blanchisseuse.“ Den beiden Europäern sollte es recht sein. „Du kennst dich hier aus, Rajiv. Also machen wir das“, meinte auch Kent Ove. So ließen sie denn den Abzweig in die Berge kurz vor der Ortseinfahrt von Blanchisseuse rechts liegen und fuhren geradeaus in den Ort hinein, an Polizei, Kirche, Schule sowie Strand vorbei und am anderen Ende des Dorfes wieder hinein in den tropischen Regenwald.
Neue und alte Brücke über den Marianne River
Ein paar hundert Meter hinter dem Ortsausgang hielt Rajiv. Sie stiegen aus und standen vor zwei Brücken, der historischen Stahlseilhängebrücke vom Anfang des 20. Jahrhunderts und daneben der 2012 eingeweihten Marianne Bridge über den gleichnamigen Fluss. „Die alte Blanchisseuse Spring Bridge ist der ganze Stolz der Leute hier“, sagte Rajiv. „Schaut, die Eisenträger links und rechts der schmalen Fahrbahn an beiden Seiten der Brücke leuchten in neuem Rot. Und die Holzbohlen sind neu ausgelegt. Nachdem die neue Eisenbrücke eröffnet war, hat man die alte Spring Bridge renoviert. Sie war jahrzehntelang die Verbindung zu den Feldern im Osten. Sie ist Teil ihrer Geschichte und ihrer Identität.“ Zu dritt überquerten sie den Marianne River. Hin über die neue Eisenbalkenbrücke, zurück über die nun Fußgängern vorbehaltene Hängeseilkonstruktion. Unten ihnen schimmerte der Fluss grünbraun. Nur ein paar hundert Meter nördlich fließt er am Rand der Blanchisseuse Bay in die Karibik. „Das Tropenwaldambiente eurer Spring Bridge erinnert an die Landschaft um die filmberühmte Brücke am River Kwai“, rief Fotograf Karl lachend seinen Gefährten zu, als sie auf den glänzenden Holzbohlen für ihn posierten.
Bei der Überquerung des North Range-Kamms drangen sie noch tiefer ein in dieses teilweise sich selbst überlassene Gehölz. An einer Stelle mussten sie sogar Bruchholz umkurven, das auf die Straße gefallen war. Jenseits des Kamms tippte der hinten sitzende Karl Rajiv auf die Schulter. „Bitte halt mal an. Da vorne kann man ins Tal schauen.“ Dort standen statt Bäumen niedrige Crotonbüsche. Über deren rote und gelbgrüne Blätter hinweg schauten sie auf dicht bewaldete Hänge. Über dem Bergrücken lagerte unter blauem Himmel ein dickes weißes Wolkenband.
Nach einigen Kurven mehr erreichten sie den Abzweig zum Asa Wright Nature Centre, einem Gelehrtenparadies für Vogelkundler. Auf der Veranda des Besucherzentrums stehen nicht nur gediegene Polstermöbel, sondern auch Stative für Teleskope, mit denen die Vogelkundler nach ihren gefiederten Freunden im Gehölz unterhalb des Landhauses spähen können. Das Haus hat noch den diskreten Charme des Wohlstands der früheren Besitzer bewahrt, die von hier aus ihre Spring Hill Plantation, eine Kakao-Plantage, leiteten. Im großen Esszimmer treffen sich die Ornithologen zum Lunch. Gegen ein Extra zum Ticket für das Besucherzentrum durfte Karl daran teilnehmen. Ein junges Doktorandenpaar aus Kanada und eine Professorin aus den USA verwickelten ihn bei dem vorweihnachtlichen Mahl, das mit dem großen Weihnachtsbaum im Hintergrund durchaus etwas Festliches hatte, in ein angeregtes Gespräch. Das wanderte vom Zug der tropischen Vögel von Venezuela nach Trinidad zur Migrantenwelle nach Deutschland. Das Thema Europas im Herbst und Winter 2015 beschäftigte offenbar auch die Öffentlichkeit in den Einwandererländern Nordamerikas.
Im Asa Wright Nature Centre
Nach dem Dessert sammelte die hochgewachsene, gertenschlanke Olivia ihre Schäfchen zur Exkursion in den Wald ein. Die junge, farbige Trinidaderin war im Unterschied zu ihren Gästen zünftig ausgestattet. Zu Bluejeans und grünem Polohemd mit dem Asa Wright-Emblem trug sie Gummistiefel. Denn an den Hängen der North Range regnet es nicht zu knapp, und der Waldboden ist oft aufgeweicht. Kent Ove hatte derweil auf der Veranda Fotos von den Kolibris geschossen, die die dort hängenden Zuckerschalen umschwirrten. Gemeinsam mit Karl und einem Dutzend anderer Interessenten folgte er nun Olivia in den Wald. Sie sahen Büsche mit Blüten, die aussahen wie rosa Wattebäuschchen, dichte Ansammlungen von Bambusstämmen, uralte verholzte Lianenstränge, die wie von der Natur gedrechselt erschienen, einen von mehreren Ameisenkolonien bevölkerten flachen, grauen Hügel, den farbigen Superstar unter den einheimischen Vögeln, den Violaceous Trogon mit seinem violetten Kleid über dem gelben Bauch und – weniger farbig, aber dafür umso lauter hörbar – den Bearded Bellbird, den Bärtigen Glockenvogel.
Während der bunte Trogon relativ gut zwischen dem Blattwerk der Bäume zu erkennen war, konnten sie den graugefiederten Glockenschläger erst gar nicht sehen. Sie hörten nur sein teng – teng – teng, so als ob er mit einem Hämmerchen auf eine Blechbüchse schlagen würde. Es ertönte aus mittlerer Distanz. Dann hörten sie auf einmal ein lautes Päng – Päng ganz aus der Nähe. Olivia wies in Richtung elf Uhr. Und da sah Karl ihn auch, den Drummer boy im grauen Mantel, dessen weißgefiederter Bauch ihn von den Blättern abhob, wie er dort in etwa zehn Metern hoch oben auf einem Ast saß. Teng – teng – teng ging es immer wieder. Und ein unsichtbarer Kumpan (oder war es eine Umworbene?) antwortete Päng – Päng. Über eine Minute dauerten die blechernen Trommelschläge. Dann flog er davon. Doch sein Schlagen dauerte an. Allmählich verklang seine „Blechtrommel“ in der Ferne.
„Einen ganz anderen Sound produzieren der Schwarze und der Weiße Manakin. Die Manakin oder Schnurrvögel sind auf Trinidad und speziell auch auf dem Asa-Wright-Gelände in vielen Varianten vertreten“, verkündete Olivia. Bei ihren Balztänzen oder Flügen erzeugen diese Sperlingsvögel schnurrende Geräusche. Aber so sehr auch Olivia nach ihrem Liebling, dem Bärtigen Weißen Manakin Ausschau hielt. An diesem Nachmittag wollte er sich einfach nicht zeigen.
Ganz auf Vogelbeobachtung gepolt, fielen Karl am nächsten Nachmittag beim Strandwandern im hinteren Teil der Cuevas-Bucht große schwarze Vögel in den Wipfeln der Bäume auf. „Weißt du, was das für eine Art ist?“ fragte er Kent Ove. „I think that are vultures“, meinte der Norweger. „What? Vultshirs?” „No, vultures. Du weißt, diese großen Vögel, die herumliegende verendete Tiere essen.“ „Ach so, du meinst Aasgeier. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Geier gesehen, nur in Filmen wie „Geier-Wally“ und Walt Disneys Jungle Book. Erinnerst du dich, wie die vier Beatle-mäßig aussehenden Geier sangen That’s what friends are for?“ „Yeah-hey“, kicherte Kent Ove. Respektvoll betrachtete Karl die schwarzen Aasfresser. Hier im westlichen Teil der langgestreckten Bay mit einem von einem kleinen Priel durchzogenen noch breiteren Strand waren sie von Badenden ungestört. Mehr als ein Dutzend von ihnen hockte jenseits des Priels auf dem dort grasbewachsenen Boden. Sie schienen untätig. Doch als die beiden Strandwanderer weiter schritten, sahen sie im Sand zwei sauber abgenagte Schädelknochen liegen. Kein Fitzel Fleisch war mehr dran. „Das Werk der Vultures,“ konstatierte Werkmeister Kent Ove.
Sie gingen bis ganz ans Ende der wie eine Muschelschale gebogenen Bucht. „Guck mal, da vorne kann man bei Ebbe noch um die Felsnase herumgehen. Ich bin dort heute früh am Morgen hingejoggt. Übrigens: zwei Kilometer lang ist die Strecke von einem zum anderen Ende des Strands, zeigte mir der GPS-Messer in meiner Lauf-App an. Als ich um die Ecke herumbog, sah ich dort ein farbiges Paar in Badeanzug und Schwimmshort im Sand sitzen. Fröhlich schauten sie zu mir herüber, als ich sie höflich grüßte. Als ich sie fragte, ob ich ein Foto von ihnen machen dürfe, haben sie es mir sogar gestattet. Schau her!“ Karl zeigte Kent Ove ein Bild auf seinem Smartphone. „In der Tat ein romantisches Plätzchen“, gab sein Freund zu. „Ideal für einen Aussteiger“, ergänzte Karl träumerisch. „Man könnte hier in der kleinen Bucht hinter der großen Bucht zwischen den Felsen und unter den Lianen eine Hütte bauen wie einst Robinson Crusoe und Freitag. Vorher möchte ich jedoch noch klären, ob das dort mit dem Internetzugang klappt“, sinnierte der nur bedingt zivilisationsmüde Deutsche.
Nach diesem Tag mit Strandlauf, Schwimmen und Wandern in der Las Cuevas Bay erzählte Karl dem Norweger beim Abendessen von einer Begegnung am Vormittag. „Eigentlich habe ich ja heute zur Maracas Bay fahren wollen. Das ist doch ein größerer Touristenort als hier. Die Anlagen am Strand machten einen guten Eindruck, als ich dort am Montag auf dem Weg nach Port of Spain mit dem Maxi-Taxi vorbeifuhr. Also stellte ich mich unten an die Straße. Aber ein Kleinbus nach dem anderen rauschte vollbesetzt an mir vorbei. Und dann kam wieder mein Freund und Helfer Souldog über die Straße herangeschlurft. Er hatte offenbar meine erfolglosen Bemühungen beobachtet.“ Kent Ove unterbrach ihn: „Ist das der Fischer, der dir vorgestern Geld geliehen hat?“ „Ja, genau der. Er erklärte mir, dass ich heute geringe Chancen hätte, ein Taxi abzufangen. Denn viele Leute aus Filette und Blanchisseuse würden einen Tag vor Heiligabend noch für Weihnachtseinkäufe in die Stadt fahren wollen. Und dann fragte Souldog beiläufig, ob ich ihm ein loan geben könne. Es hat einen Moment gedauert, bis ich kapierte, dass er eine Leihe, einen Kleinkredit wollte.“ „Und hast du ihm Geld gegeben?“ wollte Kent Ove wissen. „Zunächst einmal gab ich ihm zu bedenken, dass ich ja morgen nach Grenada fliegen werde. Kein Problem, meinte er. Ich solle, bevor ich ins Taxi steige, zu ihm herüber in die Fischereikooperative kommen. Dann würde ich mein Geld zurückerhalten. Wieviel er denn benötige, fragte ich ihn. 50 TT-Dollar, meinte er mit fragend hochgezogenen Augenbrauen. Sollte ich ihm, der mir vorgestern finanziell unter die Arme gegriffen hat, das abschlagen? Ich habe ihm fünf Zehner-Scheine gegeben.“
„Mh“, brummte Kent Ove, der gerade den letzten Rest seines Fischfilets auf die Gabel schob. „Glaubst du, du siehst das Geld wieder? Erst zwölf Dollar verliehen, dann 50 geborgt. Das sieht nach einer Strategie aus. Ich denke, du hast trübe Aussichten.“ „Ich vertraue meinem Souldog. Ich habe ihn noch nicht einmal gefragt, wofür er das Geld braucht“, erwiderte Karl, der sich sicherer gab, als er in Wirklichkeit war.
Die Wirtin trat heraus auf die Terrasse und servierte die Desserts. Karl erinnerte daran, dass er für den nächsten Morgen ein Taxi zum Flughafen bestellt hatte. Er müsse aber vorher rüber zur Fischerkooperative. In kurzen Zügen erzählte er die Geschichte mit Souldog. Die vierzigjährige Frau im Sari setzte eine verächtliche Miene auf. Ungefragt erklärte sie, weshalb der derbe Fischer den loan ihrer Meinung nach benötigt habe. „They gamble. Sie spielen Karten und zwar mit hohen Einsätzen. Ihr Souldog ist wohl pleite. Ihr Geld können sie abschreiben.“
Als Karl am nächsten Morgen zum Frühstück kam, saß Rajiv schon mit dem Wirt beim Kaffee auf der Veranda. Der indischstämmige Lodge-Besitzer hatte wieder seinen indischstämmigen Kumpel als Taxifahrer bestellt, obwohl der von Arima eine lange Anfahrt über den North Range hatte. In Las Cuevas selber gab es gar kein Taxi. Aber immerhin liegt die Kleinstadt Arima in der Nähe des Airports. Nach Kaffee und Croissants entschuldigte sich Karl: „Sorry, ich hab noch was zu erledigen. Bin gleich wieder da. Ich muss eben zu den Fischern rüber.“ Der Wirt grinste: „Ich weiß Bescheid. Good luck“.
Boote der Cuevas Bay-Fischerkooperative in der Sonne
Als der Gläubiger auf das Genossenschaftsgelände einbog, sah er oben auf einer Stromleitung drei Geier und unten auf einem verrottenden alten Kahn zwei sitzen. „Das sind doch keine Pleitegeier?“ lachte Karl ob dieser abergläubischen Frage halbironisch, halbpessimistisch in sich hinein. Und da kam er ihm schon in der Morgensonne vom House of the Rising Sun entgegen, der sonnengegerbte Gambler Souldog, wie immer lässig mit leicht schlurfendem Schritt, und drückte ihm mit aller Selbstverständlichkeit ein Bündel TT-Dollars in die Hand. Karl steckte es ein, drückte ihm lächelnd die Pranke, auch Souldog griente. Sie wünschten sich Frohe Weihnachten und klopften sich zum Abschied auf die Schultern.
„Die North Range People sind ein ganz besonderer Schlag. Ich habe sie gut kennengelernt, als ich hier vor meiner Pensionierung als zuständiger Beamter des Wasserversorgungsamtes viel zu tun hatte“, berichtete Rajiv auf der Taxifahrt zum Flughafen. Karl gab ihm Recht. „Ja, besonders ist er, mein Souldog, aber verlässlich!“