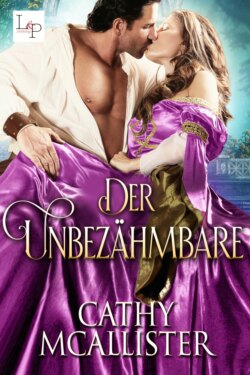Читать книгу Der Unbezähmbare - Cathy McAllister - Страница 5
ОглавлениеProlog
20. März 1888
Schwere graue Wolken hingen am Himmel, aus denen ein stetiger, alles durchweichender Nieselregen auf mich hinab regnete. Es war einer jener Tage, an denen alles einfach nur grau aussah, als hätte der Regen alle Farben aus dem Bild gewaschen. Das triste Grau passte perfekt zu der Trostlosigkeit in meinem Herzen. Es regnete nun schon seit drei Tagen fast ununterbrochen und der schwere Boden hatte sich in einen sumpfigen Morast verwandelt, der an den Schuhen zog, sobald man einen Schritt wagte. In diesem schlammigen, braunen Sumpf mutete die offene Grabstelle wie ein dunkler Schlund an, der darauf zu warten schien, mich zu verschlingen. Nicht, dass ich etwas dagegen gehabt hätte. Ein Teil von mir wollte sich in diesen Schlund hinab werfen, mit ihnen begraben werden. In meinem Inneren war ich ohnehin schon tot, wozu also noch dagegen ankämpfen. Nichts schien mir mehr wichtig genug, dass es sich lohnen würde, dafür weiter zu leben. Ich hatte alles verloren! Alles, was ich liebte, was mir Sicherheit gegeben hatte. Wie sollte ich in dieser düsteren, grauen Welt weiter bestehen? Es fühlte sich irgendwie falsch an, dass ich noch hier war. Als wäre ich vergessen worden. Das hier war nicht mehr meine Welt oder besser, ich war nicht mehr Teil dieser Welt. Ich war bereits genauso tot, wie die beiden lieben Menschen, die in ihren blumengeschmückten Särgen in der Grube lagen.
Viele Leute waren zur Bestattung gekommen, doch ich nahm sie kaum wahr. Hin und wieder spürte ich ihre mitleidigen Blicke auf mir. Es war unerträglich. Ich wollte kein Mitleid, wollte niemanden sehen, mit niemandem sprechen müssen. Sie sollten mich einfach nur in Ruhe lassen. Je länger ich dort im Regen stand, um so mehr zog ich mich in mein tiefstes Inneres zurück, wo die Worte, die der dicke Geistliche mit der Halbglatze und den freundlichen, braunen Augen von sich gab, mich nicht mehr erreichten; ebenso wenig wie der Regen, der meinen Umhang aus schwarzer Wolle schwer und klamm werden ließ und mein feines, blondes Haar dazu brachte, sich trotz der mühsamen Arbeit meiner Zofe, zu kräuseln.
Ich kann nicht sagen, ob die Kälte, die ich fühlte, vom Regen her rührte oder ob sie aus meinem Inneren kam. Oder beides. Der Schock über den plötzlichen Verlust hatte mich fest im Griff und ich war wie gelähmt. Nein! Wie eingefroren! Starr! Mit einem Schlag hatte ich beide Eltern verloren und stand nun vollkommen allein da. Meine Eltern, William und Morgan Graham, befanden sich mit ihrer Kutsche auf dem Heimweg von London, wo unsere Familie mehrere Juweliergeschäfte und ein Warenhaus besaß, als sie von Banditen überfallen und getötet worden waren. Ich war ein Einzelkind und der einzige Verwandte, den ich nun noch hatte, war James Atkins, ein Schwager meines Vaters. Der Mann meiner verstorbenen Tante Anne. Ich hatte Onkel James zuletzt gesehen, als ich etwa sieben Jahre alt gewesen war, und hatte kaum Erinnerungen an ihn. Er würde von nun an als mein Vormund auftreten, da ich noch nicht volljährig war. Morgen sollte er auf Blue Hall, dem Landsitz unserer Familie, eintreffen. Blue Hall war ein Haus mit zahlreichen Erkern und Balkonen, reich mit Ornamenten verziert. Es besaß zehn Schlafräume, einen großen und einen kleinen Salon, das Arbeitszimmer meines Vaters, fünf Badezimmer, eine Küche und diverse Wirtschaftsräume sowie die Dienstbotenzimmer unter dem Dach. Es war mir stets mehr ein Zuhause gewesen, als das Londoner Stadthaus. Ich liebte das Land, ritt gern stundenlang über Wiesen und Felder und ließ mir den Wind um die Nase wehen.
Nachdem Tante Anne verstorben war, hatte Onkel James die letzten zehn Jahre in Paris und Amsterdam verbracht, wo er mit erlesenen französischen Weinen und Spirituosen handelte. Ich hatte von meinen Eltern noch vor nicht langer Zeit vernommen, dass die Geschäfte meines Onkels wohl nicht zum Besten standen. Offenbar lebte er auf großem Fuß und hatte einen Hang zum Spielen und zu Bordellen. Ich hatte einmal gehört, wie Vater sich mit einem Freund über die Eskapaden meines Onkels unterhalten hatte. Mein Vater hatte nie viel vom Gatten seiner Schwester gehalten, weswegen Onkel James auch kein sehr häufiger Besucher gewesen war. Erst recht nicht, seit Tante Annes Tod.
Wie ein schlechter Traum zog die Beerdigung an mir vorüber. Auch den anschließenden Leichenschmaus nahm ich kaum wahr. Die Bediensteten erledigten alle erforderlichen Aufgaben auch ohne Anweisungen. Sie wussten, was sie zu tun hatten. Ich fühlte mich nicht imstande, mich um die Bewirtung der zahlreichen Besucher zu kümmern. Ja, es interessierte mich nicht einmal, ob alles funktionierte oder nicht. Ich war, wie bereits gesagt, nicht mehr Teil dieser Welt.
Meine Eltern hatten sich in den besten Kreisen bewegt und viele angesehene Persönlichkeiten waren zur Beisetzung und dem Leichenschmaus erschienen. Obwohl nicht vom Adel, hatte mein Vater durch seinen geschäftlichen Erfolg unsere Familie in die obere Gesellschaftsschicht gebracht. Vater war ein Arbeitstier und ehrgeizig. Er hatte aus dem einzigen Juweliergeschäft seines Vaters ein kleines Imperium geschaffen. Meine Mutter, immer ein wenig zu ruhig und farblos, war so sehr das Gegenteil von meinem Vater gewesen, dass ich nie verstanden hatte, wie sie zueinander gefunden hatten. Sicher, Mutter war sehr schön gewesen. Wie eine kostbare, zerbrechliche Porzellanpuppe mit zarten Gliedmaßen und großen Augen. Ich hatte sie geliebt, jedoch selten umarmt. Sie erschien mir stets zu sehr wie ein Geschöpf aus einem Feenhügel. Wir waren uns leider nie wirklich nah gekommen. Meinen Vater dagegen hatte ich trotz seiner Härte über alles geliebt. Wir teilten die Leidenschaft für die Pferde und für die Jagd. Er hatte zwar viel Zeit geschäftlich in London verbracht, fühlte sich jedoch genau wie ich auf dem Land am Wohlsten. Wie sehr ich ihn vermisste. Würde dieser furchtbare Schmerz je nachlassen?
*****
Nachdem endlich alle Gäste gegangen waren, ließ ich mich von Lucie, meiner alten Amme, auf mein Zimmer im Südflügel des Hauses führen. Ich hatte mich in diesem Zimmer immer sehr wohl gefühlt. Die beiden großen Fenster ließen viel Licht hinein und die gelben Vorhänge sorgten für eine sonnige Atmosphäre. An einer Wand hing ein großes Gemälde von mir im Alter von zwölf auf dem Rücken meiner ersten eigenen Stute; mein Lieblingshund George saß neben dem Pferd und hatte den Kopf schief gelegt. Ich hatte tagelang geweint, als der Hund von einem Keiler tödlich verletzt worden war. Damals war ich vierzehn gewesen. Nun schenkte ich all dem keine Beachtung. Teilnahmslos ließ ich geschehen, dass meine Zofe Marie, ein unscheinbares Mädchen von sechzehn, aber mit großem Geschick fürs Frisieren, mich entkleidete.
„Du gefällst mir gar nicht, Kind“, sagte meine Amme und nötigte mich, mich auf den Stuhl vor meiner Frisierkommode niederzulassen.
Während Marie meine Haare ausbürstete, richtete die alte Lucie, irgendetwas vor sich hin brummend, das Bett. Ich ließ alles reglos, und ohne ein Wort über mich ergehen. Ich wollte weinen, schreien, einfach meine Qual hinauslassen, doch meine Augen blieben trocken, mein Mund verschlossen und innerlich zerriss es mich.
„Komm zu Bett, Liebes“, forderte mich Lucie auf, nachdem Marie mit meinen Haaren fertig war. Ich wollte ihr gern gehorchen, doch ich war außerstande, mich aufzurichten. Mein Kopf war nicht in der Lage, die Befehle an meinen Körper zu senden. Nicht geweinte Tränen brannten in meinen Augen und ich konnte sie nicht hinauslassen. Ein Gefühl von Panik überkam mich und ich hatte das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen. Meine Brust schmerzte vor Anstrengung, genug Sauerstoff in meinen Körper zu pumpen.
Hilf mir Papa! Ich ersticke!
Meine Hände ballten sich zu Fäusten und meine Nägel bohrten sich tief in das Fleisch meiner Handflächen, doch ich spürte davon nichts. Nur die Angst. Diese entsetzliche Angst.
Plötzlich spürte ich eine sanfte Wärme in meinem Inneren. Wie eine winzige Flamme in meiner Mitte. Die Flamme wurde größer und die Wärme breitete sich aus bis in meine Fingerspitzen und meine Hände entkrampften sich. Meine Brust hob und senkte sich wieder ohne Schmerz und ich atmete tief ein und aus.
„Alles in Ordnung mit Euch?“, fragte Marie besorgt.
Ich antwortete nicht, aber wandte den Kopf, um sie anzusehen. Nein! Ich war nicht in Ordnung. Aber besser!
Erst als Marie meinen Arm ergriff, erhob ich mich und ließ mich von ihr zum Bett führen.
Lucie bedeutete mir, mich hinzusetzen und hielt mir einen Becher entgegen. Ein strenger Geruch stieg mir in die Nase. Wieder so ein Kräutergebräu meiner Köchin, die sich gut mit allerlei Tränken und Tinkturen von Kräutern auskannte. Meist half, was sie so zusammenbraute, wenn es auch furchtbar schmeckte.
„Hier mein Kind. Trink dies. Es wird dir helfen, gut zu schlafen“, sagte Lucie.
Gehorsam leerte ich den Becher mit dem leicht bitteren Gebräu und ließ mich zurück auf die Kissen sinken. Die Amme deckte mich sorgsam zu, dann verließ sie mit der Zofe das Zimmer und ließ mich allein zurück. Endlich kamen die Tränen und als sie erst einmal zu Laufen angefangen hatten, wollten sie kein Ende finden, bis ich schließlich erschöpft einschlief.
*****
Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. Ich hatte sehr schlecht geschlafen, wirre Träume hatten mich mehrmals aus dem Schlaf aufschrecken lassen. Ich vermutete, dass mein Schlaftrunk Laudanum enthalten hatte.
Teilnahmslos ließ ich mich von Marie ankleiden und frisieren und nahm dann ein kleines Frühstück im Salon ein. Die frischen Apfeltörtchen und die Minzpastetchen, die ich sonst so gern aß, schmeckten mir heute nicht. Jeden einzelnen Bissen musste ich mit Gewalt hinunter zwingen und dabei den Reflex, zu würgen, unterdrücken. Ich aß nur, um meine Köchin Martha nicht zu kränken, die eine liebe Seele war. Ich hatte kein Interesse mehr an diesem Leben. Das bedeutete aber nicht, dass es mir egal war, wenn ich Leute verletzte, die mir etwas bedeuteten. Und meine Köchin bedeutete mir viel. Sie war schon in unserem Haushalt, solange ich denken konnte. Martha war klein und rund, hatte Arme und Hände wie ein Schmied, aber ein Herz aus Gold. Sie war diejenige, die meine Tränen getrocknet und mir Apfelküchlein in den Mund geschoben hatte, wenn Papa mich gescholten oder wenn ich mich verletzt hatte.
Ich war zwar durch die Reisen meiner Eltern gewohnt, allein zu speisen, doch es war ein Unterschied, ob sie nur auf Reisen waren, oder ob ich wusste, dass sie nie wieder mit mir an einem Tisch sitzen würden. Ich vermisste sogar Mamas Zurechtweisungen. Immer hatte sie etwas an mir auszusetzen gehabt. „Sitz gerade, Elizabeth!“ oder „Kannst du nicht dein Besteck benutzen, wie jeder anständige Mensch?“, würde sie sagen und Papa würde seine Serviette an den Mund halten, um sein Grinsen zu verbergen. Dann würde er sich räuspern und die Stimme erheben. „Hör auf deine Mutter, Elizabeth Sofia!“ Er nannte mich immer bei meinen beiden Vornamen, wenn er mich tadelte. Sonst nannte er mich immer liebevoll Liz oder Lizzie.
„Wünscht Ihr noch etwas?“, riss das Dienstmädchen mich aus meinen Tagträumen.
Ich schüttelte trübe den Kopf. Die Minzpastetchen lagen mir schwer im Magen und ich fühlte mich elend. Ich konnte mir nicht vorstellen, auch nur einen Tag weiter so leben zu können. Ich vermisste sie so sehr. Der Schmerz zerrte an meinen Eingeweiden. Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals wieder lachen zu können.
„Nein Molly. Danke. – Ich werde ein wenig ausreiten.“
„Euer Herr Onkel wird bald eintreffen. Wollt Ihr ihn nicht begrüßen?“, fragte Molly besorgt.
„Ich bleibe nicht lange weg – nur ein kurzer Galopp. Ich brauche – frische Luft“, krächzte ich, sprang von meinem Stuhl auf und verließ fluchtartig den Raum.
*****
Ich zügelte den Lieblingshengst meines Vaters; einen schwarzen Friesen aus den Niederlanden; mit langer, wallender Mähne und einem edlen Kopf mit klugen Augen; vor dem Stallgebäude. Ich hatte mein eigenes Reitpferd, eine kastanienfarbene Stute von ausgeglichenem und freundlichem Wesen, doch ich hatte mehr Freude an dem Temperament des schwarzen Hengstes. Außerdem hatte das Tier meinem Vater gehört und ich fühlte mich ihm näher, wenn ich seinen Hengst ritt. Vater war ein ausgezeichneter Reiter gewesen und er selbst war es gewesen, der mich das Reiten gelehrt hatte. Er war ein strenger Lehrer gewesen, doch ich war eine eifrige Schülerin, stets darauf bedacht, ihn stolz zu machen.
Der schnelle Ritt hatte mir gut getan. Ich fühlte mich erhitzt und mein langes, blondes Haar war vom Wind zerzaust. Meine Frisur hatte sich bei dem halsbrecherischen Tempo vollkommen aufgelöst und ich hatte meinen Hut verloren, doch das kümmerte mich nicht, ich fühlte mich schon viel besser – lebendiger. So war es immer gewesen, wenn ich Kummer hatte. Ein scharfer Galopp klärte meine Gedanken und erfüllte mein Herz. Es war nicht, dass mein Kummer verschwunden wäre; die klaffende Wunde in meinem Herzen war noch immer da; doch hatte der Ritt dem Schmerz die Spitze genommen. Er hatte mir ein Stück Lebensfreude wieder gegeben.
Ich sprang aus dem Sattel und klopfte den mächtigen Hals des edlen Pferdes, ehe ich ihn dem herbeigeeilten Stalljungen übergab.
„Euer Onkel ist bereits eingetroffen, Herrin“, berichtete der junge Knecht aufgelöst. Er schien ganz aufgeregt zu sein.
„Wann?“, fragte ich mit unruhig klopfendem Herzen. Der Gedanke, nun meinem Vormund entgegen zu treten, schnürte mir die Kehle zu. Jetzt nahm mein Leben wieder eine neue Wende und ich befürchtete nichts Gutes. Ich verspürte den Drang, wieder auf den Rücken meines Pferdes zu springen und zu fliehen. Einfach immer weiter zu reiten, bis die Welt zu Ende war.
„Vor einer halben Stunde etwa“, antwortete der Junge auf meine Frage.
Ich seufzte und zwang mich, dem Impuls zur Flucht nicht nachzugeben. Der schöne Rausch des schnellen Rittes war mit einem Mal verflogen. Stattdessen fühlte ich mich, als würde ich jeden Moment zusammensinken. Meine Beine fühlten sich an, als hätten sich die stützenden Knochen aufgeweicht und wären nun nicht mehr fähig, mein Körpergewicht zu tragen.
„Herrin? Alles in Ordnung?“, riss mich die Stimme des Jungen aus meinen Gedanken. Er schaute mich aus großen, runden Augen besorgt an.
Ich schüttelte leicht verwirrt den Kopf.
„Danke Timo. Gib dem Guten hier eine Handvoll Hafer extra, die hat er sich redlich verdient.“
„Gewiss Herrin. Ich werde ihn auch schön bürsten, bis er wieder glänzt“, sagte der Knecht eifrig.
„Ja, tu das“, sagte ich ein wenig abwesend. In Gedanken war ich schon wieder bei dem bevorstehenden Zusammentreffen mit meinem Onkel. Wie er wohl sein mochte. Hoffentlich kamen wir einigermaßen miteinander aus. Immerhin würde er das nächste halbe Jahr hier auf Blue Hall wohnen und über mein Leben bestimmen. Ich gab mir einen Ruck und ging bangen Herzens auf das Herrenhaus zu.
*****
Meine Gefühle waren gemischt, als ich das Gebäude betrat. Ich hatte ja keine Ahnung, was da auf mich zu kommen würde. Ich verwünschte die unabänderliche Tatsache, dass ich als Frau auf die Welt gekommen war. Männer hatten alle Freiheiten und wurden auch in meinem Alter viel mehr ernst genommen. Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit!
In der Eingangshalle war es kühl und ich fröstelte. Molly kam sogleich auf mich zugeeilt. Ihre Wangen waren vor Aufregung gerötet und sie machte einen hektischen Eindruck.
„Euer Onkel ist da. Gott steh uns bei, so ein ...“, begann sie und schlug sich dann die Hand auf den Mund, als hätte sie etwas Ungehöriges sagen wollen.
Ihre Hände zitterten, als sie mir den Umhang abnahm. Zwar neigte die gute Molly ein wenig dazu, schnell hysterisch zu werden, dennoch ließ ihre offensichtliche Panik ein flaues Gefühl in meinen Eingeweiden aufkommen. Erst der Stalljunge, jetzt das Dienstmädchen. Was für ein Mensch musste mein Onkel sein, dass er schon bei seiner Ankunft so einen Wirbel auslöste?
„So ein was? – Was wolltest du sagen Molly?“, hakte ich nach.
„Oh nichts, Herrin“, wehrte Molly rasch ab. „Er wartet im Arbeitszimmer Eures seligen Vaters auf Euch. Ihr solltet euch 'eilen. Er ist ein wenig – ungeduldig. – Ach aber Euer Haar! Was habt Ihr nur mit der schönen Frisur gemacht. Rasch, ich richte es schnell wieder!“
Ich wollte erst abwinken, entschied mich dann doch anders. Ihr merkwürdiges Gehabe beunruhigte mich wirklich. Es klang nicht gerade so, als wäre mein Onkel ein Mensch, mit dem man gut auskam. Zum Glück würde ich ja schon in einem halben Jahr unabhängig sein, beruhigte ich mich selbst. Bis dahin musste ich halt gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich ließ mir von Molly das Haar wieder ordnen und machte mich auf den Weg zu meinem Onkel, um ihn nicht noch länger warten zu lassen. Ich fühlte mich, als marschierte ich zu meiner eigenen Hinrichtung.
*****
Als ich vor dem Arbeitszimmer meines Vaters stand, klopfte mein Herz aufgeregt. Es regte mich innerlich auf, dass sich ein für mich immerhin fast fremder Mann darin breitgemacht hatte. Das Zimmer barg so viele Erinnerungen für mich. Gute und auch Schlechte. Als kleines Mädchen hatte ich im Arbeitszimmer mit den kleinen Holzfiguren gespielt, die mein Vater als junger Mann geschnitzt hatte. Wenn ich Vater verärgert hatte, war das Arbeitszimmer der Raum gewesen, indem ich meine Standpauke zu hören bekam. Mein Vater war zwar sehr streng gewesen, aber ich hatte ihn dennoch über alle Maßen geliebt. Im Gegensatz zu meiner Mutter hatte ich niemals Angst vor ihm gehabt, nur Respekt. Jeder hatte Respekt vor William Graham gehabt. Nun stand ich hier und wusste nicht, was ich tun sollte. Anklopfen? – Einfach wie selbstverständlich reingehen? – Immerhin gehörte das Haus mir. Ich entschied mich für einen Kompromiss, klopfte kurz und energisch an, öffnete sogleich die Tür und marschierte hinein, ehe ich es mir anders überlegen konnte.
*****
Onkel James saß an dem riesigen Schreibtisch aus poliertem Nussbaum, an dem zuvor nur mein Vater gesessen hatte, einen Stapel Briefe und Unterlagen vor sich. Zu meinem Ärger bemerkte ich, dass mein Onkel eine Karaffe vom Lieblingsbrandy meines Vaters und ein halb volles Glas neben sich stehen hatte. Offenbar fühlte er sich schon ganz als der Herr des Hauses. Bei meinem Eintreten sah er auf und musterte mich aus kleinen, scharfen Augen. Sie waren grün, wie die einer Katze. Es fehlte jedoch jegliche Wärme in ihnen. Ich verspürte sofort ein Unbehagen, das mir in alle Glieder kroch, und begann förmlich zu schrumpfen. James Atkins war groß, wahrscheinlich noch größer als mein Vater gewesen war, soweit ich das von der hinter dem Schreibtisch sitzenden Gestalt beurteilen konnte. Er war äußerst kräftig gebaut mit großen Händen, einem leicht feisten, stark geröteten Gesicht und wulstigen Lippen. Onkel James hatte das ungesunde Aussehen eines Lebemannes, der keine Ausschweifungen ausließ. Sein kurzes, rotbraunes Haar war schon sehr licht, er würde sicher bald eine Glatze bekommen.
„Guten Tag, Onkel!“, begrüßte ich ihn zaghaft.
Dieser Mann hatte etwas wirklich Einschüchterndes an sich. Eine brutale Ausstrahlung gepaart mit physischer Kraft ging von ihm aus.
„Elizabeth! – Wie schön, dass du dich letztendlich doch noch dazu entschließen konntest, mich zu begrüßen“, sagte er sarkastisch. „Ein Glück, das deine armen Eltern nicht mehr miterleben müssen, wie ungehörig du dich benimmst.“
Ich lief hochrot an, ob dieses Tadels. Wie konnte er so etwas Gefühlloses zu mir sagen, wo meine lieben Eltern gerade erst begraben worden waren. Ich fühlte Tränen in mir aufsteigen und meine Unterlippe begann, zu beben.
„Verzeihung Onkel. Ich ... ich dachte nicht, dass Ihr bereits so frühzeitig ...“, stammelte ich und stockte, als ich unter seinem eisigen Blick einige weitere Zentimeter zusammenschrumpfte.
Die restlichen Worte blieben mir im Halse stecken, als Onkel James donnernd mit der Faust auf den Tisch schlug und mit zorngerötetem Gesicht aufsprang. Bedrohlich lehnte er sich über den Schreibtisch und blitzte mich aus seinen Blut unterlaufenden Augen an. Erschrocken wich ich zurück.
„Du verzogenes Balg! Dir fehlt es an Respekt! Ich hatte eigentlich erwartet, dass ein Sprössling meines Schwagers an Zucht und Ordnung gewöhnt sein würde. Immerhin war er ein respektabler Mann von hohem Ansehen. Scheinbar war er mit dir zu nachsichtig, hat dich verhätschelt. Aber jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. Ab sofort verlässt du dieses Haus nur mit meinem Einverständnis. Keine Ausritte mehr auf eigene Faust. – Haben wir uns verstanden?“
Ich nickte eingeschüchtert, doch in meinem Inneren kochte ein rebellischer Zorn. Ich unterdrückte die Worte, die mir auf der Zunge lagen, war ich mir doch bewusst, dass jeder Versuch, sich offen gegen meinen Onkel aufzulehnen, vergeblich, ja vielleicht sogar gefährlich sein würde. Ich traute ihm ohne Weiteres zu, dass er mich wie ein Kind übers Knie legen würde, um mich zu schlagen. Und so blieb ich fügsam, wie auch Mutter es stets gewesen war, eine Rolle, in der ich mich alles andere als wohl fühlte, doch irgendwie musste ich die nächsten sechs Monate überleben.