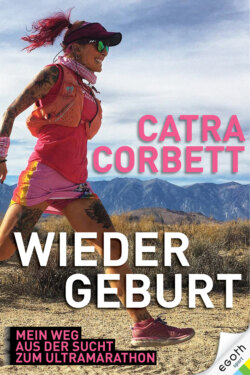Читать книгу Catra Corbett: Wiedergeburt - Catra Corbett - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 EINE NACHT IM GEFÄNGNIS HINTERLÄSST IHRE SPUREN
ОглавлениеBevor ich zum Ultralauf kam, war ich drogenabhängig. Ich arbeitete als Haarstylistin und an den Wochenenden als Go-go-Tänzerin, war Tochter, Partnerin und Freundin, aber vor allem war ich drogenabhängig. Und damit meine ich, dass alles, was ich tat, dazu diente, high zu werden.
Damals arbeitete ich in einem Friseursalon. Es war ein großartiger Job, und ich verdiente wirklich gut. Zwölf Stunden durcharbeiten war kein Problem für mich, denn in den kurzen Pausen verschwand ich einfach aufs Klo und schnupfte etwas Meth.
Mir gefiel es, als Friseurin zu arbeiten. Der Beruf war kreativ und passte wunderbar zu meinem Faible für Kleider und ausgefallene Frisuren. Und ich konnte high sein. Ich war immer high.
Das Meth gab mir die Energie, auch andere Dinge zu tun.
An den Wochenenden ging ich unheimlich gerne tanzen. Tanzen war auch der einzige Sport, den ich damals machte, denn zu jener Zeit hasste ich es, zu laufen, und machte einen großen Bogen um jedes Fitnesscenter. Somit war Tanzen auch ein Weg, um fit zu bleiben. Ich liebte es, in Nachtclubs zu gehen und dort abzutanzen, und so verband ich das Angenehme mit dem Nützlichen und verdiente mir an den Wochenenden etwas als Go-go-Tänzerin dazu. Zwar trug ich bei diesem Job nur BH und G-String, doch das war mir egal, denn ich war sowieso high. Ich habe nie verstanden, was das Tolle für die Typen daran war, die einfach nur dastanden und mich und die anderen Tänzerinnen anstarrten und uns Geld dafür gaben. Ganz ehrlich, es war schon irgendwie ein unheimlicher, ja beinahe ekelhafter Ort, um Geld zu verdienen. Doch ich verdiente gut, und eigentlich war es mir egal. Schließlich war ich ja high.
Der Grund, warum ich das tat, war, einen Haufen Kohle zu machen, mit dem wir dann mehr Drogen kauften, um wiederum mehr verkaufen zu können, nur damit wir selbst wieder mehr Drogen nehmen konnten. Jason, mein damaliger Freund, verkaufte das Zeug, und ich half ihm dabei, noch mehr davon zu verkaufen.
Also arbeitete ich und tanzte. Ich konnte den ganzen Tag lang arbeiten und die ganze Nacht tanzen. So viel Energie hatte ich. Ich fühlte mich großartig. Euphorisch. High. Wenn ich auf Drogen war, konnte ich alles tun.
Bis die Wirkung nachließ.
Wenn du auf Drogen bist, dann lebst du unter einem Schleier, in einer Art Blase, und nimmst eigentlich nur mehr dich selbst und ein paar wenige Leute um dich herum wahr. Es gab einen stetigen Nachschub an Drogen, denn Jason und ich waren Kleindealer, also war immer etwas da. Doch wenn mir das Meth doch einmal ausging und die Wirkung nachzulassen begann, dann war da kein Schleier mehr. Dann war alles verschwommen, und ich war ein Wrack.
Das war der Punkt, an dem mich mein Leben einholte. Jene Dinge, die mich müde machten, wie etwa drei Tage am Stück aufzubleiben, zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten oder die Nacht durchzutanzen, laugten mich plötzlich vollkommen aus. Dieses großartige, intensive Gefühl wich einem dünnen grauen Nebel. Das Wunder des Lebens war wie weggeblasen.
Wenn ich keine Drogen hatte, schlief ich oft zwei Tage durch.
Ich hasste dieses Gefühl.
Also kam es auch nur selten vor, dass ich nicht auf Drogen war.
Die meiste Zeit fühlte ich mich großartig, da ich high war.
Doch die Drogen begannen mich langsam, aber sicher aufzufressen.
Zu jener Zeit lebte ich zusammen mit Jason im Haus seiner Eltern. Es war schön, in einer Familiengemeinschaft zu leben. Seine Eltern waren wirklich nett und kümmerten sich um mich.
Doch wie in vielen Familien lief nicht alles so glatt, wie es den Anschein hatte. So kam Jasons Bruder beinahe jeden Abend betrunken nach Hause, und am Wochenende saßen seine Eltern auf der Couch, betranken sich und begannen zu streiten.
Damals sah ich meine eigene Familie nur selten. Einmal im Monat machte ich Mutters Haare, und sie schlug dann immer vor, gemeinsam essen zu gehen. Ich sagte meist zu, doch dann vergaß ich es oder, was öfters vorkam, ging einfach nicht hin. Ich wollte nicht, dass sie mir Fragen zu meinem Leben stellte. Ich wollte nicht, dass sie irgendetwas über mich erfuhr, darüber, wer ich geworden war. Ich schämte mich für das, was ich war, auch wenn ich Spaß dabei hatte.
Wie die meisten Drogenabhängigen verlor ich einfach Dinge, wenn ich high war. So wurde mein Auto eingezogen. Nicht weil ich kein Geld hatte, nein, ich vergaß einfach, die Rechnungen zu zahlen. Ich begann, immer mehr Dinge zu vergessen, Dinge, die man in einer normalen, funktionierenden Gesellschaft einfach tun muss. Meine Freunde und ich hatten unsere eigene Gesellschaft. Wir nahmen Drogen, um high zu werden, und tanzten.
Wir hatten zwar Geld, doch abgesehen davon, dass wir damit Drogen kauften, um den Schmerz zu lindern, wenn sie aufhörten zu wirken, konnten wir uns an dem hart verdienten Geld nicht erfreuen. Wir hatten eigentlich kein Leben. Wir hatten keine eigene Wohnung, fuhren abgewrackte Autos ohne Heizung – und auch die Nächte in Kalifornien können verdammt kalt sein. Ich war immer recht spärlich bekleidet, wenn ich in den Club fuhr und musste mich in Decken einwickeln. Nun nahm ich das Zeug auch schon mehrere Male am Tag und erreichte den Punkt, an dem ich nicht einmal mehr mitbekam, wie viel Meth ich überhaupt nahm. Ich war außer Kontrolle.
Ich begann, Dinge zu verlieren.
Ich begann, Freunde und Familie zu verlieren.
Ich begann, mich selbst zu verlieren. Es war richtig schlimm.
Dieser letzte Satz war in zweifacher Hinsicht wahr, denn ich aß auch kaum etwas, und wenn ich einmal aß, dann schienen die Drogen mein Gewicht dahinschmelzen zu lassen. Ich war schon immer schlank gewesen, doch meine Freundinnen und ich waren fasziniert davon, wie viel Gewicht wir verloren. Wir wogen uns manchmal mehrere Male pro Tag und waren überrascht, wenn wir das Resultat sahen: „Wow! Sieh doch! 45 Kilo!“
Ich war wie besessen. Die Folge dieses Verhaltens war eine Essstörung, die mich noch jahrelang verfolgen sollte, sogar noch, als ich mit Ultrarunning anfing.
Doch ich verlor aufgrund der Suchtmittel nicht nur an Gewicht. Auch meine geistige Gesundheit litt immer mehr darunter. Mit der Zeit wurde ich langsam paranoid. Wenn Jason nachts wegging und ich zu Hause blieb, blickte ich unentwegt aus dem Fenster und bildete mir ein, dass da Leute auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen, die mich aus grünen Augen anstarrten. Ich begann, Stimmen zu hören. Ich war davon überzeugt, dass Jasons Katze mich umbringen wollte.
Meine Freunde nahmen genauso viele Drogen, und auch sie wurden von den Drogen langsam aufgefressen. Einer meiner Freunde schloss sich in der Wohnung ein, da er Angst vor der Welt draußen hatte. (Erinnerungen an ihn kamen hoch, als ich Ultramarathons lief und andere Läufer sich nach etwa 75 gelaufenen Meilen in der Nacht erschreckten, da sie glaubten, einen Dämon vor sich am Weg gesehen zu haben. Dann begannen sie zu schreien oder schneller zu laufen, oder sie hielten sich gar die Augen zu. Ich musste dann immer lachen, denn ich wusste, dass sie halluzinierten.)
Also nahm ich mehr Drogen, um damit die Stimmen in meinem Kopf zum Verstummen zu bringen und die starrenden Menschen und Halluzinationen verschwinden zu lassen. Ich konnte so gut wie kein normales Leben führen.
XXX
Eines Tages fand ich Injektionsnadeln und fand kurz darauf heraus, dass Jason sich das Meth spritzte. Ich konnte bereits sehen, wie schlimm es um ihn stand, und Freunde erzählten mir das Gleiche. Als ich ihn jedoch darauf ansprach, log er mich an und sagte, dass die Nadeln einem seiner Freunde gehörten. Ich ließ es darauf beruhen, denn ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Schließlich war ich selbst ja auch süchtig, und ehrlich gesagt, war es mir auch egal. Ich kümmerte mich um meine eigene Sucht. Nur das Highsein zählte, alles andere war mir egal. Ich schnupfte und arbeitete und schnupfte und tanzte und half Jason dabei, Drogen zu verkaufen, und schnupfte. Die Lage war sehr ernst. Drogen zu spritzen ist meist der letzte Schritt, bevor man als Süchtiger verhaftet wird, stirbt oder so abhängig wird, dass man auf der Straße landet und ein Leben als obdachloser Süchtiger führt.
Eines Tages blickte ich in den Spiegel. Ich fühlte mich furchtbar und brauchte wieder Meth, und da traf es mich wie der sprichwörtliche Blitz: Ich erkannte, dass dies nun mein Leben war, meine Realität. Alles, was ich tat, tat ich nur, um Drogen zu bekommen. Ich tat es nicht aus Liebe oder für meine Eltern oder für mich selbst. Nein, ich tat es nur für das Meth.
Doch ich sah keinen Ausweg. Ich wusste, dass das echt ätzend war, doch andererseits wusste ich auch, dass ich eben genau so war. Es war meine Zukunft. Ich wusste nicht, wie ich das ändern sollte. Und dann nahm ich wieder etwas, um high zu werden.
An jenem Tag, oder vielleicht war es auch der Tag danach, rief mich ein Freund an. Ich ging ans Telefon und verabredete mich mit ihm, um ihm ein paar Drogen zu verkaufen.
Später fand ich heraus, dass er am Vortag verhaftet worden war und die Polizei Speed bei ihm gefunden hatte. Sie hatten ihn nach seinen regelmäßigen Dealern gefragt, denn sie waren hinter den „großen Fischen“ her. Also sagte er ihnen, dass er die Drogen von uns bekommen hätte.
Doch unser guter Freund hatte sie damals weder von mir noch von Jason bekommen, auch wenn wir ihn gelegentlich mit ein wenig Meth versorgten. In jenem Fall hatte er sie allerdings von einem anderen Dealer gekauft, einem Typen, der in der Kette weit über uns stand. Doch den wollte er nicht an die Polizei ausliefern, denn wer weiß, was ihm dann vielleicht zugestoßen wäre. Vielleicht hätte der Typ unseren Freund und uns einfach kaltgemacht.
Als unser Freund mich anrief, hörten die Cops am anderen Ende der Leitung mit und instruierten ihn, was er mir sagen sollte. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das wirklich so funktioniert. Allerdings war ich davor auch noch nie verhaftet worden.
Zwei Tage später, ich stand gerade mit jemandem von Jasons Familie in der Küche und wärmte etwas zu essen auf, hörte ich lautes Klopfen an der Eingangstür.
„Polizei! Aufmachen!”
Verdammter Mist.
„Wer von euch ist Catra? Wer ist Jason?“, riefen die Polizisten, als sie sich ihren Weg ins Haus bahnten.
Alle mussten sich auf den Boden legen. Jasons Eltern, sein Bruder und dessen Freundin blickten zu mir.
Ich sagte, ich sei Catra.
Dann durchsuchte die Polizei das Haus. Sie fragten uns, ob wir irgendwelche Waffen hätten und wo unsere Drogen wären.
Während die Polizei durch das Haus stürmte, fragten Jasons Eltern, was hier eigentlich los sei.
Als die Cops schließlich bemerkten, dass wir doch nicht die Großdealer waren, wie sie vermutet hatten, beruhigte sich die Lage etwas. Wir kooperierten und zeigten ihnen, wo wir unser Meth aufbewahrten und dass wir keine illegalen Waffen besaßen. Als sie dann auch mitbekamen, dass Jasons Eltern nichts mit der ganzen Sache zu tun hatten, brachen sie die Durchsuchung kurz darauf ab.
Dann setzte mich einer der Polizisten auf einen Stuhl und erklärte, dass Jason und ich ins Gefängnis wandern würden.
Der Polizist, der mich zum Wagen brachte, war sehr nett. Er sah, dass ich Angst hatte, denn ich war ganz hektisch, weinte und zitterte am ganzen Leib. Er setzte mich auf die Rückbank des Einsatzwagens und begann, mit mir zu reden.
„Wieso bist du überhaupt mit diesem Typen zusammen?“, fragte er.
Ich konnte keine Antwort darauf finden.
„Du siehst nicht gerade so aus, als wärst du ein schlechter Mensch. Du warst auch noch nie in gröberen Schwierigkeiten. Warum also?“
Wieder fand ich keine Antwort. Doch ich wusste, es war, weil ich mein High brauchte.
Der Polizist sagte, dass alles in Ordnung kommen würde und ich wahrscheinlich gleich am nächsten Tag auf Bewährung wieder freikäme und er sich darum kümmern würde, dass ich meine eigene Zelle bekäme. Aber er sagte auch, dass ich ins Gefängnis müsse.
Wir fuhren los und kamen schließlich in Downtown San José an, wo wir in Handschellen in ein Vernehmungszimmer gebracht wurden.
Auf der Polizeistation übernahm Jason die Verantwortung für alles, und man trennte uns. Er blieb dort, und ich wurde in ein Frauengefängnis überstellt.
Der erste Ort, an den man mich brachte, erinnerte mich an ein Wartezimmer oder einen Flughafenterminal. Überall lagen Hochglanzmagazine herum, und es gab sogar einen kleinen Fernseher. Doch ich hatte furchtbare Angst. Der einzige Grund, warum ich noch durchhielt, war die Gewissheit, dass ich wahrscheinlich schnell wieder hier rauskommen würde und dass ich, wenn ich für ein paar Stunden in Haft bleiben sollte, eine Zelle für mich allein hätte.
In dem Warteraum befanden sich auch noch andere Frauen, und wir begannen, uns zu unterhalten. Ein paar davon sahen so aus, als gehörten sie hierher, doch die meisten taten dies nicht. Eine Frau fiel mir besonders auf. Sie war schon älter und sah aus, als wäre sie bereits Großmutter. Die arme Frau hatte nur einen Streit mit ihrem Mann gehabt, doch als die Polizisten auftauchten, bemerkten sie Kratzspuren an ihm und verhafteten die Frau wegen häuslicher Gewalt.
Es dauerte nicht lange, dann wurde ich von den Vollzugsbeamtinnen in ein Hinterzimmer gebracht, wo sie eine komplette Leibesvisitation an mir vornahmen und mir dann einen Overall gaben, in dem ich wie eine übergroße orange Karotte aussah.
Ich war damals so dünn und zart, dass mir die Kleider wortwörtlich vom Körper fielen.
Dann erklärte mir eine der Beamtinnen, dass ich die Nacht hier verbringen würde.
„Moment“, sagte ich. „Einer eurer Kollegen hat mir gesagt, dass ich gar nicht hier sein sollte. Ich sollte gar nicht hier sein. Ich gehöre hier nicht her!“
Die Wachebeamtinnen lachten, und dann brachten sie mich in den Haupttrakt des Gefängnisses.
„Leute, ich gehöre hier wirklich nicht her.“
Ich wiederholte diesen Satz vielleicht 20-mal, doch als sie mich zusammen mit all den anderen Frauen in die Zelle brachten, kam es mir in den Sinn, dass ich vielleicht doch hierhergehörte. Langsam erkannte ich, dass das hier alles real war, und nun fürchtete ich mich wirklich.
Ich gehe ins Gefängnis, und ich werde die ganze Nacht unter diesen Kriminellen verbringen. Dabei bin ich gar keine Kriminelle, dachte ich zumindest.
Natürlich war ich kriminell. Selbst wenn ich glaubte, dass ich niemanden anderen verletzt hatte, mit dem, was ich tat, so war es dennoch eine strafbare Handlung. Abgesehen davon hatte ich andere Menschen verletzt. Ich hatte sogar jene Leute verletzt, die mir am nächsten standen, doch ich bekam es nicht mit, da ich nur mit meiner Sucht beschäftigt war.
Man händigte mir eine Zahnbürste, einen Kamm und eine Wolldecke aus. Ich hasste es, wie sich die Decke anfühlte. Sie kratzte, und dann war da noch etwas. Irgendwie fühlte sie sich ekelig an und gebraucht und sehr, sehr verstörend. Später, immer wenn ich nach einem langen Rennen ins Ziel kam und vor Kälte oder Unterkühlung zitterte und man mir eine dieser Wolldecken um die Schultern legte, schrie ich die Person an, sie wegzutun.
In der Zelle hing ein Spiegel aus rostfreiem Stahl, und ich konnte mich darin zusammen mit dieser furchtbaren Decke und dem orangen Overall sehen. Da fragte ich mich, was mich der Polizist zuvor schon gefragt hatte.
Was tue ich hier?
Das bin nicht ich, dachte ich. Ich war kein schlechter Mensch, das hatte auch der Polizist gemeint. Und ich wollte nicht länger hier sein. Etwas musste sich ändern.
Am nächsten Morgen, nach einer schlaflosen, angsterfüllten Nacht zusammen mit all den anderen Kriminellen, saß ich nun mit diesen Frauen beim Frühstück, stocherte an einem ekeligen Sandwich und etwas Obst und Orangensaft herum. Eine der Frauen fragte mich, ob sie mein Sandwich haben könnte, und ich gab es ihr. Dann sagte ich ihnen, dass ich heute sowieso wieder rauskommen würde.
„Oh, nein, du kommst hier nicht raus“, sagte eine von ihnen. „Sie entlassen nie jemanden am Samstag. Vor Montag bekommst du keine Anhörung.“
Das war niederschmetternd, und ich wurde noch ängstlicher. Ich begann wieder zu weinen. Ich war verzweifelt. Ich wollte nicht hier im Gefängnis sein, unter diesen Kriminellen, und ich konnte auch meine eigene Gesellschaft nicht mehr ertragen. Ich fühlte mich wie eine Kriminelle. Es war ein Gefühl, das ich nicht ausstehen konnte.
Plötzlich hörte ich, wie mein Name aufgerufen wurde.
Ich würde entlassen werden.
Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Und obwohl ich es zu dieser Zeit noch nicht wusste, hatte ich gerade meinen ersten Schritt heraus aus meiner Drogensucht gemacht.
XXX
Als meine Anhörung begann, plädierte mein Anwalt darauf, dass ich nicht ins Gefängnis gehen sollte. Er erklärte dem Richter, dass ich einen Job hatte und ein ambulantes Rehabilitationsprogramm absolvieren würde. Der Richter erklärte sich einverstanden und ermöglichte eine Diversion. Dafür musste ich mich zu einem Entwöhnungsprogramm verpflichten. Das hieß, wenn ich das Programm absolvieren würde und alle wöchentlich durchgeführten Drogentests negativ wären, würden sie alle Anklagepunkte gegen mich fallen lassen.
Als ich damit begann, die mir auferlegten Treffen zu besuchen, war ich schon etwas darüber erstaunt, wie viele dieser Menschen noch immer Drogen nahmen. Ich ging zu den Treffen, und in den Pausen fragten mich die anderen Teilnehmer, welchen Trick ich anwendete, um die Urintests zu bestehen. Es gibt alle möglichen Tricks, um deine Urinprobe zu verfälschen, und sie verglichen ihre Methoden.
Ich sagte, ich würde einfach keine Drogen mehr nehmen. Das überraschte sie anscheinend. Als wir dann in den Meetings saßen, erkannte ich mit der Zeit, dass alle dort ihre eigene Geschichte hatten. Sie alle hatten schon eine Menge verrücktes Zeug gesehen und durchgemacht. Sie hatten Menschen sterben gesehen, sogar enge Freunde oder Familienmitglieder. Einige von ihnen, darunter auch Frauen, waren Mitglieder von Straßengangs. Sie hatten schon Zeit im Gefängnis verbracht.
Ich lehnte mich zurück und hörte den anderen zu. Sie mochten es nicht, dass ich so ruhig war. Also forderten sie mich auf, mehr beizutragen, doch ich hatte einfach noch nicht so viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht wie sie. Ich erklärte ihnen, dass ihre Geschichten viel interessanter seien als die meinigen. Im Gegensatz zu mir hatten sie so viel mehr zu sagen.
Nach sechs Monaten bei den Narcotics Anonymous war ich nicht mehr verpflichtet, die Meetings zu besuchen, doch ich ging trotzdem weiter hin. Genauer gesagt, besuchte ich die Treffen für weitere sechs Monate, doch ich bekam bald das Gefühl, dass diese Meetings nichts für mich waren. Alles, was die Teilnehmer dort taten, war, über die Vergangenheit zu sprechen. Ich wollte aber nach vorne blicken und mich auf die Zukunft konzentrieren. Ich hatte kein Bedürfnis, die Vergangenheit wieder und wieder aufzuwärmen.
Nach unserer Festnahme war die Beziehung zwischen Jason und mir nicht mehr dieselbe, doch ich lebte weiterhin bei ihm und seinen Eltern.
Ich versuchte, weiter meine alten Freunde in den Nachtclubs zu treffen und mit ihnen auszugehen, doch alle rauchten und tranken Alkohol. Die Nachtclubs fühlten sich nicht mehr so an wie früher. Sie hatten nicht mehr denselben Reiz. Selbst die Musik klang nun anders. Ich verspürte keine Freude mehr dabei. Davor wollte ich immer tanzen und Spaß haben, wenn ich Musik hörte, aber nun hörte sich die gleiche Musik leblos an.
Ich trauerte irgendwie um die anderen. Es fühlte sich so an, als würden sie den Alkohol und die Drogen nur nehmen, um etwas zu verdrängen. Dabei verloren sie immer mehr von ihrer eigenen Persönlichkeit.
Ich fühlte mich nicht besser als sie. Tatsächlich war ich nicht einmal annähernd so glücklich wie sie. Ich war deprimiert und fühlte mich fehl am Platz, so als würde ich nicht wirklich wissen, wer ich war oder was ich hier tat. Gleichzeitig spürte ich aber auch, dass ich dabei war, mich selbst zu finden.
Ich wollte einfach nichts mehr mit dieser Szene zu tun haben.
Mein Therapeut war überglücklich, mir dabei zu helfen, mein Leben aufzuarbeiten und herauszufinden, was ich mit den Drogen verdrängen wollte. Im Drogenmilieu nannten wir das „Medicating“, und es stellte sich heraus, dass da viel mehr war, als ich anfangs gedacht hatte. Als ich jung war, waren mir einige schlimme Dinge widerfahren, und ich musste mich diesen Problemen nun stellen und sie ein für alle Mal aufarbeiten.
Ich arbeitete noch immer Teilzeit in einem Friseurladen, doch von den Drogen wegzukommen und sie und meine Freunde hinter mir zu lassen, machte mich sehr traurig. Es war schon ironisch, doch ich war trauriger als an dem Tag, an dem ich in den Spiegel geblickt und keinen Ausweg aus meiner Sucht gesehen hatte.
Ich war nicht glücklich mit Jason, ich war nicht glücklich, wenn ich mit meinen Freunden zusammen war, und eines der wenigen Dinge, die ich gerne tat, nämlich in den Nachtclubs abzutanzen, machte mir auch keine Freude mehr. Mein ganzes Leben war ein einziger Kackhaufen. Ich fühlte nichts, so als ob ich in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen wäre und es immer dunkler um mich würde.
Eines Tages beschloss ich einfach, dass ich nicht mehr weiterleben wollte. Zwar nahm ich keine Drogen mehr, doch ich hasste mich noch immer für das, was aus mir geworden war, und ich wollte, dass es vorbei war.
Ich hatte keine Pistole, und ein Messer kam auch nicht infrage, doch dann kam mir eine Idee. Tylenol.
Ich nahm eine ganze Handvoll und schluckte so viele ich konnte. Ich fing zu weinen an, und zwang mich dazu, noch mehr Tabletten runterzuschlucken.
Schließlich legte ich mich aufs Bett, das ich mit Jason teilte, und versuchte, mich in den Schlaf zu weinen. Ich hatte die Absicht, nie wieder aufzuwachen.
Dann hörte ich da plötzlich eine Stimme in meinem Kopf.
„Du bist besser als das. Aus dir wird noch etwas werden“, sagte die Stimme zu mir.
Ich habe keine Ahnung, warum ich in meinem depressiven Zustand überhaupt auf die Stimme hörte, doch ich tat es.
Ich sprang auf und wählte den Notruf und erzählte ihnen, was passiert war. Sofort kam eine Ambulanz vorbei und brachte mich ins Spital, wo sie mir den Magen auspumpten.
Es war eines der unangenehmsten Dinge, die ich jemals durchgemacht habe.
Sie schoben mir einen Schlauch in den Hals, und ich begann alles, was sich in meinem Magen befand, hochzuwürgen. Ich konnte gar nicht aufhören damit. Es war schrecklich.
Die Nacht verbrachte ich dann auf der Psychiatrie. Obwohl man normalerweise für 72 Stunden unter Beobachtung bleiben soll, wurde ich, nachdem ich mit meiner Therapeutin gesprochen hatte, wieder entlassen. Die Ärzte waren zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht wirklich umbringen wollte, auch wenn ich es versucht hatte. Bei einem weiteren Termin mit meiner Therapeutin riet sie mir, bei Jason auszuziehen, da es kein sicherer Ort für mich sei.
Ich musste ihr versprechen, dass ich so schnell wie möglich ausziehen würde. Wenn ich dies schaffte, könnte ich wieder meinen Weg gehen.
Es war mir bewusst, dass ich meine Mutter anrufen und ihr sagen musste, was sich alles abgespielt hatte.
XXX
Als ich zum Hörer griff, zitterten meine Hände. Ich wollte meiner Mutter nicht erzählen müssen, dass ich Drogen nahm. Es hätte ihr das Herz gebrochen.
Eine Tochter, die anruft und sagt, sie sei drogenabhängig, würde jeder Mutter das Herz brechen, doch da Peggy meiner Mutter bereits solchen Kummer bereitet hatte, würde es sie endgültig am Boden zerstören.
Meine Schwester Peggy war drogenabhängig, seit sie 15 Jahre alt war. Als sie süchtig wurde, versuchte meine Mutter alles, um sie wieder von den Drogen loszukriegen. Sie empfand es in vielerlei Hinsicht als ihre Mission. Meine Eltern liebten Peggy, und es brach ihnen das Herz, dass sie ihnen so viel Kummer bereitete.
Zu jener Zeit, als ich das Telefonat führte, hatte meine Mutter bereits Jahre mit den Folgen von Peggys Drogensucht leben müssen. Sie hatte Zehntausende Dollar ausgegeben, um Peggy dabei zu helfen, ihre Heroinsucht zu besiegen, doch die traurige Wahrheit war, dass sich Peggy scheinbar gar nicht helfen lassen wollte. Meine Mutter schien dies nie zu begreifen. Sie steckte Peggy in die verschiedensten Entzugskliniken und Behandlungszentren, doch es war vergeblich.
Das Traurige daran war, dass es immer wieder Phasen gab, in denen Peggy sich bessern wollte. Tatsächlich hatte es auch einmal eine Zeit gegeben, in der Peggy ganz normal war und keine Süchtige. Peggy heiratete mit 18 und hatte zwei Kinder. Es schien, als liefe alles gut bei ihr. In Wirklichkeit war aber nichts in Ordnung. Sie war nie wirklich von ihrer Sucht losgekommen, sondern hatte nur eine kleine Pause gemacht.
Drei Jahre später, im Alter von 21, traf Peggy wieder auf ihre Highschool-Liebe, und mit einem Fingerschnippen verfiel sie wieder in ihr altes Leben. Da waren wieder ihre Dämonen, die von ihr Besitz ergriffen. Sie verließ ihre Familie und lebte von nun an auf der Straße. An jenem Punkt gab meine Mutter nicht nur Geld für sie aus, sondern verbrachte Stunden damit, zusammen mit einer Freundin durch die Straßen von San Francisco zu fahren und nach Peggy zu suchen, in der Hoffnung, sie irgendwo aufzulesen und zu retten.
Damals hörte meine Mutter nur gelegentlich von Peggy. Wenn Peggy wieder einmal ein paar Dollar brauchte, kam sie vorbei. Dann sagte sie, dass sie das Geld für Zigaretten brauche. Wenn du ihr aber sagtest, dass du ihr die Zigaretten holen würdest, machte sie eine Szene. Sie wollte einfach nur das Geld.
Sie wollte das Geld, um Drogen zu kaufen. Zumindest das hatte meine Mutter erkannt, und sie weigerte sich, ihr Geld zu geben. Sie konnte nicht einmal ihre Geldbörse offen herumliegen lassen, wenn Peggy zu Besuch kam, denn dann fehlte immer Geld, und Peggy würde nicht einmal glauben, dass sie es gestohlen hatte. Denn das Schlimme war: Peggy konnte sich manchmal wirklich nicht mehr daran erinnern, dass sie es genommen hatte.
So schlimm stand es bereits um sie. Sie war komplett von der Rolle und konnte nur mehr an ihre Drogen denken. Patty und ich fragten uns damals, wie lange es dauern würde, bis die Polizei an Mutters Tür läuten würde, um ihr die Nachricht von Peggys Tod zu überbringen. Meine Mutter verdrängte diesen Gedanken komplett. Sie hatte immer die Hoffnung, dass Peggy sich wieder erfangen könnte.
Aber wenigstens war unsere Mutter nicht völlig naiv. Sie wusste, was Heroin mit einer Person anstellen konnte, und nachdem sie es bei Peggy gesehen hatte, wusste ich, dass sie sich nicht vorstellen konnte, wie jemand anderer auf das Zeug hereinfallen konnte. Sie würde nicht glauben können, dass auch ich drogenabhängig war. Peggy versuchte, meiner Mutter immer wieder von meiner Drogensucht zu erzählen. Sie erwähnte gelegentlich, dass sie glaube, ich sei auf Drogen, da ich so dünn war und mich auch so anzog. Doch Mutter glaubte ihr nicht.
Ich wollte es mir selbst ja auch nicht eingestehen. Ich war doch keine Drogensüchtige, schließlich steckte ich mir ja keine Nadel in den Arm, so wie Peggy. Peggy war die Süchtige. Ich war nicht süchtig. Doch durch die eine Nacht im Gefängnis hatte sich meine Perspektive verschoben.
Nun musste ich es meiner Mutter und mir selbst gestehen, dass ich drogenabhängig war.
„Hallo?“, sagte meine Mutter, als sie den Hörer abnahm.
Ich atmete tief durch.
„Ich will wieder zu Hause einziehen“, sagte ich.
„Kein Problem. Was ist denn los?“
„Nun ja, ich bin verhaftet worden.“
„Was?“
„Ja, wegen Drogenhandels.“
„Was?“, fragte sie nun lauter.
Ich versuchte es mit Samthandschuhen: „Wir haben gelegentlich ein wenig Speed genommen. Dann haben wir begonnen, ein bisschen davon zu verkaufen, damit wir es uns leisten können.“
„WAS?“, schrie sie nun ins Telefon.
Stille. Ich spürte, dass sie bitter enttäuscht war und auch ziemlich verärgert.
„Catra, gerade du solltest es doch besser wissen“, sagte meine Mutter schließlich. „Deine Schwester ist drogenabhängig.“
Ich wusste nicht, was ich ihr anderes hätte sagen sollte. Sie hatte vollkommen recht, doch ich fand es auch etwas seltsam, dass sie dachte, ich würde auf keinen Fall Drogen nehmen, nur weil meine Schwester abhängig war.
„Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich wieder zu Hause einziehe und in Behandlung war und zu NA-Meetings gegangen bin und es mir nun langsam besser geht“, antwortete ich.
Meine Mutter schwieg. Dann meinte sie, wenn ich wieder bei ihr einziehen wolle, müssten wir uns zusammensetzen und ich müsste ihr alles genau erzählen.
Ein paar Tage später brachten mich Jasons Eltern zum Haus meiner Mutter. Sie grüßten meine Mutter, doch sie war nicht besonders gesprächig. Meine Mutter mochte die beiden nicht, denn sie dachte, sie wären kein guter Einfluss. Vermutlich hatte sie sogar recht.
Als wir im Haus waren, befahl sie mir, mich hinzusetzen, so als wäre ich ein kleines Mädchen.
Da saß ich nun am Tisch und fühlte mich an meine katholische Erziehung erinnert.
Als kleines Mädchen musste ich immer mit zur Kirche gehen. Ich mochte die bunten Glasfenster und Statuen, doch andererseits konnte ich dieses alte, furchteinflößende Gebäude nicht ausstehen. Es roch muffig. Am meisten hasste ich den Beichtstuhl, denn dort bekam ich immer die Panik. Der Priester öffnete dieses kleine Fenster, und ich musste ihm meine ganzen Sünden erzählen. Es war eng und dunkel da drinnen, und der Priester saß auf der anderen Seite, und ich musste ihm immer zuhören, wenn er sprach, und dabei meine dunkelsten Geheimnisse verraten und auf meine Strafe warten.
So saß ich also meiner Mutter gegenüber und fühlte mich wieder wie das kleine Kind in diesem engen, dunklen Beichtstuhl, verängstigt, da ich jemandem die Wahrheit erzählen musste und dabei hoffte, nicht in der Hölle zu landen.
Ich atmete noch einmal tief durch und erzählte ihr alles. Ich erklärte ihr, dass ich mehrere Jahre lang Drogen genommen hatte.
„WARUM?“, fragte sie entsetzt.
Sie wollte nicht zuhören.
„Du solltest es doch besser wissen“, sagte sie wieder und wieder.
Sie war wütend, und zurückblickend kann ich sagen: zu Recht. Es war das Letzte, was sie brauchte, und sie befürchtete, sich erneut mit einer drogenabhängigen Tochter auseinandersetzen zu müssen. Sie hatte genug schlimme Erinnerungen an Dinge wie spät nachts durch San Francisco zu fahren und nach meiner Schwester Ausschau zu halten.
Dann kam sie wieder auf Peggy zu sprechen.
„Weißt du, Peggy hat mir gesagt, dass sie glaubt, du würdest Drogen nehmen, aber ich habe ihr nicht geglaubt, da sie selbst Drogen nimmt und nicht weiß, wovon sie redet. Aber sie hat sich nicht geirrt oder gelogen. Das war das einzige Mal, dass sie nicht gelogen hat“, sagte meine Mutter.
Also sagte ich, dass ich einfach vom Weg abgekommen sei. Sie wollte eigentlich gar nichts anderes hören als das.
Ich zog also wieder bei meiner Mutter ein, doch ich musste nach ihren Regeln leben. Sie wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht so wie meine Schwester von einem Entzug zum anderen eilte.
Wieder bei meiner Mutter in Freemont zu leben, war irgendwie deprimierend für mich. Bevor ich einzog, war ich der Meinung, dass ich mich eigentlich ganz gut schlug. Ich stand auf eigenen Beinen, verdiente genügend Geld und konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich lebte mein eigenes Leben.
Doch es war kein Leben für mich selbst. Es war ein Leben für die Drogen. Ja, ich verdiente gut, doch das Geld ging für die Drogen drauf. Ja, ich stand auf eigenen Beinen, doch ich lebte zusammen mit Jason und seiner verkorksten Familie.
Ich ging zu NA-Meetings und zu wöchentlichen Drogentests und arbeitete, aber es war mir peinlich, was aus mir geworden war. Ich war von meinem Weg abgekommen. Ich war traurig und hatte das Gefühl, meine Mutter enttäuscht zu haben.
Schlussendlich wollte ich mit diesen scheußlichen Drogen ein für alle Mal abschließen. Ich wollte ein neuer Mensch werden. Vielleicht der Mensch, der ich schon längst hätte sein sollen. Zu dem Menschen, wie es vermutlich auch mein Vater gewollt hätte.
Also begann ich mit dem Laufen.