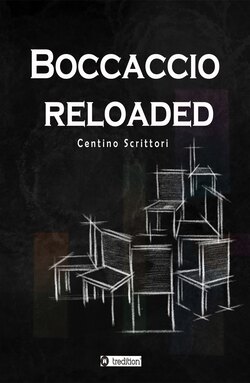Читать книгу Boccaccio reloaded - Centino Scrittori - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZWEITER TAG
Als ich heute in den Gemeinschaftsraum komme, bin ich sogar noch aufgeregter als gestern. Hat es den Leuten gefallen? Werden sie wiederkommen? Ich bin erleichtert, als ich einige Gesichter von gestern, aber auch einige neue sehe. Wir warten noch relativ lange auf einige Leute, bevor wir anfangen.
Erste Geschichte
„Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin heute in der Stimmung für spannende Geschichten “, sagt eine junge Frau, die gestern auch schon dabei war. Ein ziemlich großer, junger Mann kommt mir zuvor und antwortet: „Ich glaube, da habe ich die richtige Geschichte.“
Flammen! Überall Flammen! Das ist das Erste, was ich sehe, als ich aus meinem einigermaßen guten Schlaf erwache. Ich springe auf, schmeiße meine Decke beiseite und bahne mir meinen Weg zu meiner Schwester. Laura ist vor Angst erstarrt. Sie schreit nur: „TOM! TOM!“ Ich atme schwer und meine Augen tränen extrem von dem dicken Rauch. Ich nehme Laura in die Arme und taste mich krabbelnd voran. Ich spüre, wie meine Haut verbrennt und sich langsam aber sicher Blasen bilden. Ich will mir nicht vorstellen, wie sie verheilt aussieht. Um das zu sehen, muss ich es aber hier erst einmal lebend herausschaffen. Endlich erreiche ich den Ausgang. In ihm ein brennender Stofflappen, welcher zumindest für ein bisschen Privatsphäre in diesem Drecksloch sorgen sollte. Ich reiße ihn zur Seite und hechte nach draußen. Erst später erkenne ich die wütende Meute. Sie schreien irgendwelche Wörter, doch ich verstehe kein Arabisch. Ich bin mir aber sicher, dass es Beleidigungen sind. Wahrscheinlich Beleidigung gegen Deutsche oder Christen oder beide. Ein paar von ihnen halten Molotow-Cocktails in ihren Händen, andere Macheten oder improvisierte Waffen. Das wird wohl das Ende sein.
Wir hatten es schon weit geschafft. Von Deutschland zu Fuß bis nach Italien und von da in einem überfüllten Boot nach Afghanistan. Alle sagten, hier wäre das Leben besser, hier gebe es Frieden und Wohlstand. Aber daran glaube ich schon lange nicht mehr. Sie wollen uns hier nicht. Sie denken, alle Christen wären gleich und verbreiten Terror, wie der CS, was für „Christlichen Staat“ steht. Wie der Name schon sagt, wollen sie einen „Christlichen Staat“ gründen und streng gläubig leben. Die Anhänger leben extrem christlich und sprechen sich das Recht zu, alle „Ungläubigen“ umzubringen. Es reicht aus, gegen eines der Zehn Gebote der Bibel verstoßen zu haben. Sie waren für eine Serie von Anschlägen auf allen Kontinenten verantwortlich und stützten durch extreme, rücksichtslose Gewalt Europa und Amerika in Chaos. Millionen von Christen sind geflohen, meistens illegal, in den mittleren Osten.
Ein großer Teil der Einheimischen ist hilfsbereit und sie verstehen uns, es gibt jedoch Organisationen und Einzelpersonen, die Anschläge auf uns verüben, wahrscheinlich aus Angst und Hass. Es waren anfangs nur Beleidigungen, dann Schläge, ich hätte jedoch niemals gedacht, dass die Arschlöcher so weit gehen und einen Brandanschlag verüben. Sie sollten mal selber erleben, wie es ist, alles zurückzulassen und vor Terror, Krieg und Chaos zu fliehen.
Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Etwas zerschellt neben mir. Es war ein Molotow-Cocktail, der Hurensohn, der ihn geworfen hat, war aber zu meinem Glück zu dumm, ihn richtig anzuzünden. Ich renne nach links, überall um mich herum Flammen und in ihnen schreiende, brennende Leute. Ich kann ihnen jetzt aber nicht helfen. Ich muss mich zuerst um mich und meine Schwester kümmern. Um mich besser zu fühlen, rede ich mir ein, dass ich zurückkomme. Ich weiß jedoch selber, dass es nicht so kommen wird.
Während ich weggucke, stolpere ich über einen Halbtoten mit einer Eisenstange in der Brust. Er röchelt um Hilfe, aber ich kann nicht. Ich schiebe ihn zur Seite und renne weiter. Es sind noch um die 150 Meter bis zur Essensausgabe. Sie ist aus festem Stein gebaut und ich hoffe, darin Schutz zu finden. 100 Meter. 50 Meter. 25 Meter. Vor mir ist ein anderer Typ. Er hatte wohl dieselbe Idee wie ich. Er reißt die Tür auf. Plötzlich gibt es einen Schlag, und ich sehe nur noch seinen Körper, der Kopf fehlt jedoch. Stattdessen ist an der Stelle des Kopfes eine Blutfontäne. Die Propangasflaschen haben der Hitze wohl nicht standgehalten. Sein Kopf wurde von einem Ventil abgefetzt. Die Küche ist also offensichtlich nicht sicher, deshalb sprinte ich weiter Richtung Markt. Ich drehe mich um, als ich hinter mir schreckliche Schmerzensschreie höre. Ein Mann rennt brennend wild herum und bleibt schließlich bewegungslos liegen. Im selben Moment trifft mich etwas Hartes am Schädel und ich falle ohnmächtig zu Boden.
Ich werde von einem Schlag ins Gesicht geweckt. Vor mir steht ein Mann mit Turban und riesigem Bart. Er lächelt grässlich, labert irgendein Zeug, das ich eh nicht verstehe, und richtet eine Pistole auf mich. Ich erinnere mich an einen Entwaffnungstrick aus einer Serie, die ich früher geguckt habe. Jetzt gehe ich jeden Schritt noch einmal innerlich durch. Als er das Schlagstück spannt, greife ich blitzschnell an. Ich hätte niemals gedacht, dass es klappt, doch das hat es. Jetzt bin ich der mit der Waffe und er das kleine hilflose Opfer. Ich erinnere mich auch an den Rat, nicht zu zögern, sondern direkt abzudrücken. Das tue ich. Ich ziele in sein hässliches Gesicht und drücke ab. Volltreffer. Sein halber Kopf ist zerschmettert und er fällt zu Boden. Ich fühle mich mächtig. Die Waffe stecke ich ein, nehme meine Schwester und laufe weiter.
Kurze Zeit später knallt es hinter mir und eine Kugel schlägt genau neben mir in einen Tisch ein. Ich schmeiße mich auf den Boden und stelle mich tot. Meine Hand bewege ich langsam zu meiner Pistole, den Finger am Abzug. Die Schritte kommen näher. So wie es sich anhört, sind es zwei Männer. Die Schritte kommen näher. Ich halte meinen Atem an. Sie beugen sich über mich und lachen gehässig. Einer der beiden will wohl prüfen, ob ich noch lebe, und legt seine Finger an meinen Hals. Ich rolle mich zur Seite und jage ihm eine Kugel ins Kinn. Sein Blut und vielleicht auch ein Teil seines Gehirns spritzen auf den zweiten. Er greift panisch zu seiner Waffe und schießt wild drauf los. Ich bin währenddessen hinter ein Auto geflüchtet. Als er sein Magazin leergeschossen hat, renne ich auf ihn zu und schieße ebenfalls. Zu seinem Unglück treffe ich. Nun nehme ich auch noch seine Waffe und renne in Richtung Krankenhaus. Es müssten von hier noch ungefähr 1000 Meter sein. Das sollte relativ schnell zu schaffen sein.
Ich denke an meinen Vater und meine Mutter, die sich dem CS widersetzt haben und das mit ihrem Leben bezahlt haben. Sie wurden kaltblütig abgeschlachtet. Kurz vor dem Krankenhaus verstecke ich meine beiden Waffen hinter einem Busch und versuche mir den Ort einzuprägen. Um besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen, renne ich in die Notaufnahme und werfe mich auf den Boden, nachdem ich wild geschrien habe. Meine Taktik funktioniert, die Ärzte kommen direkt auf mich zugerannt und fahren meine Schwester und mich auf Liegen weg. Zu meiner Verwunderung fahren wir jedoch nicht wie gewohnt nach oben, sondern nach unten. Drei der anwesenden Männer sehen außerdem nicht aus wie Ärzte oder Krankenhauspersonal. Sie verabreichen uns eine Spritze und ich schlafe ein.
Später wache ich wegen einem kalten Eimer Wasser auf und finde mich und Laura in einem dunklen Kellerraum wieder. Ich versuche aufzustehen, aber ich werde durch dicke Ledergurte gehalten. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass wir hier nicht hingebracht wurden, damit uns geholfen wird. Die schwere Metalltür öffnet sich, und ein Mann mit verzierten Gewändern, einem riesigen Turban und Goldschmuck geht mit schweren, langsamen Schritten auf uns zu. Hinter ihm werden die drei von mir erschossenen Männer und ein Wagen mit kleinen spitzen Zangen und allerlei Werkzeug und Messern hineingeschoben.
Der erste muss ihr Anführer sein. Auch wenn ich nicht verstehe, was sie sagen, kann ich es mir denken. Sie wollen sich an mir rächen. Der Anführer gibt ein Handzeichen und ein kleiner fetter Typ aus der Ecke nimmt sich fröhlich eine Zange vom Wagen und geht langsam auf Laura zu. Mir ist klar, ich muss mich lösen und uns hier rausholen. Da spüre ich einen leichten Druck unter mir. Es ist das kleine Schweizer Taschenmesser, was mir mein Vater zu meinem achten Geburtstag geschenkt hat. Ich trage es seitdem in meiner hinteren Hosentasche. Langsam bewege ich meine Hand und umfasse es. Ich klappe leise die Säge aus und fange an, den Gurt zu bearbeiten. Aber was mache ich, wenn ich mich lösen kann? Ich bin allein, nur mit einem mickrigen Taschenmesser, und sie sind sechs Mann mit Pistolen und Gewehren. Ich muss improvisieren, also säge ich weiter, bis die Gurte gelöst sind, stürze mich dann so schnell wie es geht auf den Bastard neben Laura und ramme ihm meine stumpfe Klinge in den Hals. Ich packe ihn, nehme seine Waffe, stoße Lauras Liege um und benutze sie als eine Art Schutzschild, um den Kugelhagel abzuwehren. Als sie endlich nachladen oder ihre Pistolen ziehen wollen, ballere ich los und drehe mich von links nach rechts, bis das Magazin leer ist. Das Schreien der Bastarde hat sich währenddessen in ein leises Röcheln verwandelt.
Alle liegen nun regungslos am Boden, bis auf den Anführer. Er hat nur einen Schuss in sein linkes Bein abbekommen und robbt in Richtung Tür. Ich gehe auf ihn zu, stoppe ihn mit meinem Fuß, drehe ihn auf den Rücken und schlage ihm mit der Rückseite meines Gewehres den Schädel ein.
Jetzt laufe ich zu meiner Schwester, die zum Glück nichts gesehen hat, und inspiziere sie. Sie ist nur leicht verletzt. Eine leichte Verbrennung und eine Quetschung. Ich nehme sie auf den Rücken und suche langsam und vorsichtig den Ausgang. Draußen angekommen, laufe ich zu einem Polizisten, dem ich vertraue und lasse mich von ihm zu einem richtigen Arzt bringen. Hoffentlich werden wir in Zukunft in Ruhe gelassen und leben in Frieden.
(Aaron Holzhäuer)
Zweite Geschichte
„Oh wow, das war wirklich eine spannende Geschichte“, sage ich und auch die Anderen scheinen ziemlich aufgebracht. Ein Mädchen, das mir in den letzten beiden Tagen noch nicht wirklich aufgefallen ist, sagt schüchtern: „Kann ich vielleicht die nächste Geschichte erzählen?“ Natürlich stimmen alle zu. Sie nennt ihre Geschichte „Auf der Flucht mit nur 51/2“ und beginnt.
Mein Name ist Greta. Ich bin 15 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich wohne mit meinem Vater im Prenzlauer Berg in einer Wohnung. Für mich ist es normal, dass ich ein Dach über dem Kopf habe oder mir immer etwas aus dem Kühlschrank nehmen kann, wenn mir danach ist. Mein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, aber dennoch kann ich mir immer neue Klamotten kaufen. Ich habe ein Zuhause, in dem ich mich wohl und geborgen fühle und wohin ich immer wieder zurückkehren kann. Jedoch gilt das, was für mich selbstverständlich ist, nicht für jeden. Viele Menschen mussten aus den verschiedensten Gründen fliehen oder müssen es heutzutage immer noch. So hatte es auch meine Oma getroffen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Zuhause unfreiwillig, mit nur fünfeinhalb Jahren verlassen musste. Das hat sie mir darüber erzählt:
„Ich wohnte mit meiner Familie in Schlesien. Es war im Januar 1945. Ich weiß noch ganz genau, wie wir an einem Sonntagmittag mit der ganzen Familie, bestehend aus Uroma, Oma, Opa, Mutter und Onkel, Klöße und Rouladen aßen, als russische Soldaten in unser Haus gestürmt kamen. Ihre Gewehre richteten sie auf uns. Wir mussten alles sofort stehen und liegen lassen und durften nur kurz ein paar Kleinigkeiten zusammenpacken. Alle Schlesier wurden vertrieben. Nun begann die Flucht Richtung Westen, ins Ungewisse. Wir waren lange unterwegs, meistens zu Fuß. Manchmal war auch ein Pferdegespann unsere Rettung. Ich war noch so klein, dass ich nicht verstanden habe, warum wir nicht nach Hause konnten. Ich weinte und schrie, doch das hat meiner Mutter keine bessere Laune gemacht. Meine Beine taten mir schrecklich weh, auch wenn ich oft getragen wurde, weil ich zu langsam für die Anderen lief. Das viele schutzlose und ziellose Laufen endete oft mit Erschöpfung und leerem Magen. Geschlafen haben wir sehr oft in Scheunen im Stroh. Wir haben tagelang nicht genug, bis gar kein Essen bekommen. Der Hunger war unser ständiger Begleiter. Es gab immer wieder Bauern, die uns kein Essen geben oder uns nicht bei sich schlafen lassen wollten. Einige wollten einen Gegenwert, wie Bettwäsche, Besteck oder Schmuck, doch den konnten wir ihnen nicht bieten. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu betteln. Es gab zum Glück auch immer wieder Menschen, die uns ein wenig abgaben, worüber wir mehr als glücklich waren. Doch da Essen allgemein sehr knapp war in der Zeit, gab es viele Tage ohne auch nur einen Bissen Brot oder einen Schluck Wasser.
Wir waren zu sechst unterwegs: meine Uroma, Oma, Opa, Mutter, Onkel und ich. Mein Vater war nicht dabei, weil er schon lange davor als Soldat in den Krieg geschickt worden war. Meine Uroma machte es uns auch nicht besonders leicht, da sie Alzheimer hatte und immer wieder in ihrer Verwirrung weglief. Die Suche nach ihr hat meinen Onkel oft Stunden und viele Nerven gekostet.
Ganz besonders erinnere ich mich noch an das durchdringende Heulen der Sirenen, die die Bomberflieger ankündigten. Dieses Geräusch werde ich wohl nie vergessen. Auch wenn ich noch sehr jung war, spürte ich deutlich die Angst und Furcht, die dieser Klang in mir und jedem Einzelnen auslöste. Wenn sich ein Bunker in der Nähe befand, waren wir froh und versuchten so schnell wie möglich dort unterzukommen. Meine Mutter packte mich immer fest an meinem Arm, damit ich in den Menschenmassen nicht verlorenging. Die Bunker waren beängstigend eng und stickig. Man konnte die Angst, Panik und Unsicherheit in den Augen der Leute sehen. Man hörte, wie die Bomben den Boden trafen und alles zerstörten, und jeden Moment hätte eine Bombe über uns einschlagen können und alles wäre zugeschüttet gewesen. Das Einzige, was wir machen konnten, war hoffen, dass es bald vorbeiging. Doch die Zeit in den Bunkern schien endlos langsam zu vergehen. Und draußen lauerte der Tod. Sobald es eine längere Zeit ruhig war, begannen die Leute nach rechts und links zu den Anderen zu gucken und abzuwägen, ob man es jetzt wieder wagen konnte rauszugehen. Denn wenn man zu früh rausging, kann sich jeder ausmalen, was hätte passieren können.
Als wir draußen waren, ging der Marsch gleich wieder los. Laufen, laufen und immer weiterlaufen. Unser Weg führte durch die verschiedensten Städte und Dörfer, doch wir fanden keine Unterkunft, es schien alles hoffnungslos. Unterwegs geschahen schreckliche Dinge, die ich selbst meinem Erzfeind nicht wünsche. Eines Nachts bekam ich mit, wie russische Soldaten anfingen, meine Mutter zu belästigen. Die Anderen schliefen seelenruhig und ich war zu jung, um zu verstehen, was da gerade vor sich ging, und selbst wenn, hätte ich nichts gegen drei große, starke Männer tun können. Ich musste also zusehen, wie meine Mutter vor meinen Augen von ihnen vergewaltigt wurde. Dieses Bild werde ich wohl nie mehr los. An einem anderen Tag wollten Soldaten meinen Opa erschießen, doch er hatte es irgendwie geschafft, dass sie es ließen. Die Angst war immer da.
Nach vielen weiteren Irrwegen bekamen wir dann endlich ein Zuhause in Gebelzig bei Görlitz, es war inzwischen April 1945. Die Wohnung hatte zwar nur ein Zimmer und eine Küche und wir schliefen zu sechst auf zwei Strohsäcken, doch in diesem Moment erschien es mir wie ein Paradies. Wir waren überglücklich, endlich ein Dach über dem Kopf zu haben und alle mehr oder weniger heile hier angekommen zu sein. Die Dorfbewohner waren allerdings nicht so begeistert über unsere Ankunft wie wir. Es war anfangs sehr schwer in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden, doch irgendwann gelang auch das und ich fand sogar Freunde zum Spielen.“
Als meine Oma mir all das erzählt hatte, war ich sehr berührt und auch traurig darüber, was sie alles hatte durchmachen müssen. Und umso mehr weiß ich es nun zu schätzen, wie behütet und friedlich ich bisher aufgewachsen bin und dass es nicht selbstverständlich ist. Während meine Oma mit noch nicht einmal sechs Jahren schon solche Strapazen und Leid erleben musste, konnte ich einfach unbeschwert ein Kind sein und mit meinen Freunden spielen. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass meiner Oma so etwas passiert ist. Daran merke ich, dass man einem Menschen nicht ansehen kann, was er schon alles durchgemacht hat. Ich bin froh, dass meine Oma, trotz – oder vielleicht auch durch – all die schwierigen Erlebnisse aus der Zeit von Krieg, Flucht und Vertreibung zu so einem liebevollen und großzügigen Menschen geworden ist.
(Greta Riedel)
Dritte Geschichte
„Dass man so etwas in einem so jungen Alter erleben muss… wirklich eine Schande!“, merkt die ältere Dame an. Ein alter Herr meldet sich stolz zu Wort: „Eine Geschichte aus dieser Zeit habe ich auch beizusteuern!“ Gespannt hören alle anderen zu.
Heute möchte ich eine Geschichte erzählen. Sie basiert auf einer wahren Begebenheit und spielt sich im Zweiten Weltkrieg ab. In dieser Geschichte geht es um Krieg, um Vertreibung aus der eigenen Heimat und um Flucht im eigenen Land. Es soll in dieser Geschichte die damalige Flüchtlingssituation dargestellt werden und der Hass, der den Flüchtlingen schon damals, obwohl man aus dem gleichen Land kam, entgegengebracht wurde. Alles begann 1937 mit der Geburt eines Kindes, in der Stadt Danzig. Bis 1940 verbrachte ich ein unbeschwertes Leben, mein Vater war Uhrmacher und meine Mutter kümmerte sich als Hausfrau um den Haushalt und arbeitete dazu in einer Fabrik, in der Blechkonserven hergestellt wurden.
Doch in meinem dritten Lebensjahr brach der Zweite Weltkrieg aus. Mein Großvater und Vater wurden eingezogen und mussten im Krieg für die Deutschen kämpfen. Zwar sind die Erinnerungen heute ein bisschen verschwommen, da ich damals noch relativ jung war, aber trotzdem kann ich mich noch gut an die darauffolgenden, schrecklichen fünf Jahre Krieg erinnern, die ich miterleben musste. Da Danzig erst zum Deutschen Reich gehörte, aber dann nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag zu einem Freistaat erklärt wurde, hatte Deutschland von Anfang an ein großes Interesse an Danzig. Das lag aber auch daran, dass in Danzig überwiegend Deutsche lebten, und so gelangte 1933 auch die NSDAP in Danzig an die Macht und führte es in eine finanzielle Abhängigkeit vom Dritten Reich. 1939 folgte der Anschluss von Danzig durch eine völkerrechtswidrige Verfügung an Deutschland und wurde ab da zum Feind gezählt. Besonders prägende Erinnerungen aus der Kriegszeit sind für mich der ständige Bombenalarm und die immer schlimmer werdende Zerstörung der Stadt. Ein besonders prägendes Ereignis geschah eines Nachmittags, als ich mit meiner Mutter einkaufen ging, und auf einmal der Alarm ertönte. Wir gerieten in Panik und wussten nicht wohin, als man schon die Flieger hören konnte. Auf einmal schlugen die Bomben ein, meine Mutter und ich flohen in einen Laden, in dem sie mich in einer riesigen Schublade eines Regals versteckte, um mich in Sicherheit zu bringen. In dieser Schublade war es dunkel und stickig. Ich hatte riesige Angst, denn man konnte spüren und hören wie die Bomben einschlugen. Als es vorbei war, traute ich mich so lange nicht raus, bis meine Mutter die Schublade öffnete und mich rausholte. Bis heute hat sich dieses Erlebnis eingebrannt.
Wen es dabei schwerer traf als mich, war meine Cousine, die während diesem Bombardement bei sich zu Hause war. Ein Bombensplitter, von einer Bombe, die gegenüber von ihrem Haus einschlug, traf sie und durchbohrte ihre rechte Brust. Da war ich noch ganz gut weggekommen. Solche Geschehnisse trugen sich des Öfteren während des Krieges zu. Gegen Ende des Kriegs wurde Danzig von der Roten Armee eingenommen und das Wenige, was noch stand, wurde von ihr zerstört. Da dann Danzig zu Polen gehörte, wurden die meisten Deutschen aus Danzig vertrieben. Wir hatten aber polnische Verwandte und konnten uns dadurch zwischen der polnischen Staatsbürgerschaft oder einer Flucht nach Deutschland entscheiden. Meine Mutter entschied sich gegen die polnische Staatsbürgerschaft, da sie sich immer noch als deutsche Staatsbürgerin sah, und so flohen wir zusammen mit meiner Cousine, die um acht Jahre älter war als ich, und ihrer Familie nach Deutschland. Jeder nahm gerade so viel mit, dass es in einen kleinen Rucksack passte, was nach dem Krieg nicht wirklich schwer war, da man sowieso nicht wirklich mehr besaß.
Es war schrecklich, seine Heimat zu verlassen, aber fast alle deutschen Bürger in Danzig verließen sie, auch freiwillig, aber meist gezwungenermaßen. Wir hatten weder ein konkretes Ziel in Deutschland, noch irgendwelche Verwandte, zu denen wir hätten gehen können. Also machten wir uns gewissermaßen ziellos auf den Weg. Außerdem war es ungewiss, ob ich meinen Vater wiedersehen würde, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zurückgekehrt oder in irgendeiner Weise mit uns in Kontakt getreten war.
Wir legten die Strecke überwiegend zu Fuß zurück. Es war erschreckend, wie zerstört und verarmt Deutschland war. Viele Bürger litten unter Hunger und viele waren durch den Krieg obdachlos geworden. Dies führte oft dazu, dass wir, obwohl wir selber deutsche Bürger waren, in den meisten Ortschaften, an denen wir vorbeikamen, keinerlei Unterstützung erhielten. Dies war ja auch teilweise verständlich, da sie selber so gut wie nichts hatten, aber sie hatten eine sehr negative Einstellung uns gegenüber. Sie hassten uns regelrecht und es kam mir so vor, als würden sie uns die Schuld für alles geben, was ihnen widerfahren ist. Ich, weil ich so jung war, bekam das nicht so mit, wie meine Mutter und meine Cousine, litt aber genauso darunter. Man wollte uns nirgendwo unterbringen oder Obdach gewähren. Wir mussten so gezwungenermaßen eine Weile von Ortschaft zu Ortschaft weiterfliehen. Während dieser monatelangen Flucht litten wir unter Hunger und an sauberem Trinkwasser mangelte es auch. Am Ende gelangten wir in eine größere Ortschaft, wo man uns versprach, uns in eine Art neuerrichtetes Flüchtlingscamp, in einer Stadt namens Glöwen zu bringen.
Da wir keine andere Möglichkeit hatten, stiegen wir am nächsten Tag in den Zug ein, der uns und hunderte von anderen Flüchtlingen in dieses Lager bringen sollte. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es einen kleinen Hoffnungsschimmer für uns gab, als wir davon hörten. Dieser Hoffnungsschimmer verschwand aber, als wir in das bis zum Rand gefüllte Abteil einstiegen. Dieser Zug hatte anscheinend schon an vielen anderen Stationen Leute mitgenommen. Der Gestank, als wir einstiegen, war bestialisch. Das lag daran, dass es keine Toiletten gab. Doch die Menschen, in diesem Abteil, die schon ein bisschen länger mit dem Zug mitgefahren waren, sagten uns, dass wir Glück hätten, da dies das Abteil für Familien und noch das beste von allen sei. Dadurch dass viele Zugstrecken durch den Krieg zerstört waren, dauerte die Fahrt mehrere Tage und deshalb waren wir gezwungen, schmutziges Wasser zu trinken, um zu überleben. Durch das verschmutze Wasser erkrankte meine Mutter an Typhus, einer Infektionskrankheit die durch Salmonellen hervorgerufen und besonders über Wasser verbreitet wird. Wir hatten erst die Hoffnung, dass im Flüchtlingslager die humanitäre Situation besser wäre als in diesem Zug, doch da hatten wir uns zu viel erhofft.
Das Flüchtlingslager war vollkommen überfüllt und wir mussten trotz niedriger Temperaturen in halb zerstörten Baracken schlafen, was nicht zur Genesung meiner Mutter beitrug. Es gab keine richtigen Betten, also mussten wir auf dem eiskalten Boden schlafen. Sie litt wochenlang am hohen Fieber und durch die derzeitige Situation, in der wir uns befanden, schwebte sie wochenlang zwischen Leben und Tod. Doch nach Wochen langen Bangens um ihr Leben begann sich ihr Zustand zum Glück zu verbessern. Diese Erkrankung fesselte uns ganze zwei Monate an den schrecklichen Ort. Wegen der Überfüllung dieses Lagers gab es auch dort weder genügend Essen, noch sauberes Trinkwasser. Man durfte das Lager ohne spezielle Papiere nicht so einfach verlassen, wir hätten aber sowieso nicht gewusst, wohin wir hätten gehen können. Also waren wir fast über ein halbes Jahr an diesem Ort gefangen.
Da es dort in der Nähe riesige Spargelfelder gab, wurden wir Flüchtlinge dort als Erntehelfer eingesetzt. Das hatte aber auch einen kleinen Vorteil, da man ab und zu den Spargel, der nicht gut genug war, um ihn zu verkaufen, mit nach Hause nehmen durfte. Dies war damals etwas Neues für uns, da es keinen Spargel in Danzig gab, und es war jedes Mal wie ein Sonntagsessen, wenn meine Mutter mit Spargel zurückkam. Dies ging wie gesagt ein halbes Jahr so, bis auf einmal mein Vater vor uns stand. Er hatte den Krieg überlebt, das hatte er den Amerikanern zu verdanken. Denn er war während des Krieges in amerikanische Gefangenschaft geraten und hatte deshalb überlebt. Nach dem Krieg glaubten sie, es sei nicht mehr nötig, die Soldaten, die meistens gezwungen wurden zu kämpfen, weiterhin festzuhalten. So kam mein Vater frei und machte sich auf die Suche nach uns. Als er über das Rote Kreuz erfuhr, wo wir uns befanden, machte er sich direkt auf den Weg.
Um uns aus diesem Lager holen zu können, brauchte er spezielle Zulassungspapiere, die er natürlich nicht hatte. Er schaffte es aber trotzdem, dem Zuständigen so überzeugend zu vermitteln, dass er die Papiere hätte, dass er ihm glaubte. So nahm er uns mit nach Frankfurt, da dort die Besatzungszone der Amerikaner war. Mein Vater war nach dem Krieg kaum wiederzuerkennen. All seine Haare waren ihm ausgefallen, aber das waren nicht die einzigen Spuren, die der Krieg hinterlassen hatte. Doch er wollte nicht mehr zeigen und reden tat er auch nicht darüber. Er bekam von den Amerikanern einen Job am Flughafen von Frankfurt, wo er die nächsten dreißig Jahre arbeitete. Ich konnte endlich eine Schule besuchen, das war etwas ganz Besonderes für mich. Besonders, als ich mit meiner eigenen Schultüte vor der Schule stand. Das Foto von diesem Moment habe ich bis heute in meiner Wohnung an der Wand hängen. Ab dem Zeitpunkt konnte es nur noch Berg auf gehen. Nun lebe ich schon 73 Jahre in Frankfurt und erzähle meine Geschichte mit Freude meinen Enkeln. Doch diese Geschichte rührt mich immer wieder, weil ich mir jetzt bewusst sein kann, wie gut es uns geht und dies auch ihnen vermitteln kann.
(Jón Seckin)
Vierte Geschichte
Diese Geschichte hat uns alle unglaublich berührt, eine Kriegsgeschichte aus eigener Erfahrung zu hören, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich denke, eine solche Geschichte prägt einen auf eine ganz besondere Art. Ein Kommentar von einer Person mit mittellangem blondem Haar reißt mich aus meinen Gedanken. „Dankeschön, dass Sie Ihre Geschichte auch mit uns geteilt haben!“ Als Nächster möchte ein Junge eine Geschichte über seine ganz persönliche Flucht erzählen. Er nennt seine Geschichte „Alleingänge“.
Der Tag begann wie jeder andere Tag von Mike. Doch dieser Tag sollte nicht wie jeder andere enden…
Mike ist 18 Jahre alt. Er lebt bei seiner Familie in New Orleans. Seine Familie Randall ist sehr wohlhabend und besteht aus vielen Familienmitgliedern, darunter auch Mike Randall. Mike ist ein witziger, entspannter, etwas arroganter, zuverlässiger und loyaler Mensch. Er lernt nicht allzu viel für die High School, aber dennoch hat er in allen Fächern gute Noten. Er prahlt gerne mit seinen sportlichen Fähigkeiten, da er Kapitän der High-School-Basketballmannschaft ist, jedoch niemals mit dem Vermögen seiner Familie, weil er weiß, dass das Geld nicht selten auf illegalem Wege gewonnen wird. Aus Loyalität gegenüber seiner Familie meldet er Verbrechen wie Waffenhandel, Drogenhandel, Bestechung, Erpressung und Mord nie der Polizei. Sein Plan für die Zukunft ist Jura zu studieren und ein erfolgreicher Anwalt zu werden, um sich von seiner machthaberischen Familie loszureißen.
Wie jeden Morgen geht Mike als erstes zum Grab seiner 16-jährigen Schwester. Ihr Name war Jenny. Sie hatte vor einem halben Jahr einen tragischen Autounfall. Sie fuhr in einer Nacht mit dem Auto von ihrem Freund Trevor Griffith auf der Autobahn. Die Randalls und die Griffiths sind jahrzehntelange Konkurrenten, denn beide sind die mächtigsten Familien in New Orleans. Als Jenny und Trevor zusammen waren, schien sich die Situation zwischen ihnen zu beruhigen. Doch nach dem Tod von Jenny entstand ein hässlicher Machtkampf zwischen ihnen.
Nachdem Mike Blumen auf das Grab seiner Schwester gelegt hat, nimmt er seine Schultasche und fährt mit seinem Motorrad zur High School. Als er dort ankommt, geht er in seinen Kurs und holt seine Sachen raus. Mike hat keine Freunde, die ihm nahestehen oder viel über ihn wissen. Sein einziger guter Freund war Trevor, doch nach dem Tod von Jenny haben sie sich auseinandergelebt, obwohl sie auch in derselben Basketball-Mannschaft spielen.
Nach der Schule geht Mike zur Basketballhalle, weil heute Training ist. Sie trainieren drei lange Stunden ihre neuen Taktiken, da am nächsten Wochenende das Spiel gegen ihren größten Rivalen der Liga stattfinden soll. Alle Spieler geben 100% und sie spielen alle unglaublich gut. Der Einzige, der negativ auffällt, ist Trevor. Es scheint ihn etwas zu bedrücken und deshalb wartet Mike nach dem Training vor dem Auto von Trevor auf ihn.
Mike fragt: „Hey Trevor. Schienst eben beim Training nicht ganz konzentriert gewesen zu sein. Alles gut?“ Trevor antwortet: „Ach… Ich glaube, ich bin momentan einfach nicht in meiner Bestform. Und meine Familie stresst mich in letzter Zeit ein wenig. Du weißt ja, wie das ist, wenn sie einen langsam in die Geschäfte reinziehen.“ „Ja, da kenn ich mich verdammt gut aus“, sage ich wahrheitsgemäß.
Trevor steigt in sein Auto und sagt: „Dann weißt du ja, wie es mir geht. Das alles ist echt nicht einfach. Tut mir leid… Ich hab’s zwar noch nie gesagt, aber mein Beileid für das mit deiner Schwester.“
„Danke… Mein Beileid mit deiner Freundin“, meine ich.
Daraufhin fährt Trevor los. Mike hat nach dem Gespräch mit Trevor ein komisches Gefühl, weil er sich etwas anders verhalten hat als sonst und ihm nicht richtig ihn die Augen sehen konnte. Mike denkt, dass es daran liege, dass sie im letzten Jahr nicht viel Kontakt hatten.
Mike fährt zu den Anwesen seiner Familie und geht in sein Zimmer. Es ist schon Abend und es dauert nicht lange, bis das Anwesen von der Polizei gestürmt wird. Die Familienmitglieder werden nacheinander festgenommen. Als Mike die Schüsse der sich wehrenden Familie wahrnimmt, schnappt er sich sein Erspartes, steigt aus dem Fenster und klettert runter zu seinem Motorrad. Er fährt stundenlang einfach nur geradeaus, weil er geschockt ist. Wenn seine ganze Familie festgenommen worden ist, kann er nicht zurück, da er auch ein Teil der Familie ist und sie ihn festnehmen würden. Sein ganzer Körper tut weh und er kann nicht glauben, was gerade passiert ist.
Schließlich kommt er an einem Motel an und ruft aus Instinkt Trevor an. Trevor geht mit einem „Hallo?“ ans Telefon. Mike ruft ganz aufgebracht: „Verdammt, Trev! Ich habe ein riesengroßes Problem. Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist.“ Trevor antwortet: „Ach, weißt du… Ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen.“
Mike ist sichtlich erstaunt: „Was redest du!? Die Polizei hat gerade meine ganze Familie festgenommen, wahrscheinlich auch einige getötet.“ „Warum rufst du mich an“, fragt Trevor daraufhin kalt. „Ich brauche deine Hilfe, was denn sonst“, sage ich verwundert. Trevors nächster Satz trifft Mike hart: „Jetzt hör mir mal zu! Meine Familie hat deine mit stichfesten Beweisen an die Polizei verpfiffen.“ „Ich verstehe nicht… Woher hattet ihr denn die Beweise?“ Trevor antwortet: „Das jetzt zu hören fällt dir wahrscheinlich schwer, aber sie hatten sie von mir. Ich war mit deiner Schwester zusammen, um Informationen zu bekommen. Zu meinem Glück war sie wie ein offenes Buch, wenn es um eure Geschäfte ging. Wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und der war nun mal heute. Als deine Schwester Wind von der Sache bekommen hat, habe ich die Bremsen von meinem Auto zerstört, da ich wusste, sie würde mit dem Wagen wegfahren. Wie gesagt, mein Beileid für die Sache mit deiner Schwester, aber ich bereue nichts und ich habe jetzt ein höheres Ansehen in der Familie. Viel Spaß dir in deinem weiteren Leben, Mike.“
Mike schreit: „Ich hätte dir und deiner Familie so etwas niemals angetan! Du warst mein bester Freund.“ Trevors letzte Worte sind: „Die Zeiten ändern sich. Auch für uns.“ Dann legt er auf. Die Welt schien sich von gleich auf jetzt um 180 Grad gedreht zu haben.
Mike gehen hunderte Dinge durch den Kopf. Er spürt Schmerz, Verrat und Trauer um seine Schwester. All diese Gedanken formen sich zu einem Gefühl. Tiefer Hass. Und dieser Hass bringt Mike dazu, dass er Trevor in der Zukunft dazu bringen wird, all seine Taten zutiefst zu bereuen und ihn anzuflehen, sein Leben nicht zu vernichten.
(Samuel Rivera)
Fünfte Geschichte
„Das hätte ich nun wirklich nicht erwartet!“, sagt eine Person, die gestern ziemlich sicher noch nicht da war. Sie möchte auch gleich die nächste Geschichte beisteuern und weil niemand Einwände hat, betitelt sie ihren Beitrag mit „Rasante Flucht“ undfängt an zu erzählen.
„Jetzt komm endlich!“, sagt meine Mutter und ich taumle mit meinen beiden überfüllten Plastiktüten und meinem alten Prinzessinnenrucksack die Treppe hinunter und schließlich aus unserem Haus. Unser schönes Haus… All die Erinnerungen… Das alles lassen wir zurück. Meine Mutter und mein Vater haben Schleppern all ihre Ersparnisse gegeben, damit sie uns „sicher“ über das Mittelmeer schaffen. Jetzt geht es los… Wir werden in einen engen, überfüllten Laster gescheucht und fahren los. Es ist eine schreckliche Fahrt. Alle paar Minuten hört man, wie irgendjemand auf den Boden pinkelt. Aber was sollen sie denn machen? Angehalten wird ja nicht. Mittlerweile ist der ganze Boden feucht, klebrig und es stinkt abscheulich. Als ich langsam Angst bekomme, was passiert, wenn jemand „groß“ muss, öffnet sich mit einem lauten Quietschen die Tür und uns wird befohlen auszusteigen.
Im Laster war es so dunkel, dass ich lange nichts sehe, ich rieche nur Meerwasser. Als ich endlich wieder sehen kann, sehe ich es. Wir sind am Meer, vermutlich am Mittelmeer. Irgendwo versteckt in einer Bucht. Aber wir sind nicht die Einzigen. Mindestens 300 andere Flüchtlinge stehen verteilt in der Bucht herum. Plötzlich höre ich Schreie. Ich drehe mich um und sehe ein junges Mädchen. Etwa in meinem Alter, um die zehn Jahre alt. Sie wird von zwei Männern mit Gewehren auf dem Rücken festgehalten. Ein dritter reißt ihr schmutziges Kleid auseinander und wälzt sich auf sie. Jetzt knallt es laut. Ein Mann ist aus der Menschenmenge hervorgesprungen und hat eine Pistole gezückt. Er schießt wie wild geworden auf die Männer. Mit Erfolg, sie fallen direkt zu Boden. Ein paar Momente später fällt er jedoch auch zu Boden. Ein anderer Schlepper hat seine Waffe gezückt und nicht gezögert. Um ihn bildet sich eine riesige Blutlache. Die Schlepper nehmen ihn an Armen und Beinen und schmeißen ihn ins Meer.
Als alle wieder einigermaßen beruhigt sind, werden wir auf alte, überfüllte, rostige Schiffe gelotst. Ein bis zwei Stunden später sind wir auf dem offenen Meer und kurz darauf fällt eine Frau über Bord. Alle schreien auf. Ein paar Leute probieren in der Not ihre Klamotten als Rettungsringersatz in das Wasser zu schmeißen. Doch anstatt anzuhalten und die arme Frau zu retten, fährt das Boot einfach weiter, als wäre nichts passiert.
Nach einer schrecklichen, schlaflosen Nacht spüre ich, wie es nass unter mir wird. Erst denke ich mir nichts dabei, doch als es anfängt, bis auf Kniehöhe zu steigen, fange ich an, Panik zu bekommen. Meine Mutter versucht mich zwar zu beruhigen, aber ich merke, dass sie auch Angst hat. Langsam fangen alle an, wild herumzukreischen und zu drängen. Mein Vater hat die Idee, extra früher rauszuspringen, um nicht im wilden Durcheinander unterzugehen. Und das tun wir auch. Wir ziehen unsere Hosen aus, blasen sie auf und binden sie zu, um sie als „Rettungsringe“ zu nutzen. Nun paddeln wir auf ihnen geradeaus. Nach ca. einer halben Stunde erreichen wir eine kleine Insel. Es fängt an zu regnen und wir fangen damit an, eine Art Zelt zu bauen. Wir sind völlig übermüdet und kaputt. Also legen wir uns endlich schlafen.
Am nächsten Morgen begeben wir uns auf Essenssuche. Wir finden ein paar Beeren und Früchte, viel mehr aber auch nicht. Gegen Mittag beginnen wir für unsere Flucht zu sorgen. Wir sammeln Baumstämme und Lianen und probieren ein Floß zu bauen. Plötzlich schreit mein Vater auf. In seiner Schulter steckt ein Pfeil! Wir rennen tiefer in den Wald. Hinter uns hören wir wilde Schreie und hastige Schritte. Es hagelt Pfeile und Speere. Erstaunlicher und glücklicherweise trifft uns aber kein weiterer. Fürs Erste. Mein verletzter Vater ist zu langsam und unsere Verfolger zu trainiert. Wir brauchen einen Plan! Schnell! Wir schlagen Haken. Ohne großen Erfolg. Plötzlich sehen wir eine riesige Steinplatte vor uns liegen, unter ihr ist ein kleiner Spalt. Hastig zwängen wir uns darunter. Wenige Sekunden später sehen wir sie. Mindestens 20 Paar Füße. Die eine Hälfte rennt weiter, der Rest zweifelt und scheint zu suchen. Plötzlich bückt sich einer von ihnen ruckartig und guckt mir genau in die Augen. Ich schreie. Er schreit. Alle kommen auf uns zugerannt. Jetzt sehe ich sie. Es müssen Ureinwohner sein. Sie haben Kriegsbemalung im Gesicht und tragen Federn auf dem Kopf. Sie haben keine Klamotten, wie wir sie kennen. Sie sind sich mit Leder, Federn und Blättern gekleidet. Mit spitzen Speeren ziehen sie uns hervor. Dann schmeißen sie uns wieder auf den Boden und fesseln uns.
Wir werden lange durch den Wald geführt, bis wir schließlich an einer kleinen Siedlung ankommen. Die Hütten und Zelte bestehen aus Baumstämmen, Ästen und Schilf. Wir werden in das größte Haus gebracht. Dort wartet ein alter, verzierter Mann auf uns und inspiziert uns ewig lange. Dann erzählt er irgendetwas für uns Unverständliches. Die Männer scheinen es zu verstehen. Sie nehmen uns und bringen uns in eine Art Gefängnis. Draußen entfachen sie ein riesiges Feuer. Langsam bekomme ich Angst, dass wir hier auf Kannibalen gestoßen sind! Wir müssen fliehen! Das Tor ist mit einem Seil zugebunden. In der Schulter meines Vaters steckt zu unserem Glück aber immer noch der Pfeil. Meine Mutter reißt ihn heraus und fängt an mit ihm die Seile zu zerschneiden. Nun warten wir bis zur Dunkelheit, um zu fliehen. Als es so weit ist, schleichen wir uns heraus und in den Wald. Die Ureinwohner sind währenddessen damit beschäftigt, singend um das Feuer zu tanzen.
Im Wald angekommen, rennen wir los. Immer geradeaus. Am Strand angekommen, sehen wir unser halbfertiges Floß. Wir schieben es ins Wasser und paddeln mit den Händen davon. Am nächsten Morgen wache ich mit einem riesigen Hunger und Durst auf. Wir schwimmen im Wasser, können aber nichts trinken. Geschwächt paddeln wir weiter. Auf einmal sehe ich ein Schiff in der Ferne. Es kommt auf uns zu! Es muss ein Rettungsschiff der Seenotrettung sein! Bei uns angekommen, nehmen sie uns auf und wir bekommen Essen und Trinken. Mein Vater wird sofort verarztet. Jetzt schlafen wir aber erstmal. Am nächsten Morgen wachen wir in einem Hafen auf. Es ist warm, die Sonne scheint und alles scheint gut zu sein. Zur Abwechslung ist das dieses Mal aber auch so. Wir werden vom Schiff begleitet und in einen Bus gebracht. Dieser fährt uns in ein Auffanglager, in dem wir fürs Erste leben sollen. Die Fahrt haben wir aber geschafft! Wir sind angekommen!
(Mobina Nazari)
Sechste Geschichte
„Ich finde es echt cool, dass ihr alle Geschichten zu erzählen habt, das ist wirklich interessant!“, sage ich. Mein Blick wandert durch den Raum und bleibt an einem eher unauffälligen Mädchen, so um die 13 Jahre hängen. „Magst du nicht auch mal was erzählen“, frage ich neugierig und sie nickt nur schüchtern und fängt an.
Ich möchte euch von einer Familie erzählen, die sich auf der Flucht vor einem grauenvollen Bürgerkrieg befand. Die Familie lebte schon eine Weile in jenem Land, als sich die politische Lage immer mehr zuspitzte. Die Regierung begann, diejenigen, die sich widersetzten, gefangenzunehmen, und keiner sah diese Menschen jemals wieder, die sich nichts anders als Meinungsäußerungen zu Schulden hatten kommen lassen. Sie fing auch an, die Mitglieder der gegnerischen Partei systematisch verschwinden zulassen, zu denen auch der Vater der Familie gehörte. Er hatte sich damals, als sie wegen einem Jobangebot für die Stelle als Chefarzt an einem der besten Krankenhäuser des Kontinents, hergezogen waren, nicht wirklich viel dabei gedacht, als er der Partei beitrat. Allerdings hatte er sich mit der Zeit zu einem wichtigen Mitglied entwickelt, auf dessen Spenden die Partei ein Stück weit angewiesen war. Da er viel Einfluss besaß, ließ man ihn vorerst in Ruhe.
Aber dabei würde es nicht bleiben und das wusste er. So begann er damit, ihre Flucht ins Heimatland vorzubereiten. Dort würden sie sicher sein. Bei einzelnen Festnahmen blieb es allerdings nicht. Allein schon wegen bloßem Verdacht wurden ganze Gruppen verhaftet. Ohne ausreichende Beweise wurden zahllose Menschen hinter Gittern gebracht und diese hatten noch Glück. Viele wurden nämlich gar nicht mehr gesehen. Niemand bekam mehr eine faire Gerichtsverhandlung, wenn man überhaupt eine bekam. Aber bald ließen sich dies die Bürger nicht mehr gefallen. Es kam zu Überfällen auf das Parlament, unzählige Attentate wurden auf Politiker verübt und man fing an, sich gegenseitig auf offener Straße zu beschießen und zu belagern. Ein totales Chaos brach aus, das seinen Ursprung in den paranoiden Wahnvorstellungen des derzeitigen Staatschefs genommen hatte, der sich durch alles und jeden bedroht fühlte und seine Macht um keinen Preis wieder abgeben wollte. Wer nicht für ihn war, war gegen ihn und verdiente den Tod. Er hatte leider viele Anhänger, die seine Ansichten teilten, was das Land anging. So stand die gesamte Landesbevölkerung in einem Zwiespalt. Er und seine Leute gegen den Rest. Und die restliche Welt hielt sich aus allem raus, außer mit Waffenlieferungen an beide Seiten. Es sah also nicht danach aus, als würde sich die Lage beruhigen. Es wurde nur immer schlimmer.
Eines Tages befand sich eine Mail auf dem Computer des Vaters. Sie war von einem seiner Freunde im Parlament. Dieser schrieb, dass sie angefangen hätten, darüber zu beraten, wie sie ihn verschwinden lassen könnten, und dass er auf sich aufpassen solle, da jederzeit die Polizei vor seiner Tür stehen könnte. Nun wusste auch der Vater, dass ihnen die Zeit davonlief und sie so schnell wie möglich aus dem Land verschwinden mussten. Er zerbrach sich stundenlang den Kopf, wie er seine Familie in Sicherheit bringen konnte. Allerdings wusste er nur, dass er alles dafür tun musste, koste es, was es wolle. Er hatte zwei Töchter: Lilliana, sie war 17, sehr gutmütig, lustig, vernünftig und sehr, sehr schlau und Annalisa, sie war 14, ein Sturkopf, wild, unabhängig, und sah immer etwas Positives in Allem. Und dann war da noch seine wunderschöne Frau, Marisa, die liebevollste Person, der er jemals begegnet war. Niemals würde er es zulassen, dass einer von ihnen etwas passierte.
Als die Mail kam, war er allein Zuhause, seine Töchter waren in der Schule und seine Frau in der Kita, sie arbeitete als Erzieherin. Heute hatte sie eine Krisenberatung mit dem gesamten Erzieherteam. Als sie alle nacheinander Zuhause ankamen, erzählte er ihnen von der Mail und was das jetzt für sie bedeutete. Annalisa fing an zu weinen und Lilliana nahm sie in den Arm, aber auch in ihren Augen glitzerten Tränen. Marisa ging auf ihn zu und umarmte ihn. Sie hatten alle mitbekommen, was im Land vor sich ging, sie hatten auch gewusst, dass sie irgendwann von hier fortmussten, aber dass alles so schnell gehen würde, damit hatte keiner gerechnet. Nachdem sie alles ein wenig verdaut hatten, wies er sie an, alles Nötige einzupacken und ins Wohnzimmer zu stellen. Sie brauchten etwa zwei Stunden, um die wichtigsten Sachen einzupacken, die Hälfte ihrer Sachen mussten sie zurücklassen, was vor allem die beiden Mädchen schmerzte. Während Marisa gerade in der Küche noch etwas Proviant zusammenstellte, klingelte es an der vorderen Haustür, und als Lilliana gerade die Tür öffnen wollte, hielt ihr Vater sie zurück und sagte flüsternd, dass sie keinen mehr hereinlassen durften, weil es jeder sein konnte. Und er gab ihnen allen zu verstehen, leise zu sein. Dann hörte man von draußen eine laute Männerstimme. Sie sagte, dass sie von der Polizei waren, ihnen bloß ein paar Fragen stellen wollten und dass sie bitte die Tür öffnen sollten, da sie sowieso wussten, dass sie Zuhause waren. Vater und Mutter tauschten einen Blick aus; nun war es so weit. Marisa deutete auf die Taschen und dann auf die Hintertür. Dann packte sie hastig den letzten Proviant zusammen und alle schlichen sie zur Tür.
Das Auto stand schon bereit. Da kamen auf einmal drei große, muskulöse Männer um die Hausecke und riefen ihnen zu stehenzubleiben. In Panik sprang die Familie ins Auto hinein und riss die Türen zu. Nun zogen die Männer Pistolen und zielten auf den Wagen. Voller Angst drückte der Vater auf das Gaspedal und riss das Lenkrad herum. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren sie direkt auf die Männer zu. Diese schafften es gerade so auszuweichen. Dann ertönte ein Schuss und als Annalisa sich umdrehte, sah sie, wie die drei in einen schwarz glänzenden Wagen stiegen und ihnen nachfuhren. Sie sagte es den Anderen. Der Vater gab sich alle Mühe, Ruhe zu bewahren und darüber nachzudenken, was nun zu tun war. Irgendwie mussten sie es schaffen, diese Kerle loszuwerden und über die Grenze zu kommen.
Das Gute war, dass sie nicht allzu weit von der Grenze entfernt wohnten. Nur etwa 21 Stunden, aber trotzdem konnten sie diese auf gar keinen Fall durchfahren. Vielleicht würden sie, wenn sie sich abwechselten, es in 14 Stunden schaffen. Und schon jetzt wurde es dunkel, sie würden also die Nacht durchfahren müssen. Durch die Nacht zu fahren war zwar sehr anstrengend, aber es war dunkel und das hieß, es war einfacher für sie, ihre Verfolger abzuschütteln. Und er hatte auch schon für ihre Flucht ein paar Vorkehrungen getroffen. In 50 Kilometern stand auf einer abgelegenen Raststätte ein anderer Wagen mit neuem Nummernschild ihres Heimatlandes bereit und er hatte Pässe mit neuen Namen für sie machen lassen, damit es bei der Grenzkontrolle weniger Probleme gab. Außerdem lag eine Pistole mitsamt Munition im Handschuhfach, nur für den Fall. Also mussten sie es als Erstes zur Raststätte schaffen. Er bat die Mädchen, die Autos hinter ihnen im Blick zu behalten und Bescheid zu geben, wenn hinter ihnen der Wagen der drei Männer oder sonst ein auffälliges Auto auftauchte. Sie fuhren nun auf die Autobahn und er drückte nochmals volle Pulle auf das Gaspedal. Sie rasten weg von ihrem normalen Leben und weg von den schrecklichen Ereignissen, die sich momentan im ganzen Land abspielten.
Nachdem sie einige Zeit gefahren waren, bogen sie von der Autobahn ab und hielten auf einer kleinen abgelegenen Raststätte. Er drehte sich um und erklärt seiner Familie, dass sie nun umladen müssten, da sie von nun an in einem unauffälligeren Auto weiterfahren würden. Auch gab er ihnen ihre neuen Pässe und schärfte ihnen ein, sich nur noch mit den Namen, die in den Pässen gedruckt waren, vorzustellen. Dann stiegen sie aus und luden ihre Taschen in ein gebrauchtes und etwas zerkratztes Auto. Die Pistole verstaute der Vater wieder im Handschuhfach. Als Annalisa und Lilliana diese sahen, warfen sie sich einen erschreckten Blick zu, den er bemerkte und weshalb er beiden sagte, dass sie sie bestimmt nicht benötigen würden. Aber tief in seinem Inneren ahnte er, dass das vermutlich nicht stimmte, jedoch sollten die beiden keine Angst haben.
Als sie alles umgepackt hatten, stiegen sie in das Auto und der Vater startete den Motor. Er hoffte so sehr, dass sie es schaffen würden und dass alles klappen würde. Sie fuhren nicht auf der Autobahn weiter, sondern auf Landstraßen durch kleine Dörfer und Wälder. Dies würde zwar länger dauern, aber hier war es unwahrscheinlicher auf Verfolger zu treffen. Nach sechs Stunden Fahrt waren die beiden Töchter eingeschlafen. Marisa schlug vor, in einer einsamen Nebenstraße zu parken, etwas zu schlafen und dann im Morgengrauen weiterzufahren. Er willigte ein, was wohl das Klügste war, denn schließlich brauchten sie beide auch ein wenig Schlaf. Er stoppte also auf einem verlassenen Waldweg, machte die Scheinwerfer aus, verriegelte die Türen, lehnte den Sitz etwas nach hinten und schloss die Augen. Schnell verfiel er dem Schlaf, denn er hatte die letzten Nächte kaum geschlafen.
Geweckt wurde er von Schreien. Annalisa und Lilliana saßen stocksteif und mit fürchterlicher Angst in den Augen auf der Rückbank und starrten aus dem Fenster. Mutter und Vater taten es ihnen gleich. Es fing schon an zu dämmern, draußen konnte man eine schwarze Gestalt erkennen, die um das Auto herumschlich. Die Hand des Vaters wanderte zum Handschuhfach und er holte die Pistole heraus. Da ertönte ein Schuss und eine Kugel sauste durch die Vorderscheibe. Annalisa heulte auf alle drehen sich erschrocken zu ihr um, aber ihr war nichts passiert. Allen ging es gut, dann ertönte der nächste Schuss und streifte Lillianas Arm. Sie schrie, Panik machte sich auf ihrem Gesicht breit. Der Vater wies alle an, sich zu ducken. Und er meinte, dass er nun nach draußen gehen würde und sie losfahren sollten, sie hatten keine andere Wahl. Marisa und die Mädchen protestierten und hielten ihn fest. Dann ertönten noch mehr Schüsse und er warf Marisa einen traurigen Blick zu, die ihm daraufhin einen heißen Kuss gab und ihm zuflüsterte, wie sehr sie ihn liebte. Er drehte den Kopf nach hinten und betrachtete seine beiden Töchter, denen Tränen über die Wangen liefen. Sie wussten, dass es die einzige Möglichkeit war. Sie sagten ihm, dass sie ihn liebten, und er drückte ihnen einen Kuss auf die Stirn und sagte, dass sie sich gar nicht vorstellen konnten, wie sehr auch er sie beide liebte.
Dann öffnete er die Tür, lehnte sich heraus, feuerte einen Schuss in die Dämmerung ab und schmiss sich aus dem Wagen. Marisa stiegt über die Mittelkonsole auf den Fahrersitz, wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und startete den Motor. Sie fuhren auf eine Landstraße. Sie alle zuckten zusammen, als sie noch mehr Schüsse hörten und dann wurde es still. Nichts war mehr zu vernehmen. Dann gab Marisa Gas, den Blick stur geradeaus gerichtet. Immer wieder kamen Tränen hoch, doch die blinzelte sie weg. Sie musste es schaffen, ihre Kinder hier herauszuschaffen. Von hinten hörte man leises Schluchzen, doch irgendwann wurde es leise, keiner redete mehr, die beiden Mädchen schauten voller Traurigkeit aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft. Keiner von ihnen konnte so richtig begreifen, was gerade geschehen war.
Nach einigen anstrengenden Stunden erreichten sie die Grenze und es gab keine großen Probleme bei der Grenzüberquerung. Auch über die zerschossene Frontscheibe wunderte sich keiner, da so etwas bei der momentanen Lage des Landes kein Wunder war. Aber ganz hatten sie es doch noch nicht geschafft, denn sie mussten es noch zur Grenze ihres Heimatlandes schaffen. Mittlerweile fiel es der Mutter immer schwerer, sich auf die Straße zu konzentrieren, aber sie biss die Zähne zusammen, so weit war es schließlich nicht mehr. Und da endlich erblickten sie das Schild, das sie darauf hinwies, dass sie die Grenze zu ihrem Heimatland überquert hatten.
(Lotta Priewe)
Siebte Geschichte
„War das deine eigene Geschichte“, fragt ein älterer Mann, den ich davor noch nie gesehen habe. Das kleine Mädchen meint: „Nein, aber das ist leider die Geschichte von einer guten Freundin von mir…“ Danach wird es kurz still und das Mädchen lehnt sich auf den Arm von ihrer Mutter. Um die Stille zu unterbrechen, möchte jetzt ein junger Mann eine Geschichte erzählen.
Es war einmal eine Familie mit drei Kindern. Sie lebten in einem kleinen Dorf und betrieben einen kleinen Bauernhof. Da die Familie nicht besonders viel Geld hatte, mussten die Kinder schon in jungen Jahren arbeiten und halfen somit auf dem Bauernhof mit. Wegen dem mangelnden Geld genossen die Kinder auch keine besonders gute schulische Bildung, wodurch ihre Aufstiegschancen im späteren Leben deutlich eingeschränkt wurden. In ihrer Freizeit spielten die Kinder gerne mit ihren Freunden aus dem Dorf. Eines Tages, als sie gerade auf dem Bauernhof waren und ihren Eltern halfen, hörten sie einen lauten Knall und rannten schnell los, um zu sehen, woher dieser kam. Als sie herausfanden, weshalb er zu diesem Knall gekommen war, rannten sie erschrocken zu ihren Eltern zurück, da auch sie sehen mussten, wie ein Haus aus dem Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Als sie ihren Eltern davon erzählten, wollten diese so schnell wie möglich das Dorf verlassen, da sie dort nicht mehr sicher waren. Also packten sie die wichtigsten Sachen zusammen und gingen schlafen um Kraft für die lange Reise zu sammeln. Doch mitten in der Nacht hörten sie erneut einen lauten Knall und erschrocken guckten sie aus dem Fenster, um zu sehen, was passiert war. Als sie es sahen, brachen sie sofort auf und rannten so schnell sie konnten. Das Haus ihrer Nachbarn war verschwunden.
Sie mussten über kleine Wege auf Bergkanten laufen, um am nächsten Morgen müde und erschöpft in einem benachbarten Dorf anzukommen. Als sie das verlassene Dorf mit nur noch wenigen Häusern sahen, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Sie sahen viele verbrannte und zerfetzte Körper herumliegen und sie fragten sich, wer so etwas tun würde. Sie suchten sich einen Unterschlupf, um sich etwas ausruhen zu können. Als sie mittags aufbrachen, um aus dem Land zu fliehen, wurden sie von zahllosen leeren Dörfern und leblosen Körpern immer wieder in Trauer versetzt. Nachdem sie nach mehreren Tagen mit wenig Essen und Trinken endlich die nächste Stadt erreichten, konnten sie sich zum ersten Mal etwas ausruhen. Da die Kinder wegen dem Schock nicht richtig schlafen konnten, brachen sie schon sehr früh am Morgen auf, um endlich die Grenze zu erreichen.
Als sie nun nach vielen Tagen die Grenze erreichten, standen sie vor der nächsten großen Herausforderung, da sie nicht über die Grenze gelassen wurden. Erst nach vielen Überzeugungsversuchen konnten sie endlich das Land verlassen und denken, dass sie gerettet waren. Doch als sie versuchten nach Europa zu fliehen, wurde ihnen von Schmugglern versprochen, dass sie sicher mit einem Boot nach Griechenland gebracht würden, also bezahlten sie den Fahrer mit all ihrem Geld. Als sie am vereinbarten Treffpunkt ankamen, war niemand da, um sie abzuholen. Also hatten sie kein Geld mehr, um auf anderem Wege zu fliehen. Als sie darüber nachdachten, wie ihnen die Flucht gelingen könnte, sahen sie keinen anderen Weg, als mit einem kaum seetauglichen Boot mit über 300 Menschen über das Mittelmeer nach Griechenland zu gelangen. Auf diesem Boot sahen sie die ganze Zeit aufs Meer und sahen darin immer nur den Tod. Sie hatten noch nie im Leben mehr Angst verspürt.
Nach drei Tagen auf See glaubte die Mutter nicht mehr an eine sichere Ankunft und sagte: „Wir werden alle ertrinken.“ Am vierten Tag kam ein anderes Boot auf sie zu. Die Passagiere weigerten sich, in dieses Boot zu wechseln, woraufhin die wütenden Schmuggler sie rammten und lachten. Innerhalb von Minuten kenterte und sank das Boot. Die Menschen, die unter Deck gefangen waren, hatten keine Chance zu überleben.
„Ich hörte, wie Menschen schrien, und sah, wie ein Kind von der Bootsschraube in Stücke gerissen wurde“, erinnerte sich die Tochter. Um sie herum schwammen unzählige Leichen. Die Überlebenden kamen in Gruppen zusammen und beteten. Die Mutter fand Rettungsringe für ihre Kinder. In der folgenden Nacht verloren viele Überlebenden die Kräfte und den Mut. Die Mutter musste zugucken, wie Männer ihre Rettungswesten abnahmen und ertranken. Auch ihren Sohn verließen kurz darauf die Kräfte und die Mutter musste mit ansehen, wie er starb. Die Mutter war nun allein für ihr letztes völlig erschöpftes Kind verantwortlich, sie weinte, hatte Hunger und Durst. Sie sang für das Mädchen und erzählte ihr Geschichten. Ein langer Tag verging, dann ein weiterer. Am vierten Tag im Meer sah die Mutter ein Handelsschiff. Zwei Stunden schrie sie um Hilfe, bis die Suchscheinwerfer des Schiffes sie fanden. Sie starb noch an Bord des Schiffes. Doch die kleine Tochter hatte überlebt. Als sie endlich in Griechenland ankam, wurde sie in ein Flüchtlingslager gesteckt. Eine nette Familie kümmerte sich um sie und nahm sie auf. Doch das Mädchen wollte mehr, sie wollte nach Deutschland und dort zur Schule gehen, um später einen richtigen Job zu finden. Als sich ihr eine Möglichkeit bot, nach Deutschland zu gehen, ergriff sie diese sofort. Eine deutsche Familie adoptierte sie und sie lernte alles über die deutsche Kultur und Sprache.
Sie hatte trotz der schweren Umstände eine schöne Kindheit, berichtete sie, außerdem lernte sie neue Freunde kennen und lebte sich schon nach nur einigen Wochen in der neuen Familie ein. Natürlich vergaß sie nie, wer ihre richtige Familie war, und musste häufig weinen, wenn sie an ihre Geschwister, ihre Eltern und an ihre Heimat dachte.
Jetzt geht sie in die 7. Klasse und in ihrer Freizeit spielt sie gerne Fußball, hilft in Flüchtlingslagern und bringt ihre Adoptiveltern immer wieder dazu, Geld an Organisationen, die armen und hilfsbedürftigen Kindern helfen, zu spenden.
(Karim Ashoor)
Achte Geschichte
Wir alle sind ziemlich geschockt von dieser Geschichte. Doch die Unterbrechung ist nicht lang. Diesmal macht eine Frau Mitte 40 den Anfang. „Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, auch wenn sie ausgedacht ist.“ Wir sind einverstanden und sie legt los. Sie nennt sie „Der seltsame Krieg“.
Auf einem fremden Planeten oder in einer anderen Zeit gab es einmal zwei Länder, die hießen Hüben und Drüben. Es gab noch andere Länder, wie Nebenan und Weitfort, aber diese Geschichte handelt von Hüben und Drüben. Eines Tages hielt der Oberstgewaltige von Hüben eine Ansprache an seine Bürger. Er sagte, dass das Land Hüben von dem Land Drüben bedrängt würde und dass die Hübener nicht mehr länger zusehen können, wie das Land Drüben mit seiner Grenze das Land Hüben drücke und einenge. „Sie liegen so dicht an uns, dass uns nicht einmal mehr Platz zum Schnaufen bleibt!“, schrie er. „Nicht das kleinste Bisschen können wir uns rühren. Sie sind nicht bereit, ein bisschen zu rücken, ein bisschen Platz zu machen, uns ein wenig Bewegungsfreiheit zu gönnen. Aber wenn sie dazu nicht bereit sind, dann werden wir sie eben zwingen müssen.
Wir wollen keinen Krieg. Wenn es nach uns geht, gibt es den ewigen Frieden. Aber es geht leider nicht nach uns. Wenn sie nicht bereit sind, mit ihrem Land ein wenig von uns wegzurücken, dann zwingen sie uns zum Krieg. Aber wir lassen uns den Krieg nicht aufzwingen. Wir nicht! Wir werden nicht zulassen, dass sie uns zwingen, unsere besten Söhne sinnlos zu opfern, damit unsere Frauen zu Witwen und unsere Kinder zu Waisen werden! Darum müssen wir die Macht von Drüben brechen, bevor sie uns zwingen, einen Krieg anzufangen. Und darum, Mitbürger, um uns unserer Haut zu wehren, um den Frieden zu schützen, um unsere Kinder zu retten, erkläre ich hiermit, in aller Form, dem Staat Drüben den Krieg!“
Die verwirrten Hübener sahen erst einander an. Dann sahen sie ihren Oberstgewaltigen an. Und dann sahen sie die Sonderpolizeitruppen mit den Panzerhelmen und Vernichtungsstrahlern an, die den Platz umstanden, klatschten und begeistert Beifall schrien: „Hoch der Oberstgewaltige! Nieder mit denen von Drüben!“
Und der Krieg begann.
Noch am selben Tag überschritt die Armee von Hüben die Grenze. Es war ein gewaltiger Anblick. Die Panzerfahrzeuge sahen aus wie riesige eiserne Drachenfische. Sie wälzten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Aus ihren Kanonenrohren konnten sie Granaten schießen, die alles zerfetzten, und giftige Gase blasen, die alles umbrachten. Jedes ließ hinter sich einen hundert Meter breiten Streifen der Verwüstung. Vor ihnen lag ein blühender Wald und hinter ihnen lag nichts mehr. Wo die Flugzeuge flogen, wurde der Himmel dunkel, und wer darunter stand, fiel angstgeschüttelt auf sein Gesicht. Und wo ihr Schatten hinfiel, da fielen auch ihre Bomben. Zwischen den Riesenflugzeugen am Himmel und den Panzerfahrzeugen am Boden surrten Schwärme von Hubschraubern wie kleine, bösartige Mücken. Die Soldaten aber sahen aus wie stählerne Kampfroboter, in ihren Schutzanzügen, die sie unempfindlich gegen Kugeln, Gas, Gift und Bazillen machten. In ihren Händen trugen sie schwere Kampfapparate, die tödliche Geschosse versprühten, oder Laserstrahlen, die alles zerschmelzen konnten.
So marschierte die unaufhaltsame Armee von Hüben nach Drüben, um jeden Feind erbarmungslos zu töten. Doch seltsam, sie fanden keinen Feind. Am ersten Tag drang die Armee zehn Kilometer ins feindliche Gebiet ein, am zweiten Tag zwanzig. Am dritten Tag überquerte sie den großen Fluss. Überall fanden sie nur verlassene Dörfer, abgeerntete Felder, ausgeräumte Fabriken, leere Lagerhäuser. „Sie verstecken sich, und wenn wir an ihnen vorbei sind, überfallen sie uns von hinten!“, brüllte der Oberstgewaltige. „Durchsucht alle Heuschober und alle Misthaufen!“ Die Soldaten durchstöberten die Misthaufen, aber alles, was sie dabei fanden, waren haufenweise Ausweispapiere: Personalausweise, Geburtsurkunden, Heimatscheine, Reisepässe, Impfzeugnisse, Immatrikulationsbescheinigungen, Rundfunkgebühren-Ermäßigungs-Berechtigungsscheine, Hunde-steuerentrichtungsnachweise und hunderte andere Dokumente. Und aus allen Lichtbildausweisen waren die Fotos herausgerissen. Was das bedeuten sollte, konnte sich niemand erklären. Ein großes Problem waren die Wegweiser. Sie waren abmontiert oder verdreht oder übermalt, aber manche stimmten auch, so dass man sich nicht einmal darauf verlassen konnte, dass sie falsch waren. Immer wieder gingen Soldaten verloren, ganze Kompanien verliefen sich, Divisionen fuhren in die Irre und so mancher verlassene General schickte fluchend Motorradfahrer in alle Richtungen, um seine Soldaten zu suchen. Der Oberstgewaltige musste sofort alle Vermessungsbeamten und Geographielehrer von Hüben zum Militär einberufen, damit das eroberte Land ordentlich beschildert werden konnte.
Am vierten Tag des Feldzuges machte die Armee von Hüben ihren ersten Gefangenen. Es war aber kein Soldat, sondern ein Zivilist, den sie im Wald gefunden hatten, mit einem Pilzkorb über dem Arm. Der Oberstgewaltige ließ ihn zu sich persönlich zum Verhör kommen. Der Gefangene sagte, als er vor ihm stand, dass er Hans Müller heiße und von Beruf Pilzesammler sei. Seinen Ausweis, sagte er, hätte er verloren, und wo die Armee von Drüben sei, das wisse er nicht. In den nächsten Tagen nahm die Armee von Hüben einige Tausend Zivilisten gefangen. Alle hießen Hans oder Lieschen Müller und alle hatten keine Ausweise. Der Oberstgewaltige tobte.
Schließlich besetzte die Armee von Drüben die erste größere Stadt. Überall sah man Soldaten, die Straßennamen an die Wände pinselten. Die Stadtpläne hatte man vom Geheimdienst kommen lassen. Durch die Eile gab es natürlich viele Irrtümer, und manche Straßen hießen auf der linken Seite anders als auf der rechten und am oberen Ende anders als am unteren. Ständig irrten suchende Kompanien durch die Stadt, voraus ein fluchender Feldwebel mit dem Stadtplan in der Hand. Überhaupt funktionierte in der Stadt gar nichts. Das Elektrizitätswerk arbeitete nicht, das Gaswerk, das Telefon, nichts funktionierte.
Der Oberstgewaltige ließ sofort bekanntmachen, dass es verboten wäre zu streiken und dass alle sofort an die Arbeit zu gehen hätten. Die Leute gingen auch in die Fabriken und Büros, aber es funktionierte trotzdem nichts. Wenn die Soldaten hinkamen und fragten: „Warum wird hier nicht gearbeitet“, dann sagten die Leute: „Der Herr Ingenieur ist nicht da.“ oder „Der Meister ist nicht da.“ oder „Die Frau Direktor ist nicht da.“ Aber wie sollte man die Frau Direktor finden, wenn alle Lieschen Müller hießen? Der Oberstgewaltige ließ verkünden, dass jeder erschossen würde, der nicht seinen richtigen Namen und Titel sagte. Da nannten sich die Drübener nicht mehr Müller, sondern irgendwie, aber was half das schon?
Je weiter die Armee in das Land vordrang, desto schwieriger wurde alles. Es war schon bald kein frisches Essen mehr für die Soldaten aufzutreiben, alles musste von Hüben gebracht werden. Die Eisenbahn funktionierte nicht, die Eisenbahner standen herum, fuhren sinnlos mit den Loks hin und her. Die Zugführer stritten sich um die Waggons, und natürlich waren alle Chefs, die sich auskannten, verschwunden. Niemand konnte sie finden. Den Soldaten tat niemand was. Daher wurden sie bald unvorsichtig, liefen mit offenen Panzerhelmen herum und plauderten mit den Leuten. Und die Leute von Drüben, die alles Essbare vor der Beschlagnahmung durch die Armee versteckten, teilten ihr bisschen Essen mit einzelnen Soldaten oder tauschten mit ihnen frischen Salat oder selbstgebackenen Kuchen gegen Konserven; denn davon hatten die Soldaten genug, und sie hingen ihnen zum Hals heraus.
Als der Oberstgewaltige das erfuhr, bekam er einen Tobsuchtsanfall und verbot allen Soldaten, ihre Unterkünfte zu verlassen, außer, wenn sie im Trupp auf Patrouille gingen. Das gefiel den Soldaten nicht.
Schließlich besetzte die Armee die Hauptstadt von Drüben. Aber auch hier war alles wie überall in diesem Land. Es gab keine Straßenschilder, keine Hausnummern, keine Namensschilder an den Türen, keine Direktoren, Ingenieure, Meister, keine Polizisten und keine Beamten. Die Ministerien waren leer und alle Akten verschwunden. Wo die Regierung war, wusste niemand. Da beschloss der Oberstgewaltige endlich hart durchzugreifen. Er ließ verlautbaren, dass alle Erwachsenen in ihre Betriebe und Büros gehen sollten. Wer zu Hause bliebe, wurde erschossen. Dann ging er selbst ins Elektrizitätswerk und ließ alle Soldaten und Offiziere dorthin kommen, die zu Hause mit Elektrizitätswerken zu tun hatten. Er hielt eine Rede und sagte dann, dass in zwei Stunden der Strom wieder da sein müsse. Die Offiziere kommandierten, die Soldaten kontrollierten, und die E-Werksarbeiter rannten hin und her und taten genau das, was ihnen die Offiziere sagten. Das gab natürlich ein fürchterliches Chaos und keinen Strom. Da rief der Oberstgewaltige die Offiziere wieder zurück und sagte zu den E-Werksarbeitern: „Wenn nicht in einer halben Stunde Strom ist, werdet ihr alle erschossen!“ Und siehe da, nach einer halben Stunde gab es Licht. Da sagte der Oberstgewaltige: „Seht ihr, ihr Sauhunde, man muss euch nur richtig Beine machen!“, und zog mit seinen Soldaten zum Gaswerk, um es dort genauso zu machen.
Aber am nächsten Tag gab es wieder keinen Strom, und als der Oberstgewaltige wütend mit einer Kompanie seiner speziell ausgebildeten Mördersoldaten anrückte, um alle E-Werksarbeiter auszurotten, war das E-Werk leer, und die E-Werksarbeiter und E-Werksangestellten hatten sich in den Fabriken und Büros unter die Leute gemischt. Da gab der Oberstgewaltige seinen Soldaten den Befehl, einfach tausend Leute von der Straße zusammenzusammeln und zu erschießen. Aber durch die heimtückische List der Leute von Drüben, immer freundlich zu den Soldaten zu sein, war die Moral der Truppe schon so aufgeweicht, dass niemand bereit war, einfach irgendwelche tausend Leute zu erschießen, die gar nichts getan hatten. Da gab der Oberstgewaltige seinen Mördersoldaten erneut den Befehl. Aber seine Offiziere ließen ihn wissen, dass die gewöhnlichen Soldaten schon sehr unzufrieden wären und es vielleicht sogar eine Meuterei geben könnte, wenn die tausend Leute erschossen würden. Und der Oberstgewaltige bekam Briefe von den Mächtigen, die ihm schrieben: „Oberster der Gewaltigen! Sie haben Ihre Feldherrengabe und Ihr militärisches Genie bewiesen und wir beglückwünschen Sie zu Ihren zahllosen, glänzenden Siegen. Doch bitten wir Sie nun, wieder zurückzukommen und diese Verrückten von Drüben, sich selbst zu überlassen. Sie kosten uns zu viel. Wenn wir hinter jedem Arbeiter einen Soldaten mit einer Maschinenpistole stellen müssen, der ihm mit Erschießen droht, und einen Ingenieur, der ihm sagt, was er zu tun hat, dann lohnt sich das ganze Erobern nicht mehr. Bitte, kommen Sie nach Hause, denn zu lange hat unser geliebtes Land schon Ihre glänzende Gegenwart entbehrt.“ Da packte der Oberstgewaltige seine Armee zusammen, ließ alle wertvollen Maschinen und anderen Kostbarkeiten mitgehen, die seine Truppen transportieren konnten, und fuhr fluchend wieder nach Hause.
„Aber gezeigt haben wir’s ihnen“, knurrte er. „Diese Feiglinge. Was werden sie jetzt tun, die Narren! Wie werden sie jetzt feststellen, wer ein Ingenieur ist, wer ein Arzt, wer ein Tischler? Ohne Zeugnisse und Diplome! Wie werden sie regeln, wer in der Villa wohnen soll und wer in der Mietwohnung, wenn keiner beweisen kann, was ihm gehört? Wie werden sie sich zurechtfinden, ohne Besitzurkunden, ohne Strafregister und Führerscheine, ohne Titel und Uniformen? Was für ein Durcheinander werden sie haben! Und das alles nur, damit sie nicht mit uns Krieg führen müssen, diese Feiglinge.“
(Lena Werner)
Neunte Geschichte
„Wer hätte denn gedacht, dass die Geschichte so ausgeht“, wirft einer in den Raum und spricht meine Gedanken aus. Ein ca. 20-jähriger Mann möchte gerne auch seine Geschichte über seine Flucht nach Deutschland erzählen.
Nun sind wir endlich hier in Deutschland angekommen. Heute erzähle ich euch meine Geschichte darüber, wie wir durch den Krieg aus unserer alten Heimat vertrieben wurden und hierher nach Deutschland flüchten mussten.
Es war ein schöner Sonntag, als das erste Mal Bomben fielen und die ersten Menschen verletzt wurden. Wir waren zu diesem Zeitpunkt zum Glück auf einem Ausflug ans Mittelmeer. Als wir dann zurück in unsere Heimatstadt fuhren (eine Kleinstadt im Westen Syriens), war unsere Wohnung zerstört und auch meine Schule stand in Flammen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Da uns und den Menschen aus unserer Stadt zwei Wochen zuvor der Strom abgestellt worden war, bekamen wir keine Informationen über die Lage und waren kein bisschen vorbereitet. Die erste Nacht schliefen wir dann letztendlich in unserem Auto. Wir wachten von den lauten Fahrzeugen der syrischen Armee auf. Sie befahlen uns die Stadt zu verlassen, da Terroristen diese Stadt weiter angreifen würden. Für uns war das nicht so schlimm, da wir erstens noch unser Auto hatten und zweitens unsere Wohnung schon zerstört war; außerdem hatte mein Vater schon einen Plan. Er wollte, dass wir vorübergehend zu seinem Bruder nach Damaskus ziehen, die Hauptstadt Syriens. Als wir dann aber schon fast da waren, sahen wir schon mehrere riesige Rauchwolken über der Stadt. Mein Vater beschloss jedoch weiterzufahren, um nach seinem Bruder zu sehen. Ungefähr einen Kilometer weiter versperrte uns ein Panzer den Weg. Die Soldaten sagten uns, wir sollen umkehren und probieren, das Land zu verlassen. Meine Eltern berieten sich kurz und sagten uns dann, dass wir zu unseren Großeltern nach Deutschland ziehen würden.
Wir drehten um und fuhren Richtung Norden zur syrisch-türkischen Grenze, von Damaskus aus sind das ca. 400 Kilometer. Unterwegs erklärten uns unsere Eltern, dass unsere Großeltern in Berlin einen Laden besitzen, wo sie arbeiten könnten. Als wir dann am späten Abend an der Grenze ankamen, gab es ein Riesenproblem, die Grenzwärter ließen uns nicht durch, sie sagten, wir müssen umkehren.
Das war für uns keine Möglichkeit, da wir keinen Ort in Syrien hatten, wo wir hätten hingehen können. Also fuhren wir an die Küste, um dort ein Boot zu suchen, das uns nach Europa bringen würde. Es fuhren zwei Boote nach Europa, ein Kreuzfahrtschiff, das wir uns bei Weitem nicht leisten konnten und ein großes Schlauchboot, womit aber auch viele andere Flüchtlinge die nach Europa wollten, fahren würden. Wir gingen zu den Besitzern des Bootes und erkundigten uns nach dem Preis. Sie verlangten von uns all unserer Geld und unser Auto, dazu kam, dass wir nichts mit auf das Boot nehmen durften. Somit hatten wir nur noch die Sachen, die wir bei uns trugen, und noch ein bisschen Geld, dass mein Bruder unter seiner Schuhsole versteckt hatte.
Am nächsten Morgen brachen wir sehr früh auf. In dem Schlauchboot hatten wir nur sehr wenig Platz, da es sehr voll war, wie ich bereits erwartet hatte.
Mein Vater organisierte uns drei Schwimmwesten, für mich und meine beiden Brüder. Mein ältester Bruder musste seine dann aber wieder abgeben, da es nicht genug Schwimmwesten für alle gab. Nach ungefähr zwei Stunden wurde es sehr ungemütlich, da hohe Wellen aufkamen. Eine Frau fiel ins Wasser, konnte zum Glück aber wieder ins Boot geholt werden. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, der extrem heißen Sonne ausgesetzt und hatten kaum noch Wasser. Kurz bevor die Sonne unterging, fiel auch noch der Motor aus. Die Ersten bekamen Panik, sie könnten verdursten, ertrinken oder einen Sonnenstich bekommen. Zum Glück gab es Ruder und zwei Scheinwerfer vorne am Boot. So konnten wir die ganze Nacht lang vorankommen. Am nächsten Morgen sahen wir dann, dass das Wetter immer schlechter wurde. Die Sonne verschwand, Wolken zogen auf und es wurde windig, wodurch erneut hohe Wellen aufkamen. Nun brach Panik auf dem Schiff aus. Die Leute stritten sich um das noch übrige Wasser. Zum Glück entdeckte uns dann ein Boot der italienischen Küstenwache und nahm uns an Bord. Alles schien sich zu beruhigen, denn die Küstenwache hatte genug Wasser und sogar etwas zu essen. Doch dann kam das nächste Problem, die italienische Regierung wollte uns nicht aufnehmen und gab unserem Schiff keine Erlaubnis im Hafen anzulegen. Also mussten wir die nächsten Tage auf dem Schiff der italienischen Küstenwache verbringen. Zunächst schien das kein Problem zu sein, doch dann wurde das Essen und Trinken erneut knapp. Es drohte wieder Panik auszubrechen. Auch die Schiffscrew bekam ein wenig Panik, sie funkten andauernd den Hafen an und baten um Anlegeerlaubnis, doch der Hafen verweigerte dies. Die Lage auf dem Schiff wurde immer schlimmer, weil sich eine Grippe verbreitete. Viele der Flüchtlinge bekamen Husten und hohes Fieber. Schließlich durften die Schwerkranken an Land, um in einem Krankenhaus behandelt zu werden. Das entspannte die Situation, da nun weniger Leute auf dem Schiff waren.
Zwei Tage später kam die Erlösung, es kam eine Nachricht, dass fünf EU-Länder sich dazu bereit erklärt hätten, uns aufzunehmen. Zu diesen Ländern gehörten Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland, was für uns natürlich sehr wichtig war.
Drei Stunden später legten wir im Hafen von Neapel an. Von dort aus flog uns ein Flugzeug nach Frankfurt, eine Stadt im Süd-Westen Deutschlands. Nun mussten wir aber selbst dafür sorgen, dass wir nach Berlin kamen. Vom Flughafen aus nahmen wir eine Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof und kauften mit unserem Restgeld ein Zugticket nach Berlin. In Berlin angekommen holte uns mein Opa vom Bahnhof ab. Wir fuhren in einen Stadtteil namens Zehlendorf, wo der Laden meiner Großeltern war.
Am nächsten Tag fuhren wir fünf zur Einwanderungsbehörde, um einen Pass zu beantragen. Meine Eltern hatten ein bisschen Angst, dass doch noch irgendwas schiefgehen konnte und man uns wieder zurück nach Syrien schicken würde. Doch alles funktionierte und wir bekamen die Erlaubnis, in Deutschland bleiben zu können. Meine Eltern übernahmen den Laden von meinen Großeltern. Meine Brüder und ich gingen auf eine syrische Schule, nicht weit weg von unserer Wohnung.
Alles war gut und wurde immer besser, mein Onkel kam mit seiner Familie auch zu uns nach Berlin und bekam ebenfalls einen Pass. Er eröffnete eine Autowerkstatt, in der ich und mein großer Bruder nach der Schule mithalfen. Mit dem ganzen Geld, was wir verdient hatten, konnten wir uns sogar eine größere Wohnung und ein neues Auto leisten.
(Felix Zitscher)
Zehnte Geschichte
Wir sind alle froh, dass es so gut ausgegangen ist. „Wir sind schon wieder bei neun Geschichten angekommen, wollen wir heute auch nach zehn aufhören“, frage ich. „Ja, würde ich schon sagen, aber darf ich eine erzählen“, fragt ein Mädchen in einem roten Kleid. Wir stimmen alle zu und die letzte Geschichte des Tages beginnt.
Wir saßen in einer Ecke der Scheune, mit Heu bedeckt und warteten darauf, dass unser Kindermädchen Elisabeth uns finden würde, aber sie kam nicht. In der Ferne konnte man eine monotone Stimme hören und daraufhin das Schluchzen meiner Mutter. Wir kamen aus der Scheune raus und liefen in Richtung des großen Herrenhauses von Eldena, in dem meine Familie für vier Generationen gelebt hatte. Dort stand meine Mutter, die einen Brief in der Hand hielt und weinte. „Mama? Wer war das“, fragte mein Bruder Hans vorsichtig, denn wir wussten, dass das nichts Gutes heißen konnte, wenn Mama weinte, denn sie weinte nie. Sie war die stärkste Frau, die ich kannte, sie kümmerte sich immer um alle und sorgte dafür, dass wir eine tolle Kindheit hatten, während mein Vater in Berlin in der Bank saß und nie vorbeikam. Damals konnte ich nicht verstehen, dass es keine persönliche Entscheidung meines Vaters war, sondern dass er keine andere Wahl hatte, denn Berlin war abgeriegelt.
„Hans, Angelika, wie seht ihr denn aus“, fragte sie mit einem Lächeln im Gesicht, denn wir waren ja immer noch von Kopf bis Fuß mit Stroh bedeckt. „Wer war das“, fragte mein Bruder erneut. „Niemand Wichtiges. Wisst ihr, wir fahren für eine Weile zu eurer Tante, okay“, antwortete meine Mutter und schob uns in Richtung Haus. Elisabeth kam aus ihrer Stube und nahm uns mit ins Badezimmer, wo sie uns badete und anzog. „Elisabeth, Mama meinte, wir fahren zu Tantchen. Kommst du auch mit“, fragte ich sie. „Ja, wir alle kommen mit euch.“ „Alle? Das wird aber ein voller Zug“, sagte ich lachend. „Ja, voll wird es auf jeden Fall. Ich hole euch jetzt etwas von dem Apfelkuchen, den Margaret heute frisch gebacken hat“, sagte sie und ging aus dem Raum.
„Hans: warum hat Mama geweint“, fragte ich, während ich langsam begriff, dass etwas anders war, als so, wie wenn wir sonst wegfuhren. „Angie, du bist noch ein bisschen zu klein, um das zu verstehen.“ „Das ist gemein, ich bin schon fünf, also nur vier Jahre jünger als du“, entgegnete ich trotzig, denn ich hasste es, wenn alle so taten, als ob ich zu klein war, auch wenn das nicht stimmte, aus meiner Sicht der Dinge. Einen Moment später kam Elisabeth mit dem Kuchen wieder und dazu auch noch mit Zitronentee mit Honig für meinen entzündeten Hals. Hans ging in sein Studierzimmer, um weiter seine doofen Bücher zu lesen. Ich malte ein Bild von uns allen, meine Familie, die Angestellten und im Hintergrund das alte Haus von Eldena. Ich benutzte meine liebsten und besten Buntstifte, die Papa zu Weihnachten geschickt hatte.
Als Mama am Abend ins Zimmer kam, um uns ins Bett zu bringen, gab ich ihr mein Bild, und als sie es entgegennahm, konnte ich erkennen, wie sehr sie ihre Tränen zurückhielt. „Das ist das Schönste, was du jemals gemalt hast, Angelika. Ich werde es immer dabeihaben, egal was kommt.“ Sie küsste erst meinen Bruder und dann mich, löschte das Licht und ging aus dem Zimmer. In dieser Nacht träumte ich von Weihnachten, wo wir alle zusammengesessen hatten und ich meine Stifte ausgepackt hatte. Eine Karte von Papa war dabei gewesen und Hans hatte sie mir vorgelesen, und ich erinnerte mich, dass auch Papa gesagt hatte, dass was immer auch kommt diese Stifte mir helfen würden, Kraft und Farbe in jeder denkbaren Situation zu finden.
Im nächsten Moment spürte ich, das mich jemand schüttelte. Ich wachte auf und sah das erschrockene Gesicht Elisabeths über mir. „Angie, du musst aufstehen und dich schnell waschen und anziehen, okay? Es ist sehr wichtig, dass wir schnell sind.“ Noch nie zuvor hatte ich sie so eindringlich und beängstigt erlebt. Hans war gerade dabei, sich anzuziehen, und nach einem Blick wusste ich, dass auch er nicht wusste, was passierte. Unsere Schränke waren leer, die Spielsachen weggeräumt und die Koffer gepackt. Elisabeth half mir, mein Kleid anzuziehen und meinen Teddy in eine kleine Leinentasche zusammen mit einer Tüte Proviant und meiner Ausgabe von „Emil und die Detektive“, mein liebstes Buch zu dieser Zeit, einzupacken. „Wo ist Mama“, war die einzige Frage meines Bruders. „Unten mit den Anderen“, antwortete Elisabeth hastig, während sie unsere Koffer zur Tür zog und mich auch.
Wir liefen in größter Eile die Treppe hinunter und es war wirklich ein komischer Anblick. Auch wenn es ungefähr elf Uhr abends war, befand sich niemand im ganzen Haus. Normalerweise wimmelte es hier nur so von Menschen, die immer irgendetwas taten. Die Betten aus den Gästezimmern waren weg und alle anderen wichtigen Sachen auch. Das letzte Zimmer vor der Haustür war die Küche und auch sie war leer, wirklich leer, nicht nur von Menschen, sondern auch von Vorräten und Töpfen. Als wir aus dem Haus traten, bot sich uns ein ungewohnter Anblick: Einige Angestellte, nahe Verwandte und auch Leute, die ich noch nie gesehen hatte, standen vor dem Haus und beluden die Pferdekarren. Meine Mutter bildete den Mittelpunkt des Geschehens, denn sie half den Alten und Kranken auf einen einzelnen Wagen. Selbst einige der Adligen aus den benachbarten Grafschaften und die Großgrundbesitzer aus Rappenhagen oder Kreisau waren hier.
„Kinder, kommt schnell hier rüber“, rief meine Mutter uns zu und wir liefen los. Nachdem sie uns in den Arm genommen und geküsst hatte, hob sie erst mich und dann Hans auf einen Karren zu den anderen Verwandten. Es gab insgesamt drei Karren, einen mit den Alten und Kranken, einen mit der Familie und den kleinsten mit den Angestellten. Geführt wurde unser Wagen von den Lieblingstuten meiner Mutter, ein Geschenk ihrer englischen Mutter, und diese wurden kontrolliert von der Dorflehrerin Mathilde aus Bremen. Ich verstand immer noch nicht, was passierte, denn warum sollten all diese Leute mit uns zur Tante fahren? „Wir fahren nicht zu Tantchen, oder“, sagte ich zu meinem Bruder. „Es scheint nicht so zu sein. Es muss etwas mit Ihnen zu tun haben.“ Mit Ihnen oder Sie, wie Elisabeth sie nannte, das waren die Leute, wegen denen Papa nicht hier sein konnte. Aber was hatten sie mit unserer Abreise zu tun? Ich kannte sie nicht mal, keiner sagte jemals den Namen, in der Angst, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.
Nachdem alle auf den Karren saßen, nahm meine Mutter höchstpersönlich auf dem Bock des Krankenkarrens Platz und alle setzten sich nacheinander in Bewegung. Nicht nur ich war verwirrt, denn auch Hans guckte, als ob er nicht wüsste, was passierte. Nach einiger Zeit auf dem Karren, mit dem ungleichmäßigen, aber trotzdem rhythmischen Gerumpel über die Wege des Waldes, schlief ich auf der Schulter meines Bruders ein. Ich musste bestimmt zwei Stunden geschlafen haben, denn als ich durch ein „Stopp!“ geweckt wurde, sah die Gegend schon ganz anders aus. Wir waren an einem Stützpunkt, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern angekommen und wurden von den Offizieren informiert, dass alle Männer zum Wehrmachtsdienst antreten sollten. Nach langen Diskussionen durften wir aber passieren, da viele von uns verwundet, krank oder schwach waren.
So ging es die ganze nächste Woche weiter, an jedem Stützpunkt dieselbe Forderung und wenn wir Glück hatten, mal hier und dort ein Dorf, das uns gewährte, für eine Nacht zu bleiben, um die Kranken zu versorgen, die Pferde zu pflegen und uns Kinder etwas spielen zu lassen. Mein Bruder bekam im Laufe der Zeit einen seltsamen Hautausschlag, den die Leute Krätze nannten, was dazu führte, dass er auf den Krankenkarren wechselte und dort ganz alleine zwischen den alten und sterbenden Leuten saß.
Es war Anfang Februar, also war es sehr kalt, und das Einzige, was uns alle wärmte, war die Tatsache, dass wir alle zusammenrückten und uns zu viert oder fünft eine Decke teilten. Meine Halsschmerzen waren immer schlimmer geworden, bis ich nicht mehr reden konnte, Schwierigkeiten beim Atmen hatte und auch hohes Fieber bekam. Bereits fünf Menschen aus unserer Gruppe waren auf der Reise an einer Lungenentzündung gestorben, weil wir ihnen nicht helfen konnten.
Sobald es meinem Bruder besser ging, fing er an, Tagebuch über unsere Ereignisse zu führen, über unser altes Leben, den Aufbruch und auch über die Zeit auf dem Weg in Richtung Hoffnung und Freiheit.
Irgendwann kamen wir endlich an der Grenze der britischen Besatzungszone an, wo unsere Karren aufgelöst wurden, die Pferde bis auf zwei weggenommen und wir alle verteilt wurden. Meine Mutter, mein Bruder, meine Tanten, ein paar unserer Angestellten und ich fuhren mit dem letzten verbliebenen Karren in Richtung des Gutes meiner Tante Karin von Barner. Nach langer Zeit ohne viel Essen, mit meiner Krankheit, weswegen ich kurz vor dem Sterben war, und der deutlich sichtbaren, emotionalen und physischen Belastung meiner Mutter freuten wir uns auf wenigstens einen Tag der Ruhe. Allein deswegen war unsere Enttäuschung umso größer, als wir dort ankamen.
„Hallo liebe Elsa, wie geht es euch denn“, fragte meine Tante als wir endlich auf dem Hof angekommen waren. „Leider nicht so gut. Angelika hat eine Lungenentzündung und unsere Vorräte sind fast leer. Aber wir sind froh, heute bei euch seien zu dürfen.“ „Ja natürlich, ich habe Agatha schon gebeten, euch den Stall herzurichten. Im Haus ist leider kein Platz mehr.“ Auch wenn meine Mutter in diesem Moment nichts sagte, war klar, wie enttäuscht und wütend sie über das Verhalten ihrer Schwester war. Karin, eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und einem großen Haus erlaubte es sich, uns im Stall zum Schlafen unterzubringen. Viel früher als eigentlich geplant, brachen wir am nächsten Morgen wieder auf, denn meine Mutter hatte von einem nahen Lazaretthaus gehört und hoffte, dort endlich Heilung für mich zu finden. Wäre dieses Lazarett innerhalb einer anderen Besatzungszone gewesen, so hätte ich die Reise niemals zu Ende bringen können, aber wegen der englischen Abstammung und der Adelsposition meiner Mutter wurde ich letztendlich doch im Krankenhaus untersucht und behandelt.
Während ich darauf wartete, dass der Doktor mich entließ, malte ich mit meinen Buntstiften ein Bild von Emil und seinen Freunden in Berlin. Wir mussten eine ganze Woche in dem Krankenhaus bleiben, bis wir weiterfahren konnten, nach Kiel, wo meine Mutter Hans und mich in die Betreuung eines Priesters gab, während sie sich Gedanken machte, wie unsere nächsten Schritte aussehen würden. Auch wenn der Priester von meiner Mutter gut bezahlt wurde, ließ er uns fast verhungern, was besonders für mich nach einer Krankheit wie der Lungenentzündung, weshalb ich sowieso schon abgemagert war, sehr gefährlich wurde. Aber bevor dies passieren konnte, kam meine Mutter eines Morgens in das Kloster, um uns mitzuteilen, dass uns erlaubt wurde, nach Berlin zu meinem Vater zu reisen. Diesmal nahmen wir nicht den Karren, sondern den Zug. Unsere Pferde fuhren ebenfalls mit, denn meine Mutter als begnadete Reiterin konnte und wollte sie nicht zurücklassen.
Es war wunderbar, nach der ganzen Zeit auf den Pferdekarren endlich in einem Zug zu fahren und auch zu wissen, wohin man fährt.
Auch wenn die Ankunft in Berlin nicht wie ein Wunder die ganze Welt rettete, so half es zumindest uns, wieder das Gefühl von einem Zuhause zu haben. Wir lebten in einem wunderschönen Haus mit Garten und viel Platz an der Grenze zum amerikanischen Sektor in Kladow. „Mama; was ist eigentlich mit Eldena passiert“, fragte ich meine Mutter an meinem zehnten Geburtstag, denn ich hatte schon lange darüber nachgedacht, aber ich konnte es mir einfach nicht erklären. „Eldena geht es gut, aber es gehört uns nicht mehr“, sagte meine Mutter und ich konnte die Trauer in ihrer Stimme hören. „Gehört es jetzt ihnen?“ Endlich hatte ich es ausgesprochen, denn auch wenn unsere Flucht aus Eldena schon vier Jahre her war, wusste ich immer noch nicht, wer Sie waren. Meine Mutter hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, aber sie erklärte mir: „Ja, Angelika, es gehört jetzt den Russen.“
(Fanny Beckmann)
„Wow, das heute waren echt unglaubliche Geschichten“, sagt ein junges Mädchen. Damit verabschieden wir uns und gehen zurück auf unsere Zimmer.