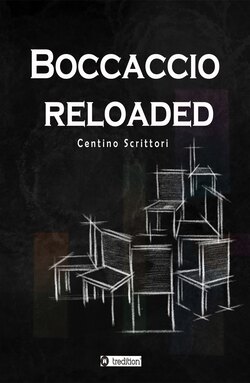Читать книгу Boccaccio reloaded - Centino Scrittori - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеERSTER TAG
Ich komme so gegen 17 Uhr in den Gemeinschaftsraum und zu meiner Überraschung sitzen dort sogar schon ein paar Leute von gestern. Ich freue mich und setze mich zu ihnen. Wir unterhalten uns kurz und ich schlage vor, noch auf ein paar Andere zu warten. Nach und nach trudeln weitere Menschen ein, unter anderem die ältere Dame von gestern. Langsam werden wir alle ein bisschen unruhig, deshalb schlägt ein Mann im mittleren Alter vor, dass wir doch jetzt anfangen können.
Erste Geschichte
Ein Mädchen im Schulalter überlegt, dass wir doch alle über das aktuellste Thema, also Epidemien oder Ähnliches sprechen könnten. Mir fällt dazu nicht auf Anhieb etwas ein, dem Mädchen aber anscheinend schon.
Januar 2020
Mittwoch. Ich steige aus der U-Bahn, als ich es das erste Mal höre. Ein Mann kommt auf mich zu.
„Das Virus wird uns alle einnehmen!“, ruft er. Seine Augen sind geweitet, rot und sie tränen fast.
Ich bin schockiert, von welchem Virus konnte die Rede sein? Covid-19, ein neuartiges Virus aus China. Aber das gibt es doch nur in China! Ich schüttele den Kopf und gehe weiter.
Donnerstag. Meine Freunde und ich sitzen im Flur und warten, bis der Unterricht beginnt. Einer niest. „Corona Virus!“, scherzt ein anderer. Ich lache, alle anderen auch. Es ist ja auch lustig. So abwegig, das Virus wird doch niemals in unserer unmittelbaren Umgebung ankommen. Das ist schwachsinnig. Absolut realitätsfern.
Freitag. „Es gibt über 5.000 Infizierte in China. Und schon zehn Tote. Wenn es denn stimmt.“ Im Flüsterton liest mein Sitznachbar die Nachrichten von seinem Handy. Ich lächle ihn an. „Mach dir keine Sorgen. Das ist alles ganz weit weg. Wir sind hier in Sicherheit.“
Februar 2020
Samstag. „Das Corona-Virus ist nun in Japan angekommen. Dort gibt es nun schon zwei Infizierte. Dennoch, Experten sagen, dass dieses Virus nicht gefährlicher als die Grippe ist.“ Beruhigt atme ich auf. Die Nachrichten berichten weiter über Krieg, aber das neue Corona-Virus kommt auch oft vor. -Am Anfang: Es gibt täglich ein einminütiges Update über die Situation im China. Aber trotzdem: Angst macht es mir nicht.
Montag. Heute höre ich nichts von dem Virus. Alles ruhig. Aber es bleibt in meinem Kopf.
Dienstag. Sturm. Es herrscht Sturm draußen. Das ist das Thema der Nachrichten heute. Nichts Anderes. Corona? Warum sollte man darüber berichten?
Donnerstag. Der erste Corona Virus Fall in Deutschland. Aber nicht in Berlin, sondern in Bayern.
Wir sind nicht in Gefahr. Ich denke nicht weiter darüber nach. Es gibt keine Gefahr.
Samstag. Der zweite Fall in Deutschland. Aber nicht in Berlin. Keine Gefahr. Keine Gefahr!
Sonntag. Ich war gestern Abend noch auf einer Party. Alles war normal. Ausgelassene Stimmung, manche haben ihr Bier geteilt, ich aber nicht. Ich mag das einfach nicht.
Freitag. Die Nachrichten berichten jeden Tag länger über das Virus, es scheint, als würde es nun als bedrohlich eingestuft werden. Dabei gibt es gerade mal 100 Fälle, verteilt auf zehn der 16 Bundesländer. Ich scrolle durch YouTube. Ich sehe Videos aus Wuhan. Die Leute stehen an den Fenstern und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Ich freue mich darüber, dass endlich Wochenende ist. Ich bin auf eine Party eingeladen. Der 16. Geburtstag einer Freundin. Das wird toll. „Wohoo! Auf dieser Party verbreiten wir Corona! Corona-Party!“ Ich runzle die Stirn. Es gibt doch aber noch gar keine Fälle in Berlin? Mein Kumpel tippt mich an: „Der labert schon den ganzen Abend miesen Bullshit. Er sagt sogar, dass wir alle daran sterben werden. Hör einfach nicht auf das, was er da von sich gibt.“
Montag. Als ich vor dem Klassenraum ankomme, sitzt da eine gute Freundin von mir. Sie starrt ihr Handy an. „Es gibt den ersten bestätigten Corona Virus Fall in Berlin.“ Okay, das ist kein Grund zur Panik. In den Nachrichten sagen sie immer noch, es sei ungefährlich. Etwa auf demselben Level wie eine Grippe. Ich hatte noch nie die Grippe. Aber mein Bruder einmal.
Mittwoch. Es ist eine Woche vergangen seit dem ersten Fall. Die Zahl steigt stetig, nun sind auch schon alle Bundesländer betroffen. Ich denke an meine Verwandten, die im Ausland wohnen. Wird es sie auch treffen?
März 2020
Freitag. Italien ist besonders betroffen. Die Zahl der Infizierten schießt in die Höhe und es ist kein Ende in Sicht. In China ist schon seit Wochen alles dicht, in Italien seit heute. Ob uns das auch noch ereilen wird? Ich glaube nicht. Und „Nein!“, das sagen auch die Experten.
Dienstag. Ich hatte heute Training. Sport tut gut. Ein guter Freund dort hat mich zu einem Kinobesuch eingeladen. Ein neuer Actionfilm, der in vier Wochen rauskommt. Ich steh auf sowas.
Donnerstag. Es klingt langsam an, dass das Virus doch gefährlicher als eine gewöhnliche Grippe ist. Es gibt schon so viele Tote. Jeden Tag berichten die Nachrichten eine Minute länger über die aktuelle Situation. Die Epidemie scheint sich immer schneller zu verbreiten.
Sonntag. Eine unaufhaltsame Welle. So beschreibe ich in Gedanken diese Krankheit. Die Corona Toten in China, es sind unzählige. Auch wenn kaum jemand den Zahlen der chinesischen Regierung glaubt. Ich frage mich, wie viele noch folgen werden.
Dienstag. „Häufig Händewaschen, das bedeutet, als Erstes, wenn ihr hier in der Schule ankommt, und als Erstes, wenn ihr zuhause seid.“ Unsere Schule führt die angeordnete Schulung durch. Befehl von oben. „Jetzt zeigen wir euch noch ein Video, wie man richtig seine Hände wäscht.“ Ich kichere in mich hinein. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Verhängt das Gesundheitsministerium wirklich die Maßnahme, uns beizubringen, wie man sich die Hände wäscht, obwohl man das tagtäglich macht?
„Lächerlich. Wir sind 16, wir wissen wie das geht“, auch mein Sitznachbar muss lachen.
„Mindestens 20 Sekunden lang die Seife verteilen, dabei nicht die Fingerzwischenräume vergessen“, tönte die Stimme aus den Lautsprechern des Computers. Schwachsinn, denke ich.
Samstag. Heute steht unser Wocheneinkauf an. Wir gehen in unseren Stammsupermarkt, der zwei Straßenecken weiter ist. Er ist recht groß und befindet sich an einer viel befahrenen Straße. Er ist heute voller als sonst. Ich denke mir nichts dabei. Bis ich auf der Einkaufsliste Nudeln sehe. Ich gehe zum Regal. Ist es wirklich das Regal? Es ist komplett leer. Nichts ist mehr da. Keine einzige Packung Nudeln. Völlig verblüfft sehe ich mich um. Auch gehackte und passierte Tomaten sind ausverkauft. Ich kann es nicht fassen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Mittwoch. Was? Veranstaltungen sollen abgesagt werden? Ab 1000 Personen, das ist es, was sie heute verkünden. Ich kann es kaum fassen. Das betrifft mich zwar nicht, aber alle Fußballspiele, die stattfinden sollen. Mein Onkel geht gerne ins Stadion, doch das ist jetzt hinfällig. Er wollte diesmal meinen Bruder mitnehmen. Der ist zwar schon 21 und studiert, aber er versteht diese ganze Sorge um das Virus trotzdem nicht. Und ich? Ich bemühe mich einfach nur um gute Laune. Das scheint mir das Wichtigste. Außerdem muss ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Corona hin oder her.
Donnerstag. Von 1000 auf 100 auf 50 Personen sinkt die Zahl der bei einer Veranstaltung zugelassenen Personen. Innerhalb eines Tages! Woher kommt dieser Sinneswandel? Auf einmal heißt es auch, dass Corona tödlicher ist als die Grippe. Auf den Straßen laufen die ersten Menschen mit Mundschutz herum.
Freitag. Die Ereignisse und Entscheidungen überschlagen sich. Sollen die Schulen geschlossen werden? Das ist heute in aller Munde. Es findet eine Konferenz diesbezüglich statt. „Zum Schutz, der Alten und chronisch Kranken“, wird immer gesagt. „Die Schulen werden nicht schließen. Da können Sie sich sicher sein“, sagt uns unser Deutschlehrer. Zwei Stunden später wird es verkündet: Die Schulen werden vorläufig zumachen. Nur noch Montag sollen wir kommen und uns Arbeitsaufträge abholen. Kinos müssen übrigens schließen. Das war’s dann wohl mit meinem Film.
Montag. Ich sehe meine Freunde. Ihre Gesichter sehen etwas bedrückt aus. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass das Virus wirklich ernstgenommen wird. Online-Unterricht ist jetzt angesagt.
Dienstag. Wache ich da gerade noch in meiner eigenen Welt auf? Oder in einer wüsten Zukunft? Wie viel Zeit ist seit Corona vergangen? Fünf Jahre? Nein, es ist der erste Tag der unterrichtsfreien Zeit, nur wegen SARS-CoV-2. Auch mein Training wurde abgesagt. Diese verdammte Krankheit.
Mittwoch. Keine EM. Kein Olympia. Alles abgesagt, mir bleibt nur noch Online-Schule. Alle Lehrer bitten uns Schüler zuhause zu bleiben. Alle Läden sollen schließen. Eine Maßnahme, um das öffentliche Leben einzuschränken. Die Infektionswelle soll verlangsamt werden. Kein Mensch lächelt mehr.
Donnerstag. Jeden Tag gibt es Spezialsendungen über das Virus. Die Ausgangssperre in Italien wird verlängert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann sie erlassen wurde. Fast alle Krankenhäuser dort sind überlastet. Die Sterberate ist unfassbar hoch. Die Ärzte müssen entscheiden, wen sie nach Hause schicken, um dort allein zu sterben, und wen sie behandeln. Ich hoffe, dass uns das hier nicht passieren wird. Überall auf der Welt scheint Corona nun zu greifen. Schutzkleidung wird bald Mangelware sein. Das kann doch nicht die Realität sein?! Doch viele junge Leute verstehen das nicht. Es werden Corona-Partys veranstaltet. Ein Mitbewohner meines Bruders feiert fast jeden Tag, seit die Unis zu sind. Ich habe deswegen fast einen Wutanfall bekommen. Abends wird gemeinschaftlich am Fenster für Ärzte applaudiert. Jeder sollte so selbstlos sein wie sie.
Freitag. Ich habe meinen besten Freund am Telefon. „Ich vermisse den Alltag. Irgendwie bekommt man jetzt erst richtig Lust, entspannt eine Runde shoppen zu gehen. Und danach ins Restaurant.“ „Ich weiß genau, was du meinst. Ich darf mich auch nicht mehr mit Freunden treffen. Ich vermisse dich.“ Ich lächle in mich hinein. „Ich dich auch. Wenn das hier vorbei ist, müssen wir uns sehen.“
Sonntag. Kontaktverbot. Nach der Schließung der Grenzen und dem Reiseverbot musste das der nächste Schritt sein. Das ist quasi eine Ausgangssperre unter verdecktem Namen. Und daran sind Leute wie dieser Freund meines Bruders Schuld. Meine Eltern wechseln ins Home-Office.
Eine neue Vorschrift der Regierung. Wie immer: zur Eindämmung des Virus.
„Ab hier ist alles ausgedacht und hoffentlich wird es nie so weit kommen, aber ich würde trotzdem gerne noch weitererzählen“, warnt das Mädchen uns und als von allen Seiten Zustimmung kommt, erzählt sie weiter.
April 2020
Freitag. Die letzten zwei Wochen zogen wie ein Alptraum an mir vorbei. Fast in der gesamten EU wurde eine Ausgangssperre verhängt. Überall sind die Krankenhäuser überfüllt. Meinen Opa hat es auch erwischt. Er liegt auf der provisorischen „Intensivstation“ auf dem Messegelände. Ich unterdrücke die Tränen. Das alles ist so surreal. Ich kann nicht glauben, dass das echt passiert.
Sonntag. Die ganze Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Hierzulande horten die Leute Toilettenpapier, in Schottland Whiskey, in Frankreich Rotwein und Käse. Vernünftig, so kann man seine Sorgen in Alkohol ertränken. In den USA kaufen alle vorsorglich Waffen. Unterbewusst prophezeie ich den USA einen Bürgerkrieg. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.
Mittwoch. Die Nachrichten kennen kein anderes Thema als die Pandemie mehr. Mein Opa ist gestern verstorben. Ich kann nicht mehr. Tränen fließen über mein Gesicht. Es soll endlich aufhören! Die Wirtschaft steht vor dem Abgrund, sogar die Lebensmittel könnten knapp werden, weil keine Erntehelfer da sind. Die Schulden dürften ins Unermessliche steigen, da diese Krise allen zu schaffen macht. Ich wollte mir die Zahlen nicht so genau anhören, aber es sind jetzt schon mehr als 1.000.000 Tote weltweit. Hier sind es schon weit über 20.000 und es werden ständig mehr.
Juni 2020
Obwohl draußen ein lauer Sommerwind weht, fühlt es sich nicht nach Sommer an. Die Temperaturen um die 24°C dringen nicht zu mir durch. Mir ist kalt. Forscher haben auf eine Besserung bei wärmerem Wetter gehofft, doch diese kam nicht. Stattdessen scheinen die Menschen verrückt geworden zu sein. Der Schulbetrieb wurde für zwei Wochen aufgenommen und sofort wieder fallengelassen. Manche Schüler werden als Sargträger eingesetzt. Jeder bemerkt es, der Staat geht langsam pleite. Man weiß nicht, wohin mit all den Leichen. Mein Bruder wurde vom Militär eingezogen, er patrouilliert durch die Straßen, denn die Soldaten sollen für Sicherheit sorgen. In den USA ist bereits der Bürgerkrieg ausgebrochen. Alle Menschen sind verzweifelt, hier befürchten viele dasselbe. Die Lebensmittel sind auf dem Feld verdorben, weil niemand sie ernten konnte. Niemals hätte ich gedacht, dass ich erfahre, wie es sich anfühlt zu hungern. Ich umklammere das Telefon. „Meinst du, sie werden noch ein Heilmittel finden?“ „Ich hoffe es. Hey, vielleicht sollten wir beide anfangen zu forschen, was meinst du?“ Ich schmunzle und sehe aus dem Fenster. Die Straßen sind leer, die Stadt sieht wie ausgestorben aus. Dann muss ich husten. Corona positiv. Aber ich werde es sicher überleben. Mit einer Sache hatte der Mann Recht: Das Virus nimmt uns alle ein.
(Tamara.-U. Lorenz)
Zweite Geschichte
Wir sind alle wegen der letzten Geschichte noch ziemlich in unseren Gedanken versunken, als die ältere Dame von gestern sagt: „Ach Mensch, hoffen wir, dass das alles nicht so weit kommen wird. “ Das hoffen wir natürlich alle. Ein alter Herr meldet sich nun zu Wort, um uns seine Geschichte „Jene Jahre des Krieges“ zu erzählen. Wir hören alle gespannt zu und er fängt an.
Immer wieder bin ich verblüfft, wie normal unser Leben heute scheint. Eigentlich waren ich oder meine Familie nie von besonderen Zuständen oder tragischen Schicksalen betroffen. Meine Geschwister, Eltern und ich hatten zwar den Krieg erlebt, doch war das in dem Sinne nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz waren meine Enkel immer wieder an meiner Jugend interessiert. Für sie waren die Zustände, unter denen ich damals lebte, nur schwer vorstellbar. Sie wollten wissen, wie ich damals gedacht und gefühlt hatte. Ich begann also, mich mit meinen frühen Jahren auseinanderzusetzten. Vor allem erinnerte ich mich daran, dass ich oft auf der Suche gewesen war nach Antworten auf zahlreiche Fragen, die mich nicht losließen.
Früh fing es an, als ich noch ein kleines Kind war. Nächtelang weinte ich, weil mir klar wurde, dass wir alle eines Tages sterben werden. Ich war vollkommen ratlos. Unvorstellbar war mir die Unendlichkeit. Was hatte ich, was hatte meine Seele all die Jahrmillionen von Jahren, ja die Unendlichkeit, die bereits vor meiner Geburt verstrichen war, gemacht? Nichts, einfach nichts. Und der Gedanke, dass das Gleiche mir noch einmal bevorstehen würde, doch dass ich diesmal aus dem Nichts nicht erwachen würde, ließ mir mein komplettes irdisches Dasein und jenes meiner Mitmenschen komplett nichtig erscheinen. Nachts, völlig aufgelöst, kam ich zu meinem Vater, der träumend in der Badewanne saß. Ich wusste nicht, was ich schlimmer finden sollte: Dass ich eines Tages sterben sollte oder dass ich eines Tages meine Mutter, meinen Vater oder meinen Bruder verlieren sollte? Ich erzählte ihm also von meinem Kummer und er sagte mir, dass wir nicht zu sehr über unsere Vergänglichkeit trauern, sondern das, was wir haben, unser Leben, in vollen Zügen genießen sollten. Sich den Kopf zu zerbrechen, gar traurig zu sein, bringe doch überhaupt nichts.
Wie Sie sich sicher vorstellen können, fand ich diese Antwort damals höchst unzufriedenstellend. Es wäre eine Lüge zu sagen, dass das heute wirklich anders ist, aber irgendwann erkannte ich, dass die Antwort meines Vaters die beste zur Verfügung stehende war.
Als ich dann erwachsen wurde, kam der Krieg. Es war eine Zeit, in der mich viele Fragen heimsuchten. Die Stimmung war zunächst gut und ich war beeindruckt von all dem Tamtam der Großstadt. Ich weiß noch, wie ich damals, ich war noch vor Kriegsbeginn nach Berlin gezogen, von den Nachbarn eingeladen wurde. Es war der Abend des 14. Juni 1940 – die Besetzung von Paris. Ich sah keinen Grund zu feiern, dass eine weitere Stadt in die Hände eines Verrückten gelangt war, und da ich dieser Meinung war und die meisten meiner Mitbewohner überzeugte Parteimitglieder waren, mied ich den Kontakt zu ihnen. Sie waren jene Art Menschen, die nie gesucht hatten. Als Hitler kam und sagte, die Juden seien an allem schuld, da glaubten sie ihm. Gefragt, gesucht wurde da nicht viel.
Nun, wenn man Menschen scheut, die nicht suchen, sondern folgen, dann ist man meist recht einsam und so war es vor allem in jenen Jahren, als Deutschland der Welt zeigte, dass es auch im Diesseits eine Hölle geben kann.
Ich erinnere mich noch an jenen fahlen Greis, der zu dieser Zeit im Dachgeschoss wohnte. Ein blasser alter Mann. Er hatte im Ersten Weltkrieg gedient, wurde in der Schlacht von Verdun verwundet und verlor den rechten Arm. Als er heimgeschickt wurde, schied sich seine Frau von ihm und heiratete seinen Bruder. Ich wusste nicht, ob ich Mitleid mit ihm haben sollte. Er hatte verloren, was er gefunden hatte. Bald verlor er dann auch seinen Job und begann zu trinken. Ich war stets beeindruckt, wenn er jeden Montagmittag seine Flaschen heruntertrug, den Nachschub besorgte, und ich fragte mich dann, ob dort oben noch drei seiner Freunde wohnten.
Die Wohnung, in die ich 1937 einzog, gehörte einst einer jüdischen Familie, die um diese Zeit ihr gesamtes Vermögen verlor und später nach Litzmannstadt deportiert wurde. Als ich den Hausverwalter das erste Mal traf, ich glaube, es war die Schlüsselübergabe, begrüßte er mich mit einem scharfen: „Heil Hitler!“ Er war klein und etwas dick und versicherte mir, wie froh er sei, endlich dieses „Dreckspack“ losgeworden zu sein. Es freue ihn, so sagte er, eine „reinblütige Arierin“ als zukünftige Mieterin zu haben. Ich glaube sogar, es war ein Montagmittag. Dies würde zumindest erklären, warum ich auch den fahlen Greis dort zum ersten Mal sah. Ich glaube, er bemerkte meine Resignation – als wir da im Treppenhaus standen und ich doch eigentlich nur meinen Schlüssel haben wollte. Für einen Krüppel hatte der Hausverwalter nicht viel übrig, und da ich nicht viel für den Hausverwalter übrig zu haben schien, kam ich vielleicht als Zeitgenosse in Frage. Auf jeden Fall lud der fahle Greis mich bald auf einen Whiskey zu sich nach oben ein. Wir unterhielten uns einige Zeit lang. Dann erzählte er mir seine Geschichte: Seine Frau hatte ihn nicht mehr haben wollen. Sein Arbeitgeber auch nicht und schlussendlich auch nicht mehr sein Vaterland, für welches er seinen Arm verloren hatte: „Nur der Schnaps hält es noch mit mir aus und er ist ein treuer Wegbegleiter,“ sagte er dann. Schrecklich war sein Leben, und noch schrecklicher sein Selbstmitleid. Er nahm es den Franzosen schon fast übel, dass sie ihn nicht ganz erwischt hatten. Um Mitternacht fing er dann schrecklich an zu fluchen. Das Glas berührte immer öfter seine Lippen, schließlich griff er direkt zur Flasche. Es wurde würdelos und unangenehm, sodass ich beschloss zu gehen. Seitdem grüßten wir uns nur noch auf dem Flur.
Als Anfang 1943 Stalingrad verloren war, schien etwas in der Luft zu liegen. Nicht, dass die Menschen anfingen zu zweifeln. Sicherlich gab es jene, die jetzt oder auch schon davor ahnten, dass ihr Land aus diesem Chaos nicht heil davonkommen würde, doch die Mehrheit schien sich nichts anmerken lassen zu wollen. Zwar fielen die Anlässe für Einladungen mehr und mehr aus – was nebenbei bemerkt mich nicht weiter bedrückte –, doch umso schärfer, umso ernsthafter wurde das „Heil Hitler!“ meines Hausverwalters.
Auf den Straßen ging auch sonst das Leben weiter. Die Menschen saßen, standen und unterhielten sich – quatschten regelrecht. Man sah Schuljungen, die Rohstoffe für die Industrie sammelten. Sonntags wurde in den Parks idyllisch gepicknickt, natürlich mit sparsamer Verpflegung. Doch kaum jemand verlor ein Wort über den Krieg.
Ende 1943 kamen dann die Flieger immer häufiger und mit ihnen auch der Tod. Ich dachte an meine Kindheit zurück und dann an meine Familie, die ich in einem kleinen Dorf bei Potsdam zurückgelassen hatte. Der Anblick der brennenden Häuser war tragisch und doch faszinierte er mich. Warum fügt der Mensch sich solch ein Leid zu, fragte ich mich später immer wieder, suchte verzweifelt nach einer Antwort. Warum suchte er eine Vernichtungsbeziehung mit so vielen Dingen in der Welt? Es war eines der Dinge, für die ich zeitlebens keine Antwort fand.
Mit den Luftangriffen wurde dieser Zerstörungswille, dieser Zerstörungszwang Teil unseres Alltags. Der Krieg war nicht mehr irgendwo in der Ferne, sondern nun bei uns. Fast jeden Abend dröhnten die Sirenen. Morgens brannten die Häuser. Ich weiß noch, wie ich kurz nach dem Krieg zurück nach Berlin musste, um einige Verwaltungsangelegenheiten zu klären. Erst damals wurde mir das ganze Ausmaß der Zerstörung klar. Als ich 1937 eingezogen war, war Berlin eine stattliche Metropole gewesen. Nun sah ich einen Trümmerhaufen vor mir liegen. Ich schaute in die Augen einer jungen Frau und dachte an das Zerstörerische, an das Böse im Menschen. Umso mehr faszinierte mich sein Streben nach Normalität. Der ein oder andere verlor seine Wohnung, doch die Menschen schienen sich noch immer nichts anmerken lassen zu wollen.
Besonders merkte ich dies in meinem eigenen Haus. Die Nächte verbrachten wir im Luftschutzkeller. Der Hausverwalter, seine Frau, die Frau mit Kind, die im Geschoss über mir wohnte, und der fahle Greis, wir alle saßen dort unten und warteten. Die Luft war dick und muffig, es rieselte Staub von der Decke, es wurde kaum ein Wort geredet. Das Kind weinte schrecklich. Es merkte die Angst seiner Mutter. Sie saß dort, ihr Kind im Arm, und sprach nie ein Wort. Ihr Mann kämpfte noch im Osten, sie wusste, wie aussichtslos die Lage war. Manchmal schimpfte der Hauverwalter über das Geschrei des Kindes. Manchmal fluchte er über die Juden und was sie Deutschland eingebrockt hätten. Seine Frau saß neben ihm. Sie war totenblass und zitterte. „Sie werden uns alle holen“, rief sie und erzählte dann von „den Russen“ und was sie mit den Deutschen machen würden. Der fahle Greis schien davon recht unbeeindruckt. Zur Stunde der Luftangriffe war er bereits wieder oder noch immer im Vollrausch. Er kam langsam die Treppe hinuntergeschritten. Wenn er den Keller betrat, erfüllte eine Fahne den Raum, die der Hausverwalter gelegentlich als „in unerhörtem Maße unpatriotisch“ bezeichnete. Mehr sagte er nicht, vielleicht weil er noch ein wenig Respekt hatte für den fahlen Greis, der schließlich für sein Deutschland in den Krieg gezogen war. Vielleicht fürchtete er aber nur den schweren, muskelbepackten linken Arm, den der fahle Greis noch hatte, vermutlich so stark von der ganzen Flaschenschlepperei. Wenn dann die Frau des Hausverwalters mit ihren Geschichten über „die Russen“ anfing, lallte er nur: „Sollen sie doch kommen!“
Auch ich hatte Angst. Doch Angst ist ein Zustand, an den man sich schnell gewöhnt. Es war nicht jene Angst vor dem Tod, wie sie mich in den Jahren meiner Kindheit nachts heimsuchte. In diesen Nächten war es etwas Intuitives, etwas, was ich nur schwer kontrollieren konnte. Es war, als würde ich zu einem Tier mutieren, dessen Überlebensinstinkt die Kontrolle übernimmt. Ich dachte dann manchmal an die Menschen, die in diesen Nächten starben. Tragisch war all das, doch ich merkte, wie wenig mich ihr Tod interessierte – wie wenig mich der Tod an sich interessierte. Ich dachte nicht mehr über ihn nach, sondern nur noch über das Leben. Ich schätze, in dieser Zeit suchte niemand nach den Fragen und Antworten des Todes. So wie ein Seiltänzer niemals nach unten schaut, entwickelte man einen starren Blick auf das Leben. Ebenso stark wie der Wille zum Leben war der Wille, die Normalität zu erhalten. Je dunkler die Nächte im Luftschutzkeller, umso heller versuchten die Menschen den Tag zu machen. Immer noch gab es Picknicks im Park, die Frau des Hausverwalters trug sonntags ihr Kleid, fröhlich wurden Lieder beim Straßenfreiräumen gesungen. An Ostern 1944 war die Stimmung gut. Ich merkte es ja an mir selbst; ich ging nun ins Café und las Zeitung wie an einem gewöhnlichen Sonntag. Es war, als ob das Offensichtliche verschwand, wenn es nicht ausgesprochen wurde. Es war damals präsent in jedem Moment unseres Lebens. Hätte man es ausgesprochen, dann wäre es zu viel geworden, dann wäre vielleicht Schluss gewesen. Worüber ich lange Zeit nachdachte, war die selbstsüchtige Sturheit, eine Feigheit, die zu den Grausamkeiten dieser Jahre führte; darin musste ich einen faszinierenden Überlebenswillen erkennen. Ein naiver Instinkt, der mich in dieser Zeit antrieb. Umso irritierender war es, wenn dieser Instinkt bei jemandem versagte. Der fahle Greis sah seit Wochen besonders schlecht aus. Eines Tages stand er dann an meiner Tür und bat mich um Geld. Er hatte keine Fahne, was mich nicht überraschte, und erzählte mir, dass in seinem alten Lebensmittelgeschäft eine Bombe eingeschlagen war und dass er nun nicht mehr an seinen Schnaps rankommen würde. Er scheute sich nicht mehr, das Offensichtliche auszusprechen. Ich gab ihm ein paar Mark, dann zog er dankend ab. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
Die folgenden Tage war er nicht im Luftschutzkeller anzutreffen. Dann eines Nachts, wir saßen da, der fahle Greis fehlte wie die Tage zuvor, gab es einen gewaltigen Knall. Staub rieselte von der Decke. Die Frau des Hausverwalters schrie schrecklich. „Jetzt haben sie uns“, brüllte sie. Das Kind der Nachbarin von oben war verdutzt. Im Gegensatz zur Frau des Hausverwalters war es nun still und guckte nur entgeistert in die Runde – man hatte ihm seine Rolle geklaut. In diesem Moment dachte ich nicht an den Tod anderer Menschen, sondern an meinen eigenen. Als das Feuer am folgenden Tag gelöscht wurde, holten sie uns aus dem verschütteten Keller heraus. Gleich zwei Bomben hatten das Haus getroffen. Die erste war neben dem Haus eingeschlagen und hatte die Fassade zersprengt, die zweite, eine Brandbombe, hatte das Haus in Flammen gesetzt. Selten sah ich einen solch hasserfüllten Menschen wie die Frau des Hausverwalters an diesem Tag, als wir aus den Trümmern kletterten. Jetzt, wo sie auf die Überreste ihres einstigen Zuhauses guckte, jetzt, wo sie in Sicherheit war, entlud sich all ihr Zorn und all ihre Wut auf „die Russen“ und „die Juden“ und all die Völker, die angeblich ihr Heim und ihre Nation zerstört hätten. Es gibt wirklich nur wenige Dinge, die hässlicher sind als ein Mensch, dessen Herz voll Hass ist. Bald fragte ich mich, wo der fahle Greis stecke. Wir halfen den Tag über zu bergen und Teile der Trümmer wegzubringen. Bei Sonnenuntergang fanden wir ihn dann. Es war nicht mehr viel von ihm übrig, mir wurde schlecht und ich fragte mich, ob er sich schon davor ein Ende gesetzt hatte. So endete meine Zeit in der Hauptstadt. Es gab nun nichts mehr, was mich hier hielt, und schon am nächsten Tag nahm ich den Zug nach Potsdam.
Das ist der Punkt, bis zu dem ich meinen Enkeln die Geschichte meistens erzähle. Dann setzt mein Mann ein und erzählt ihnen, wie ihr Opa ihre Oma noch vor Kriegsende in Brandenburg kennengelernte, wie sie 1945 heirateten und bald zu seiner Mutter nach Frankfurt zogen, um sich dort samt Kindern durch die Nachkriegszeiten zu kämpften.
Ich glaube, ich lernte in jenen Jahren des Kriegs, dass all das Fragen nach dem Leben und dem Tod, die Angst vor der Unendlichkeit Luxusprobleme sind. Ich hatte mit dem Tod Bekanntschaft gemacht und gemerkt, dass es darum ging, sich auf das, was zählte, das Leben, zu konzentrieren.
Irgendwann wollten meine Enkel dann auch wissen, was denn mit den Juden gewesen sei. Ich erinnerte mich an die 50iger, als der Holocaust zum ersten Mal in der Öffentlichkeit thematisiert wurde. Ich las damals von dem Film „Nacht und Nebel“ in einer Sonntagszeitung. Die Bilder sahen schlimm aus. Ich hatte viel gesehen, besonders in den letzten Monaten des Krieges, doch das war etwas Anderes. Das kannte ich nicht, war nicht Teil meines Lebens gewesen. Ja, ich hatte in der Wohnung einer jüdischen Familie gelebt, ja, auch ich hatte bemerkt, wie die Juden Stück für Stück aus der Stadt verschwanden, doch ich war nicht daran beteiligt gewesen. Immer war ich der Partei gegenüber kritisch gewesen, hatte sie gar verachtet – wenn auch nur im Geheimen. Mich ärgerte es, dass alle so argumentierten wie ich. Der Hausverwalter, der SS-Mann, der Wehrmachtssoldat, alle sagten sie, sie hätten damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich ahnte, dass auch hier ein tiefliegender Selbstschutzmechanismus mich davor bewahrte, etwas Unaussprechbares auszusprechen.
(Paul Oswalt)
Dritte Geschichte
Die nächste Geschichte kommt von einem eher unauffällig gekleideten, ca. zehn jährigen Jungen, der mit seiner Mutter da ist. Er erklärt kurz, dass diese Geschichte zum Glück erfunden ist und meint, wenn er die Geschichte betiteln müsste, würde sie „das Ende des Amstelvirus“ heißen.
Es ist das Jahr 3001, es herrschte lange Ausnahmezustand. Die ganze Welt kämpfte vier Jahre lang mit einem Virus, dem Amstelvirus. Die Symptome sind Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit und eine verstopfte Nase. Es endet immer tödlich. Die Welt hatte schon sehr viele Menschen verloren, denn es gab dramatischerweise keinen Impfstoff.
Viele hofften auf einen Impfstoff. Auch Benjamin, ein kleiner, zehnjähriger Junge. Deswegen forschte er mit seinem Opa Hans nach einem Impfstoff. Sein Opa war ein 86-jähriger Wissenschaftler, der eigentlich auf Meeresbiologie spezialisiert war. Nach über einem Jahr Tüfteln war sich Hans sicher, ein Gegenmittel, das tatsächlich funktioniert, entwickelt zu haben. Vor lauter Freude rief er Benjamin und rannte die Treppe seines Hauses herunter. Er fiel hin und schlug sich den Kopf an seinem Schuhregal auf. Benjamin rief sofort die Polizei und seine Eltern an und steckte den Impfstoff in seine Strickjacke. Durch das Virus war das Gesundheitssystem überlastet. Der Krankenwagen kam zu spät, Hans war bereits verblutet. Kurz nach dem Krankenwagen trafen Benjamins Eltern ein. Sie nahmen den weinenden Benjamin mit nach Hause.
Am nächsten Tag probierte Benjamin seinen Eltern zu erklären, was passiert war und dass sein Opa einen Impfstoff entwickelt hatte, doch seine Eltern stempelten Hans als einen verrückten Wissenschaftler ab. Sie sagten, dass sie verstehen, dass er traurig und es schrecklich sei, dass er seinen Tod hautnah miterleben musste. Damit er sich ausruhen konnte, schickten sie ihn auf sein Zimmer. Benjamin liebte seinen Opa sehr, für ihn war er der coolste Mensch auf der Welt. Er glaubte fest daran, dass der Impfstoff wirklich funktionierte. Die nächsten Tage verbrachte er damit, seine Eltern zu überzeugen, den Impfstoff an die Kollegen von Hans zu schicken, doch die Eltern dachten, sie würden sich und Hans vor den Kollegen lächerlich machen. Benjamin fing an zu überlegen, wie er den Impfstoff an die Öffentlichkeit bringen konnte. Ihm ist durchaus bewusst gewesen, dass einem Zehnjährigen nicht so leicht Glauben geschenkt wird. Wenn nicht einmal seine Eltern ihm glaubten, wer würde ihm dann glauben? Die Frage stellte sich Benjamin auch und weil ihm zunächst niemand einfiel, wurde er schnell entmutigt und gab auf. Es ließ ihm nachts aber keine Ruhe, weil er sich überlegte, dass viele Menschen täglich starben, obwohl er einen wirksamen Impfstoff besaß.
Er befragte seine Eltern nach den Freunden von Hans, weil er glaubte, dass diese ihm glauben würden. Seine Eltern erwähnten Volker. Benjamin kannte ihn bereits, weil er immer auf den Geburtstagspartys von Hans war. Er wusste, dass er ebenfalls Wissenschaftler war. Benjamin probierte ihn zu kontaktieren. Da er noch kein Handy hatte, probierte er mit dem Laptop seiner Mutter eine E-Mail zu schreiben. Der Laptop war aber mit einem Passwort gesichert. Benjamin beschloss, zu seinem Opa zu laufen um in seinem Adressbuch nach der Adresse von Volker zu suchen. Er packte einen kleinen Rucksack mit Klamotten, dem Impfstoff und dem Schlüssel von Hans Haus. Danach verließ leise die Wohnung. Seine Eltern hatten nichts mitbekommen. Den Weg zu seinem Opa kannte er bereits, denn sein Opa hatte ihn oft zu Fuß nach Hause gebracht. Er wusste nicht, wo er das Adressbuch suchen sollte. Er begann im Wohnzimmer, weil sein Opa dort den meisten Krempel hingelegt hatte. Er suchte gefühlt über eine Stunde, obwohl es bestimmt nur zehn Minuten waren, doch das Buch war nirgendwo zu finden. Er ging die Treppe hoch und suchte an seinem Lieblingsort weiter, dem Labor. Sein Opa hatte ihm immer verboten, in diesem Raum seine Sachen zu erkunden, deswegen fühlte er sich schlecht, den Raum zu durchforsten.
Er fand das Adressbuch in einer Schreibtischschublade unter einem Stapel Papier. Er suchte nach Volkers Adresse. Er hatte Glück, denn Hans hatte sein Buch nicht sauber geführt, nur wenige Adressen hatte er sich aufgeschrieben. Volkers Adresse war auf einem Klebezettel hinten im Buch notiert. Benjamin nahm sich den Zettel, plünderte den Süßigkeitenschrank in der Küche und verließ das Haus. Mit reichlich Proviant machte er sich auf den Weg zur S-Bahn.
Benjamin wohnte in Wilmersdorf und musste alleine nach Friedrichshagen. Er wollte am Bahnsteig nach dem Weg fragen und mit der Bahn fahren, doch die Bahnen fuhren schon lange nicht mehr, denn es herrschte eine Ausgangssperre. Die Menschen durften nur noch zum Einkaufen nach draußen. Benjamin beschloss zu laufen und sobald er in Friedrichshagen wäre, würde er einfach nach der Schöneicher Straße fragen, in der Volker wohnte. Er begann zu laufen. Nach etwa 30 Minuten Fußweg dachte er, er wäre in Friedrichshagen. Er lief zu einem Einkaufsladen, denn nur da konnte er sich sicher sein, auf jemanden zu treffen. Er versuchte ein paar Menschen anzusprechen, aber die wollten Abstand halten und liefen weiter. Bis er schließlich eine Frau ansprach, die ihm zuhörte. Die Frau hieß Hannelore, aber Benjamin sollte sie Hanne nennen. Als Benjamin sie fragte, ob er in Friedrichshagen sei, erläuterte sie, dass Friedrichshagen weit entfernt sei, wenn er zu Fuß laufe. Denn Benjamin befand sich mitten in Schöneberg. Hanne wollte die Eltern anrufen, doch Benjamin erklärte, warum er alleine unterwegs war. Hanne dachte sich, wenn es auch nur eine winzige Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Impfstoff wirksam gegen das Virus ist, ist es das wert, ihn auf seine Wirksamkeit testen zu lassen. Sie beschloss Benjamin zu helfen und bot ihm an, ihn mit zu sich zu nehmen. Benjamin sah keine Chance mehr, alleine zu Volker zu kommen und willigte ein, mit Hanne zu gehen.
Hanne machte für sie Abendbrot und versprach, Benjamin morgen nach Friedrichshagen zu fahren. Benjamin durfte auf ihrer Wohnzimmercouch schlafen. Er war sehr dankbar, Hanne getroffen zu haben, denn es hätte auch anders für ihn laufen können. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, brachen sie auf. Sie fuhren mit dem alten Auto von Hanne zu Volker. Die Fahrt dauerte 35 Minuten, in denen sich die beiden besser kennenlernen konnten. Benjamin mochte Hanne sehr, sie erinnerte ihn an seinen Opa, denn sie hatte dieselbe Spontanität und energiegeladene Art wie er.
Als sie angekommen waren, klingelten sie an der Haustür. Volker sprach über die Gegensprechanlage zu ihnen. Er teilte ihnen mit, dass sie leider nicht reinkommen durften, weil er das Virus habe. Benjamin wollte nicht aufgeben. Er legte den Impfstoff vor die Tür. Hanne und Benjamin setzten sich ins Auto und Volker nahm den Impfstoff an sich. Er nahm ihn mit in seine Wohnung und machte ein paar Tests und die Ergebnisse sandte er an einen Virologen.
Benjamin klingelte nochmals an der Tür und Volker sprach wieder über die Gegensprechanlage zu ihm. Volker sagte ihm, dass der Impfstoff mit ein paar Änderungen erstaunlicherweise funktionieren würde, dass das aber noch eine Weile dauern werde. Benjamin stieg total stolz auf seine und Hans’ Arbeit zurück zu Hannelore ins Auto. Hanne fuhr ihn nach Hause, wo er schrecklichen Ärger von seinen Eltern bekam. Sie waren aber in erster Linie froh, ihn wieder zu haben.
Eine Woche später begann die Massenproduktion des Impfstoffes.
Leider verstarb Volker an dem Virus, zwei Tage bevor der Impfstoff hergestellt wurde. Er schrieb in seinen letzten Tagen eine E-Mail an die Presse, in der er erklärte, dass sein bester Freund Hans den Impfstoff entwickelt und sein Enkel ihn nach seinem Tod ganz alleine zu ihm gebracht habe.
(Fenja Wudke)
Vierte Geschichte
Wir sind alle sehr gerührt von der Geschichte. Nach einer kurzen Pause meldet sich eine Frau mit kurzen Haaren, die mir schon gestern aufgefallen ist. Sie meint, sie würde gerne eine Geschichte, die ihre Schwester ihr erzählt hat, mit uns teilen.
Wir schreiben den 25.3.2020. Die Straßen sind so leer, wie nie zuvor. Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich aus dem Fenster sehe. Wie konnte sich diese Pandemie so weit ausbreiten? Wieso konnte dieses Geschehen nicht verhindert werden? Tausende Fragen, von Millionen von Bürgern, jedoch keine Antworten. Seit ca. zwei Wochen liegt über Deutschland, nein nicht nur über Deutschland, sondern auch über Italien, Spanien, Frankreich und vor allem China und inzwischen über der gesamten Welt ein riesiger Schatten. Die Menschheit wurde getroffen von dem Corona-Virus. Wir haben die Infizierten und probieren nun mit aller Kraft gegen das Virus anzutreten.
Meine Familie besteht aus fünf Personen. Ich bin 26 Jahre alt, heiße Malia und bin Mutter von zwei Kindern, von meiner süßen kleinen Alina, die vier Jahre alt ist, und meinem Jungen namens Matteo, welcher elf Jahre alt ist und in die dritte Klasse geht. Mein Mann ist 34 Jahre alt und arbeitet selbständig in der Solarindustrie. Ich arbeite in einem kleinen Krankenhaus in Hamburg als Krankenschwester. Vor drei Tagen haben wir erfahren, dass wegen dem Corona-Virus starke Einschränkungen folgen werden. Als Mutter bin ich einerseits besorgt wegen meinen kleinen Kindern, auch wenn es heißt, dass nur ältere Menschen und Risikogruppen gefährdet sind, aber auch wegen unserer Existenz. Wie werden wir in den nächsten Monaten leben? Werden wir genug Geld zur Verfügung haben? Ich meine, große Kredite haben wir nicht, aber auch wenig Rücklagen. Und wenn mein Mann nicht mehr arbeitet, werden wir früher oder später in große Schwierigkeiten geraten, denn mein Gehalt allein wird unsere Familie nicht über Wasser halten können. Ich bin verzweifelt und habe große Ängste, aber trotz alledem weiß ich, dass ich mich in den nächsten Monaten zusammenreißen muss und für mich und meine Familie kämpfen werde, wie nie zuvor. In was für Schwierigkeiten ich geraten werde, ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich bewusst.
Als mein Mann heute Morgen einen Anruf bekam, dachte ich für einen kurzen Augenblick, alles bricht zusammen. Sein Chef teilte ihm mit, dass er wegen des Virus in den nächsten vier Wochen voraussichtlich keine Arbeiter beschäftigen darf. Zeitgleich bekam ich eine E-Mail von Alinas Kita, worin es hieß, dass der Betrieb leider eingestellt werden muss, wegen der derzeitige Situation und der starken Ansteckungsgefahr unter den jüngeren Kindern, welche untereinander viel Körperkontakt haben. Ich sitze nun am Fenster, an meinen Küchentisch, und blicke hinaus. Draußen sehe ich nicht viel, ein paar Autos, die umherfahren, ein paar Fahrradfahrer, aber das war's auch schon. Ich merke, mit was für großen Schritten das Virus, auch Covid-19 genannt, auf uns zukommt. Einerseits bin ich froh, morgen um zehn Uhr wieder arbeiten zu müssen, bis spät am Abend, gegen 19 Uhr. Andererseits kann ich mir auch schon vorstellen, was für Arbeit dazukommen wird, mit den vielen Erkrankten. Ich bete jeden Tag, dass ich mich nicht anstecke, denn auch ich habe eine Familie zu Hause.
Heute ist der 28.03.2020. Seit drei Tagen arbeite ich nun wieder als Krankenschwester und merke auch im Krankenhaus, wie sich die Lage zuspitzt. Auf unserer Krankenstation liegen nun acht erkrankte Menschen, davon drei auf der Intensivstation. Aktuell sind der Gesundheitsbehörde 414 Patienten in Hamburg bekannt, die eine Covid-19-Erkrankung haben. Mir persönlich macht das wenig Angst, da ich denke, dass es nach und nach alle Bundesländer treffen wird. Die Pandemie wird sich auch noch weiterhin stark verbreiten. Immerhin hat man sich zwecks Eindämmung des Virus darauf geeinigt, alle Bars, Diskotheken und gastronomische Einrichtungen vorerst zu schließen. Außerdem müssen Kosmetiksalons, Friseure und Einkaufspassagen ihre Leistungen einstellen. Man solle sich zudem draußen nur mit Menschen aufhalten, mit denen man zusammenwohnt, und das auch nur, um Spazieren oder Einkaufen zu gehen. Ein erleichterndes Gefühl für mich. Wenn man manchmal bei einem Einkaufsladen sieht, wie zig Menschen mit zwei Metern Abstand voneinander entfernt stehen und lange warten, um endlich in den Laden zu kommen, oder abends die Straßen so leer sind, dass man jeden Fahrradfahrer hören kann, fühlt man sich so, als wäre man in einer Zombie-Apokalypse und jederzeit dem Tod ausgesetzt. Als ich gestern Abend nach vielen Unterhaltungen und Krisenbesprechungen im Krankenhaus nach Hause kam, erfuhr ich zudem, dass Matteo nun bis zum 19. April von der Schule befreit ist, was die Schulbehörden festgelegt haben, um das Virus einzudämmen. Ich kann mir vorstellen, dass es für meinen Mann hier zu Hause ebenfalls nicht leicht ist. Wie oft er an seine Grenzen kommen wird, wenn Alina schreit oder Matteo wie wild durch die Wohnung saust. Aber auch ich bin fertig. Fertig von den Dutzenden Fällen bei der Arbeit, die mich mitnehmen und weswegen ich seit Nächten wach liege und nicht schlafen kann. Fertig, da ich Angst habe, durch meinen Beruf meiner eigenen Familie zu schaden. Wie man merkt, bin ich ziemlich durch den Wind, und ich bin erleichtert, die nächsten zwei Tage frei zu haben, um mich ein wenig zu erholen und mich auf die kommende Zeit vorzubereiten.
Als ich mich nach meinen freien Tagen auf dem Weg zur Arbeit befinde, gehen mir viele Sachen durch den Kopf. Ich habe gehört, dass uns langsam die Beatmungsmaschinen ausgehen und andere wichtige Schutzutensilien. Wie sollen wir ohne diese Gegenstände arbeiten? Wie sollen wir uns schützen? Mein Handy piepst. Eine Nachricht meiner Kollegin: ,,Hey Malia, seit der dritten Krisensitzung gestern haben wir feste Patienten zugeteilt bekommen. Wir haben fünf neue Fälle, die du übernehmen wirst: Station sechs, drei Kinder und zwei Erwachsene, heute Morgen eingetroffen und auch an Covid-19 erkrankt. Gib dein Bestes! Kuss, Janette.“ Ich schlucke. Drei Kinder und zwei Erwachsene? Wow, das muss ich erstmal verkraften. Ich hoffe, dass es sich nicht um schwere Fälle handelt und wir noch ausreichend Beatmungsmaschinen haben, denn ich weiß, auch andere Krankenhäuser haben einen starken Notstand. Als ich nach einer Weile ankomme, sehe ich die Notaufnahme, komplett überlaufen, wie ich mir denken kann. Unzählige Verdachtsfälle, kein Wunder, wir machen hier über 200 Abstriche am Tag. Es ist Grippe- und Infektionszeit, wir sind also auch gut gefüllt, selbst ohne das Corona-Virus. Ende letzter Woche hieß es noch, wir sollen uns keine Sorgen machen, es sei genug Schutzkleidung da, aber alleine heute wurden die Bestände fast komplett aufgebraucht.
Als ich bei meinen Patienten eintreffe, fällt es mir unfassbar schwer. Vor mir liegen zwei kleine Kinder, ca. acht Jahre alt, beide erkrankt an Corona. Ich kümmere mich um sie, probiere ihnen Mut zuzusprechen, denn auch sie sehen, mit welchen Zuständen es hier vor sich geht. Als ich später hochgehe, auf die Intensivstation, sehe ich einen anderen kleinen Jungen, ebenfalls ca. neun Jahre alt. Er kommt aus Spanien, er war dort mit seinen Eltern im Urlaub. Er hängt an einer Beatmungsmaschine und ist ins künstliche Koma versetzt worden. Vor der Tür steht seine Mutter und als ich aus seinem Zimmer hinauskomme, läuft sie auf mich zu. Es fällt mir unfassbar schwer, sie aufzubauen, da ich weiß, dass das vorerkrankte Kind schlechte Chancen haben wird und ich ihr gegenüber sachlich und ehrlich bleiben muss. Es zerreißt mir das Herz. Ich gehe für ein paar Minuten auf die Toilette durchatmen. Solche Zustände, so viel Trauer und so viel Leid und Elend habe ich hier lange nicht erlebt, nein, noch nie. Ich begebe mich wieder zurück auf die Station zu den beiden Erwachsenen, einem Ehepaar, beide um die 30 Jahre alt und ebenfalls an Corona erkrankt. Ich untersuche sie und schließe sie anschließend an die letzten zwei Beatmungsgeräte an, die ich finden kann. Sie sehen schlecht aus, ihre Lippen werden immer blauer und ihre Gesichter immer blasser. Ich untersuche auch ihren Rachen und Lungenbereich und merke, dass sie noch keine allzu starken Schmerzen haben. Als der Tag sich dem Ende zuneigt, bin ich sehr erleichtert. Trotz alledem beschäftigt mich vor allem der kleine Junge, bis tief in die Nacht hinein. Wird er es überleben? Ich weiß, wie schlecht es um ihn steht, und meine Gedanken fressen mich bald auf. Werden die anderen beiden Kinder gesund bleiben? Es fühlt sich an, als ob ich darüber entscheiden werde. Ich weiß, dass es nicht so ist, doch trotzdem ist es ein schreckliches Gefühl.
Als ich am nächsten Morgen wieder zur Arbeit aufbreche, habe ich ein mulmiges Gefühl. Ich hoffe, dass wir keine schlimmen Fälle mehr reinbekommen werden. Wir sind nicht mehr in der Lage, Betroffene zu betreuen, denn wir haben keine weiteren Beatmungsmaschinen. Ich hoffe, die beiden kleinen Kinder heute nach der Kontrolle aus dem Krankenhaus entlassen zu können. Schon erschöpft von meinen Gedanken, komme ich im Krankenhaus an und mache mich fertig für meine Schicht. Als ich in das Zimmer der Erwachsenen gehe, sehe ich, dass sie deutliche Fortschritte gemacht haben. Ich denke, sie werden heute Abend entlassen werden können. Ein Fortschritt, immerhin. Ich mache mich auf den Weg zur Intensivstation und als ich sein Zimmer betrete, sehe ich seine Mutter, unter Tränen, sie weint. Ich ahne, was passiert ist, und ich merke, wie ich nach und nach immer schwerer nach Luft schnappe. Er hat es nicht geschafft, er ist gestorben. Ich frage, mich wo die Gerechtigkeit bleibt, ich meine: so ein kleiner Junge… Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich, bis dieses Virus um die Ecke kommt und nach und nach Familien zerreißt. Ich fühle mit der Mutter, sie tut mir unfassbar leid. Ich will es nicht realisieren, doch ich weiß, ich muss weiterhin stark bleiben. Ich kümmere mich noch um das Nötigste und begebe mich zu den anderen zwei kleinen Kindern.
Als ich eintrete, sehe ich, dass das kleine Mädchen zittert und schwer Luft kriegt. Ich bekomme Angst, wo soll ich Beatmungsmaschinen herbekommen? Ich sehe ihr deutlich an, dass sie sofort auf die Intensivstation muss. Ab diesem Zeitpunkt fängt ein Wettlauf gegen die Zeit an. Sofort gebe ich überall im Krankenhaus Bescheid und probiere an eine Beatmungsmaschine zu kommen, vergeblich. Es gibt keine Masken mehr, aber das will ich nicht einsehen, also beschließe ich, mich heute nicht um die zwei Erwachsenen zu kümmern, sondern aktiv nach einer Beatmungsmaschine zu suchen. Ich schätze, ich sollte noch zwei bis drei Stunden Zeit haben, um eine zu finden, bevor es zu spät ist und das kleine Mädchen, Elisa, wie sie die Eltern vorhin nannten, ersticken wird. In aller Panik renne ich umher. Ich suche in jedem Zimmer, ich gehe selbst in die OP-Säle, doch auch dort wird alles benutzt. Ich wünsche mir zu diesem Zeitpunkt nichts sehnlicher, als aus diesem Albtraum aufzuwachen. Ich begebe mich in das Zimmer, zu dem kleinen Mädchen zurück, voller Wut, aber auch Traurigkeit. Mir kommen die Tränen, als ich sehe, wie das Mädchen nach und nach rot anläuft. Ich weiß, ich werde ihre Eltern nun anrufen müssen und ihnen diese schreckliche Nachricht übermitteln. Ich will es nicht, nein. Doch ich weiß, ich muss. Langsam begebe ich mich aus dem Zimmer hinaus, um die Kontaktdaten der Eltern des kleinen Mädchens zu holen. Ich denke, ich war um die 30 Minuten weg, es sollte sich nichts ändern an ihrem Zustand. Als ich jedoch zurückkomme merke ich, was es für ein Fehler war, wegzugehen. Der kleine Junge weint, und ich verstehe sofort. Er bekommt auch keine richtige Luft mehr, er atmet schon ganz schwer. Ich frage mich, wie ich nun diesen zwei kleinen Kindern noch helfen kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn die Luftzufuhr eines Kindes schwerer wird, sie noch um die drei Stunden zu leben haben. Ich muss es hinbekommen, sie am Leben zu erhalten, koste es, was es wolle.
Zuerst rufe ich jedoch die Eltern des kleinen Kindes an. Der Vater fängt sofort an zu weinen, als ich ihm berichte, dass wir nicht mehr genügend Ausrüstung besitzen. Nach längerer Stille sagt er, er werde seine Frau sofort ins Krankenhaus schicken und sich sofort auf die Suche nach einer Beatmungsmaschine für seine Tochter machen. Ich weiß, wie gering seine Chancen sind, aber ich möchte ihm seine letzte Hoffnung nicht nehmen. Ich begebe mich zurück ins Zimmer. Nun sitze ich vor zwei kleinen Kindern und sehe, wie sich ihr Zustand verschlechtert. Ich habe mich noch nie so hilflos und erschöpft gefühlt. Die Zeit vergeht, vier Stunden schon. Ich hoffe, es geschieht ein Wunder und sie halten durch. Ihr Zustand ist im Moment ungefähr gleich schlecht.
Doch dann kommt auf einmal ein Anruf. Hoffnungsvoll sehe ich auf mein Handy. Es ist Dr. Mathias Schröpt, Chefarzt der Station fünf. Er sagt, ich solle mich zur Intensivstation begeben, er hätte eine Maske für mich. Mir kommen die Tränen und ich bin unfassbar erleichtert. Ich lege auf und möchte mich auf den Weg machen. Doch dann schießen mir meine Gedanken wie spitze Pfeile durch den Kopf: Wem gebe ich die Maske? Beide Kinder sind in lebensbedrohlicher Lage, wen soll ich retten? Mir wird schlecht. Ich dachte, die Beatmungsmaschine sei meine Erlösung, aber nein. Wegen ihr werde ich eine Entscheidung treffen müssen, die mich mein Leben lang quälen wird, wie keine Frage jemals wieder in meinen Leben. Welches der beiden kleinen Kinder, die mich unter Tränen ansehen, werde ich töten müssen? Ich bin entsetzt und irritiert. Was soll ich nun tun? Mir kommen die Tränen, ich kann nicht mehr denken. Ich merke, wie mir schwindelig wird und alles anfängt sich zu drehen. Auf einmal spüre ich kalte Hände, die mich halten. Ich setze mich auf, und schaue verwirrt umher. Ich erkenne Dr. Schröpt. Ich drehe mich um, um sofort nach den kleinen Kindern zu sehen. Ich sehe, dass beide ein Beatmungsgerät aufhaben. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Ich erfahre, dass der Vater vor etwa zehn Minuten reinstürmte, da er es schaffte, seiner Tochter eine Beatmungsmaschine zu besorgen. Als er sah, dass ich ohnmächtig wurde, holte er sofort Dr. Schröpt, welcher sich schon auf dem Weg befand, da er angefangen hatte, sich zu wundern, dass ich die Beatmungsmaschine nicht abholen kam. Wie ich erfuhr, setzte er den beiden Kindern die Beatmungsmaschinen in der letzten Minute auf. Ich fing an zu weinen, doch diesmal aus Freude. Trotz kompletter Verzweiflung und Angst habe ich es mit fremder Hilfe geschafft. Ich bin unfassbar erleichtert. Doch ich weiß, Morgen geht der Albtraum wieder los, denn diese Krise ist noch nicht überwunden.
(Sophia Lisa Grub)
Fünfte Geschichte
Wir alle haben unglaublichen Respekt für ihre Schwester, vor allem in dieser schwierigen Zeit würdigt man die Arbeit von Ärzten und Krankenschwestern umso mehr. Wir sind gerade anscheinend vollkommen in der Stimmungfür Corona-Virus-Geschichten, deshalb erzählt sogleich ein Jugendlicher eine Geschichte, die er von einer Freundin gehört hat.
Die Melodie meines Lieblingssongs für traurige Momente war das Letzte, was ich hörte, bevor eine wutentbrannte, ca. 65-jährige Frau mich fast umrannte und dabei störte, sorgfältig die Snacks für die nächsten Tage auszusuchen und mich dabei selbst zu bemitleiden, weil ich trotz des anbrechenden Frühlings die nächsten drei Wochen niemanden treffen durfte. Schuld war genau das, was die Frau mit den blond gefärbten Haaren wahrscheinlich dazu veranlasst hatte, sieben Packungen Klopapier zu kaufen; Corona, Covid-19 oder von den ganz Genervten, zu denen ich definitiv gehörte, denn allein schon bei dem Namen bekam ich schlechte Laune, auch gerne C. genannt. Sie gehörte wohl zu der Fraktion, die die Apokalypse vermutete oder Diarrhö bei dem Thema bekam, denn anders war so viel Klopapier definitiv nicht zu rechtfertigen. Es kotzte mich so an, dass die Leute alle nicht verstanden, dass die Supermärkte sicher nicht schließen würden, da nicht die Menschheit ausgerottet werden sollte, sondern lediglich die Verbreitung einer unberechenbaren Krankheit gestoppt werden musste. Die Frau hatte mittlerweile schon einen ganz roten Kopf, weil sie anscheinend mit jemandem stritt, der hinter mir stand. Das konnte ich jedoch nur vermuten, da immer noch irgendein trauriger Song über gebrochene Herzen lautstark in mein Ohr grölte.
Ich nahm die Kopfhörer raus und wollte der Frau gerade sagen, sie solle sich doch bitte entschuldigen, als mir die Worte im Hals stecken blieben, weil ich mitbekam, dass sie mit ihrem Mann stritt. Die Person hinter mir, die ich mittlerweile als einen Mitte 60 wirkenden Mann identifizieren konnte, sagte gerade: „Bettina, ich habe dir doch gesagt, wir brauchen kein Klopapier und schon gar nicht sieben Packungen. Stell es bitte zurück und nimm maximal eine mit, wenn dich das glücklich macht, aber keine sieben. Andere Leute wollen auch noch etwas. Und schau mal, du hast die junge Dame angerempelt. Entschuldigen Sie bitte meine Frau ist etwas durch den Wind seit… Naja, Sie wissen schon, das Virus.“
Den letzten Satz hatte er, den ich nun definitiv zu meinem persönlichen Helden des Tages ernannte, mir gewidmet, doch bevor ich etwas erwidern konnte, schaltete sich Bettina wieder ein, die mittlerweile auch am Hals rote Flecken hatte. „Peter, du weißt doch gar nicht was noch alles passieren wird! Wir sind immerhin schon fast in der Risikogruppe und überhaupt, Klopapier kann man ja nie genug haben, wer weiß, wie lange wir noch raus dürfen.“ Diese Aussage war in so vielen Hinsichten nicht korrekt und ziemlich unüberlegt, dass sich meine Laune noch um einige Stockwerke weiter in den Keller bewegte.
Nach diesen schrillen Worten von Bettina seufzte Peter und wollte gerade noch einmal beruhigend auf seine Frau einreden, als sich ein weiterer Herr in die Runde mischte. Er war ungefähr Mitte 40 und sah aus wie der klassische Familienvater. Er wandte sich an Bettina und sagte: „Gute Frau, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahetreten, aber niemand kann so viel Klopapier gebrauchen. Außerdem finde ich es äußerst rücksichtslos, einfach alle der sieben letzten Packungen zu nehmen. Was denken Sie sich denn?“ Während er das sagte, wurde seine Miene immer finsterer und seine Stimme immer aggressiver. Er hatte jedoch trotzdem einen leicht sarkastischen Unterton. Bevor Peter oder Bettina etwas sagen konnten, schnappte der Mann sich zwei der sieben Packungen aus dem Einkaufswagen und rannte in Richtung Kasse. Schade eigentlich. Ich wollte mich gerade geistig mit ihm verbünden und als einen der zivilisierteren Menschen einstufen. Tja, falsch gedacht.
Bettina stand der Mund offen und auch ich war geschockt über diese Dreistigkeit. Nur Peter war immer noch ziemlich ruhig und lächelte sogar etwas triumphierend, während er sagte: „Tja, das hast du jetzt davon. So, jetzt leg bitte die anderen überflüssigen vier Packungen weg, wir brauchen noch Eier.“ Bettina stand immer noch der Mund offen und sie sah ein bisschen aus wie ein Karpfen, als sie jetzt nach Worten rang und immer wieder den Mund auf und zu klappte. Am Ende entschied sie sich offensichtlich fürs Schweigen, klappte den Mund endgültig zu, legte das Klopapier wieder ins Regal und folgte ihrem Mann, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich sah wahrscheinlich nicht viel weniger aus wie ein Fisch auf dem Trockenen, klappte ebenfalls den Mund zu und machte statt meiner traurigen Playlist jetzt Heavy Metall an, nachdem ich mir die Kopfhörer wieder in die Ohren gesteckt hatte.
In meinem Korb lagen nun ausreichend Chips, Schokolade und Gummibärchen für die nächsten Tage und außerdem die vergessene Milchflasche, wegen der mich meine Mutter überhaupt erst zum Supermarkt geschickt hatte. Böser Fehler, ihr diesen Gefallen zu tun. Nicht zu viel, um auszusehen als würde ich hamstern, aber auch nicht zu wenig, damit ich nicht am nächsten Tag schon wieder losrennen musste. Dank der ziemlich aggressiven Musik in meinen Ohren hörte ich nicht, warum genau sich die beiden Frauen vor mir an der Kasse stritten, aber ich schätzte Mal, es ging um zu viel oder zu wenig Abstand, und selbst die Frau hinter mir, die eine ganze Palette Mehl aufs Kassenband legte, konnte mich nicht mehr schocken. Das gesamte Dorf befand sich im Ausnahmezustand: Die eine Hälfte drehte komplett durch und die andere Hälfte wurde wahnsinnig, weil sie dauernd mit durchdrehenden Menschen konfrontiert wurden. Was für ein Einkauf. Was für ein Tag. Was für eine Situation.
Ich entschied mich, noch nicht direkt nach Hause zu gehen, denn auf Grund dessen, dass meine Familie und ich bereits seit sieben Tagen alle aufeinander hockten, konnte ich mir in meinem momentanen Zustand nicht auch noch meine nervigen kleinen Brüder antun, die den gesamten Tag mit Laserschwertern kämpften und rumschrien. Ich hatte sie allerdings selten so laut schreien hören, wie als meine Mutter verkündet hatte, dass wir die nächsten Wochen niemanden treffen durften. Und die beiden schreien viel, oft und sehr laut. Aber ich konnte sie ausnahmsweise mal verstehen, denn nach dieser Nachricht war mir auch zum Schreien zumute gewesen, denn nicht einmal ich konnte mich dem widersetzen, obwohl ich bereits 19 war. Aber dieses Verbot gilt wohl momentan für jede Altersgruppe.
Als ich so gedankenverloren durch die Straßen des Dorfes ging und regelmäßig entgegenkommenden Spaziergängern auswich, damit der Abstand von zwei Metern eingehalten wurde, kam ich am örtlichen Krankenhaus vorbei und wollte fast vor Freude in die Luft springen, als ich den roten Lockenschopf meiner besten Freundin zwischen den ganzen Pflegern und Pflegerinnen erkannte, die offensichtlich gerade mal fünf Minuten Pause hatten. Ich überlegte kurz zu ihr zu gehen und sie einfach zu überraschen, entscheid mich aber dafür, sie zu rufen, man wusste immerhin nie, wie nah Krankenschwestern an andere Leute als die Patienten herandurften und ich wollte ihr auf keinen Fall Ärger machen, denn sie war ja noch in der Ausbildung.
„Mia! Hey, hier bin ich“, rief ich und glücklicherweise hatte sie mich schon gesehen und kam zu mir. Sie blieb zwei Meter vor mir stehen und strahlte mich an. „Hey, was machst du denn hier, ich dachte, du steckst zuhause in selbst verordneter Quarantäne mit deiner Familie fest“, sagte sie und ich erwiderte zerknirscht: „ Ja, tue ich auch, aber ich sollte Einkaufen gehen und nachdem die sich im Supermarkt alle die Köpfe eingeschlagen haben, brauchte ich kurz frische Luft und ein bisschen Ruhe von den zwei Quälgeistern!“ „Ach komm, so schlimm sind deine Brüder doch gar nicht. Ist es echt so krass im Supermarkt? Ich war seit zwei Wochen nicht mehr einkaufen, ich muss mich auf meine Eltern verlassen. Wir haben hier gerade so viel zu tun, dass ich froh bin, wenn ich überhaupt zum Essen komme“, sagte sie und ich sah die Schatten unter ihren Augen, die von den ganzen Nacht- und Frühschichten kamen. „Es ist ein Albtraum, aber wahrscheinlich nichts gegen das, was ihr hier so erlebt. Wir hätten doch direkt zusammenziehen sollen, nach der Schule, dann wäre mein Leben echt um Einiges entspannter“, antwortete ich. Wir wollten eigentlich nach unserem Abitur in eine gemeinsame WG ziehen, aber da ich mich nicht hatte entscheiden können, was ich studieren wollte, mussten wir das auf später verschieben, was ich gerade allerdings ziemlich bereute.
„Die Leute kommen reihenweise panisch in die Notaufnahme und wollen getestet werden und die ganzen Nachbardörfer schicken ihre Patienten zu uns, weil wir noch freie Intensivbetten hatten“, sagte sie und rollte mit den Augen. „Aber das stimmt, dann könntest du immer schön für mich kochen und wir könnten Hamsterkauf-Geschichten aus dem Supermarkt gegen panische Patienten-Geschichten aus dem Krankenhaus tauschen“, fügte sie lachend hinzu. Ich wusste, wie sehr sie es hasste hysterische Patienten zu behandeln. „Mia, kommst du, wir müssen hoch, Dr. Schuhmann hat mich angepiept“, rief eine männliche Stimme, die offensichtlich einem von Mias Kollegen gehörte. Mia schaute mich entschuldigend an und ich sagte: „Alles gut, geh schon. Wir telefonieren später.“ Ich lachte, warf ihr eine Kusshand zu und ging in Richtung zuhause. Meine Laune war wieder deutlich besser und ich freute mich sogar ein bisschen, als meine Mutter mir eine Nachricht schrieb, in der stand, ich solle doch bitte kommen, sie wolle jetzt kochen und brauche die Milch. Ich mochte es mit ihr in der Küche zu sitzen und zu kochen, also lief ich ohne Umwege nach Hause. Immerhin konnte ich ja nicht wissen, dass mich dort ein noch viel größerer Albtraum erwartete, der meine gute Laune gleich wieder zunichtemachen würde.
(Carla Olbrück)
Sechste Geschichte
Nach dieser Geschichte wirken einige ziemlich erleichtert, dass sie diesen Wahnsinn bei sich zuhause nicht mitmachen müssen. „Es ist echt komisch, dass wir hier von alldem kaum etwas mitbekommen“, bemerkt einer. Dieser Bemerkung wird von vielen zugestimmt. Derselbe Mann meldet sich zu Wort, um jetzt eine Geschichte über die Pest zu erzählen.
Wir schreiben das Jahr 1346, das Jahr, in dem die Pest begann. In dieser Geschichte geht es um den Vater und Marktverkäufer Leonardo Bianchi und um seine Mitmenschen. Im Jahr 1346 kommt die Pest in Italien langsam ins Rollen, allerdings gibt es bis auf ein paar tote Ratten und wenige infizierte Personen keine Indizien für eine Pandemie. Deshalb nehmen viele Menschen die Pest nicht ernst und denken es sei erneut eine kleine Infektionswelle, die schnell wieder vergessen ist. Dem wird bekannterweise nicht so sein, denn am Ende kann die Pest 25 Millionen Tote verzeichnen, was ein Drittel der damaligen Bevölkerung ausmachte. Es war ein normaler Samstag in Genua, Leonardo war wie jeden Samstag auf dem Weg zum Markt, um selbst angebautes Gemüse aus seinem Garten zu verkaufen und um einige Sachen für seine Familie zu besorgen. Er baute also seinen Stand auf und sogleich kamen die ersten Kunden zu ihm, darunter auch sein Freund Giorgo. „Guten Tag Giorgo“ grüßte Leonardo. „Guten Tag Leonardo, wie geht es dir?“ „Gut und dir?“ „Mir ebenfalls, mich wundert es allerdings, dass hier noch so viele Leute sind.“ „Wieso das denn“, entgegnete Leonardo. „Hast du noch nichts von dieser neuen Krankheit gehört? Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wird ja doch nur wieder eine kleine Krankheitswelle.“ „Nein, ich habe noch nichts über eine neue Krankheit gehört, wie heißt sie denn und wie wird sie übertragen?“ „Sie heißt Pest, soll es schon einmal hier gegeben haben aber man ist sich nicht sicher, wie sie übertragen wird, und man hat angeblich nur ein wenig Fieber und Schüttelfrost“. „Ach so, aber war es das letzte Mal nicht viel schlimmer, sollte man sich keine Sorgen machen?“ „Ja letztes Mal war es dramatisch, allerdings gibt es bisher nur ein paar tote Ratten, wenige Kranke im Süden und die Symptome sind auch nicht schlimm.“ „Gut zu hören, aber sollte man nicht trotzdem eher vorsichtig sein?“ „Nein, bestimmt legt sich alles schnell wieder.“
Giorgo erledigte seine Einkäufe und der nächste Kunde kam. „Guten Tag, ich habe Ihrem Gespräch zugehört und möchte die Aussagen des netten Herren dementieren. Ich habe Verwandte in Neapel und sie haben mir vor Kurzem einen Brief geschrieben, in dem sie mir die Lage beschrieben haben. Sie schrieben mir, dass die Stadttore überall geschlossen worden sind, sich die Krankheit schnell verbreitet und schon mehrere Personen an der Pest gestorben sind. Man sollte umgehend die Stadttore schließen und sich verbarrikadieren. Ich habe bereits versucht, die Leute zu überzeugen und habe im Rathaus versucht durchzusetzen, die Stadttore schließen zu lassen, aber man wollte mich nicht anhören und hat mich ausgelacht. Sie meinten, dass ich verrückt sei, dass die Pest sich nie im Leben so schnell ausbreiten könne und selbst wenn es passieren würde, würde niemand sterben. Ich sage Ihnen, es werden viele Menschen sterben, wenn wir bald nicht etwas unternehmen“, sprach der Mann. Der Mann ging schweigend davon. Der Tag verging, Leonardo verkaufte sein Gemüse und erledigte seine Einkäufe. Er konnte allerdings an nichts Anderes denken als den Mann, der eine Epidemie vorausgesagt hatte. Er ging am Abend nach Hause, erzählte seiner Familie davon und beschloss Vorräte zu kaufen, für den Fall, dass der Mann Recht behalten sollte.
Ein Jahr später ist es 1347 und die Pest ist bisher bis Konstantinopel, Neapel und Marseilles gekommen. Dort hat sie tausende Menschen das Leben gekostet. Trotzdem wird noch nichts unternommen und keine Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen. Leonardo macht sich mittlerweile große Sorgen und beschließt schließlich ins Rathaus zu gehen und sich beim Bürgermeister zu beschweren, um eine Vielzahl von Toten zu verhindern. Er begibt sich ins Rathaus und darf letztendlich vor dem Bürgermeister sprechen. „Guten Tag Herr Rosso“, spricht Leonardo. „Ich wollte Ihnen raten, jetzt einige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Pest wird sich rasant verbreiten und viele Leben fordern. Wenn wir nicht umgehend etwas unternehmen, werden viele Menschen leiden. Die Pest hat in nicht einmal einem Jahr eine riesige Landfläche erobert, wenn es so weiter geht, müssen wir in einem Jahr auch unter der Pest leiden“, spricht Leonardo. „Herr Bianchi, Sie sagen es doch, wir haben noch Zeit und diese müssen wir nutzen, um weiterhin Geschäfte mit Konstantinopel abzuschließen, sonst würden wir große finanzielle Probleme bekommen und das wollen wir hier nicht riskieren, einen schönen Tag noch.“
Was der Bürgermeister sagte, war auch eigentlich richtig, allerdings war Konstantinopel schon lange von der Pest befallen, tätigte jedoch weiterhin Geschäfte mit vielen Städten. So wurde die Pest noch schneller verbreitet und viele Städte wurden somit überrollt. So kam es auch für Genua. Eine wichtige Handelsstraße führte durch Genua und die Stadt wurde von der Infektionswelle überwältigt. Von Genua aus konnte sich die Pest weiterverbreiten und befiel letztendlich ganz Europa und Vorderasien. Leonardo konnte sich und seine Familie schützen, indem sie soziale Kontakte mieden, Zuhause blieben und Vorräte kauften. Die Stadttore wurden letztendlich geschlossen, was die Pest allerdings nicht daran hindern konnte, ein Drittel der Bevölkerung von Europa auszulöschen. Es gab für Pestkranke damals kein richtiges Heilmittel, nur ein Scheinmedikament, was als Heilmittel verkauft wurde. Deshalb erlagen so viele Leute der Pest.
An einem Sonntag musste Leonardo einkaufen, da der Familie die Vorräte ausgingen. Arbeiten musste zu der Zeit auch noch jeder, also ging er zum Markt. Die Welt hatte sich komplett verändert, auf den Straßen lagen viele tote Menschen und alles war noch viel dreckiger als davor.
Es schien, als würde sich niemand Sorgen um die Pest machen, was Leonardo verwunderte. Er ging zu einem Marktverkäufer und fragte ihn, warum sich denn niemand schützt beziehungsweiße sich große Sorgen macht. Darauf antwortete der Verkäufer: „Die Pest ist eine Bestrafung Gottes und wenn man genug betet, dann wird man entweder geheilt oder gar nicht erst angesteckt.“ „Hat dies denn schon bei jemandem geklappt“, fragte Leonardo misstrauisch. „Na ja, tot sind die Leute noch nicht, aber man sollte Gottes Wort nicht in Frage stellen!“, antwortete der Mann. „Gott kann bewirken, dass man sich besser fühlt, aber er kann sicher keine tödlichen Krankheiten heilen. Den Menschen muss medizinisch geholfen werden!“, sagte Leonardo und ging. Leonardo wusste, dass der Glaube viele Menschen das Leben kosten würde. Leonardo und seine Familie überlebten die Zeit letztendlich. Leonardo, der früh genug für sich und seine Familie gesorgt hatte, erkannte die Situation schnell, handelte klug und verhielt sich solidarisch. Eine Lehre, die wir in der jetzigen Situation gut gebrauchen können.
(Robert Villnow)
Siebte Geschichte
Wir alle finden, es stimmt, dass wir diese Lehre für unsere jetzige Situation gut gebrauchen können. „Deshalb bleiben wir ja auch hier im Hotel!“, sagt Einer und eine Andere sagt: „Und Geschichten erzählen ist auch viel lustiger als ich gedacht hatte.“ Ich freue mich, dass alle Spaß daran haben. Ein alter Mann wirft ein, dass er gerne die nächste Geschichte erzählen wolle, und als kein Widerspruch kommt, fängt die Geschichte an. Seine Geschichte betitelt er mit „Gottesgerechter Zorn“.
So oft ich betrachte, wen Gottes Zorn nun trifft, so bemerke ich mitleidig, dass es äußerlich doch wohl immer die Falschen trifft, die Ärmsten der Ärmsten. Die Seuche über fällt die, die es nicht treffen soll. Dann frage ich mich, woran dies wohl liegen mag, ob Gott sich die Menschen nicht gut genug beschaut. Ihr werdet nun erfahren, welche es trifft. Doch sage ich hiermit, dass es nur jene trifft, die Gottes Rat missachten.
Es wurde geschwelgt und geprasst, als sie ausbrach, Halt machte sie nicht, Gottes Verdruss hält vor niemandem. Nun fiel die nur gerechte Strafe auf den König, ausgerechnet auf ihn, sein Kragen war selbst an diesem Tag, einem Sonntag nicht rein, sein Volk erreichte die Seuche. Als ihn die Nachricht erreichte, dass seine Bürger starben, beschloss er zu fliehen, vor seinem Schicksal, und auch vor seinen Verpflichtungen. Die Frau des Königs blieb mit ihrer Tochter daheim, als es sie befiehl. Sie erkrankten, zunächst die Tochter Credula.
Als die Sonne so prächtig schien, wie man es sich nur erträumen konnte, stand Malum vor dem Palast, vor dem Palast, der so groß war, dass er die prächtig scheinende Sonne schon fast übertrumpfte. Malum war ein armer Schlucker, er verdiente sein Brot zuletzt mit Pferdewetten, sein gepflegtes, nahezu majestätisches Auftreten lies der Vermutung keinen Platz, dass es sich hierbei nicht um einen Adligen handeln könnte. Die Tochter, die sich fühlte als würde ihr die Decke auf den Kopf fallen, auch wenn das Anwesen, welches sie nun alleine mit ihrer Mutter bewohnte, für mehr als ein Dutzend Leute gedacht war, sah ihn durch ihr halbgeöffnetes Fenster, wobei der Wind, der durch dieses strömte, sie trug, bis zur stählernen, mit Gold legierten Eingangspforte, wo er nun stand. Er wusste sein Gegenüber zu führen, er war charmanter und gerissener als die Männer, die sie sonst traf. Er kannte die Königsfamilie wie sich selbst, sie hingegen kannte ihn nicht, wollte ihn nun aber mehr als je einen anderen kennenlernen. Die Mutter, welcher man ansah, dass sie die Krankheit in sich trug, begutachtete genau die neue Bekanntschaft ihrer Tochter, genauer als sie es sonst immer tat, denn sie kannte diese Art von Männern, sie hatte oft mit solchen zutun.
Der Mond strahlte noch nicht hell genug, um sagen zu können, dass es Nacht war, als er sie darauf ansprach, dass sie, wie viele, betroffen wäre, betroffen von der anscheinend unheilbaren Krankheit. Bevor Credula darauf antworten konnte, schritt er ein und sagte, für seine Nächste kenne er ein Mittel, welches heilen könne. Wer oder was seine Nächste sei, ließ er gekonnt aus. Er musste fort, der Himmel dämmerte und sie schwärmte von ihm.
Des Königs Geliebte vergnügte sich im besten Hotel der Stadt, als er vor ihrer Zimmertür stand, einsam ohne seine Familie auf der Flucht. Er wollte sie mitnehmen, sie müsse nicht diese erbärmlichen Menschen dahinvegetieren sehen. Er hatte Träume, die er nie vergessen konnte, von sterbenden Kindern und Frauen, er sprach immer wieder zu sich: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er kannte die Antwort, wusste aber nicht mit ihr zu leben. Mit Meretrix, seiner Geliebten, holte er noch die letzte Kleidung aus seinem Palast. Er ging durch die Speisekammer, in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden, von seiner Frau und Tochter. Nicht sie sahen ihn, er sah sie, er sah seine Tochter, wie sie von Malum verführt wurde, verführt ihn zu lieben. Er führte sich vor Augen, welche Folgen das haben konnte, und so beschloss er, dies zu unterbinden. Die Tochter, erstaunt von der plötzlichen Rückkehr ihres Vaters, stellte ihm Malum vor. Er war ihm durchaus bekannt, ein Schuft, ein Trunkenbold, der nur das Geld in den Augen seiner Tochter sah. So beschloss er, ohne weiteres Nachdenken, ihn töten zu lassen. Credula sträubte sich bei dem Gedanken, dass ihre neue Bekanntschaft dem Tod bald näher als sie selber sein konnte. Sie begehrte gegen sein Schicksal auf. Zu spät, er war bereits inhaftiert, und so stand die gesamte Königsfamilie, samt der Geliebten des Königs, am Tag der Hinrichtung vor seiner, einem Hundezwinger ähnelnden, Zelle, die zwar trist eingerichtet war, aber umso mehr seinem charmanten, gelangweilten, schon fast närrischen Gesicht Ausdruck verleihen zu schien.
Credula, die den Plan ihres Vaters nach wie vor zu vereiteln versucht, sprach freudig zu ihm: „Sei nicht betrübt, ich werde uns retten.“ Malum, dem man nun ansah, dass er nur Augen für die Geliebte des Königs hatte, erwiderte gelangweilt: „Aber sicher.“ Credula vergaß sich und fing an, den König, ihren Vater, wüst zu beschimpfen, dass nur weil sie, einmal im Leben einen Mann getroffen habe, den sie wirklich liebe, dies heiße nicht, dass dieser sofort von ihrem eigenen Vater getötet werden könne. Nach abermaligem Diskutieren und Einwirken, sowohl seitens seiner Frau, als auch seiner Geliebten, ließ er sich überreden, den Kopf des Malums nicht rollen zu lassen.
Folgend stand der Hochzeit der Tochter des Königs und dem fast geköpften Malum nichts mehr im Wege. Prunkvoll sollte sie sein, so prunkvoll, dass selbst der Adel vor Neid erblassen würde, und so war es letztendlich auch. Im Palast war prächtige Stimmung, während auf den Straßen die Menschen wie Fliegen starben. Die Tochter, der es Tag für Tag schlechter ging, war noch nie glücklicher als mit dem Mann ihrer Träume. Die Festzelte waren noch nicht abgebaut und schon begann der nächste Morgen. Credula und der König schliefen noch, sie war in den Armen von Malum eingeschlafen, er in den von Meretrix. Jedoch als sie erwachten, gab es von beiden keine Spur. Die arglose Tochter suchte noch, als der König bereits wusste, was geschehen war. Meretrix und Malum waren nicht verschwunden, sie waren geflohen, den Augen des sonst so strengen Königs entkommen, mit dem Geld des Königshauses. Vermutlich trieben sie nun auf ihrem Schiff in Richtung Westen. Credula, die gesundheitlich ihren tiefsten Punkt erreichte, glaubte es nicht. Sie wollte nicht wahrhaben, dass ihr erster und letzter Mann sie mit der Hure ihres Vaters hintergangen hatte.
Der König, der nun in die Gemächer seiner Ehefrau zurückkam, die ihn, so sehr sie ihn auch hasste, mit einem gezwungenem Lächeln auf den Lippen empfing, war die Erkrankung seiner Familie und seiner Bürger gleichgültig, die ihn, der glanzvoll herumalberte und feierte, als ihre letzte Hoffnung an sahen. Er hatte einst ein weltbekanntes Buch gelesen, aus diesem wusste er: „Du brauchst dich nicht zu fürchten, vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet. Ob tausend dir zur Seite fallen, zehntausend zu deiner Rechten: an dich kommt’s nicht heran; nein, lediglich mit eignen Augen wirst du’s schauen und zusehen, wie den Frevlern vergolten wird.“ Falsch verstanden hatte er diese Worte und am Ende lebte nur noch er, der König, der zusehen musste, wie ihm vergolten ward.
(Maximilian Noack)
Achte Geschichte
Nach dieser Geschichte meldet sich eine Frau um die 25 Jahre zu Wort: „Mir fällt noch eine Geschichte ein, die ich in den sozialen Medien zum Thema Corona-Virus gelesen habe.“
21. März 2030: Vieles hat sich verändert und obwohl es niemand geglaubt hatte, hat sich Vieles zum Guten gewendet. Das Jahr 2020 wird in den Geschichtsbüchern zwar immer für schlimme Ereignisse stehen, aber auch für Hoffnung, neue Möglichkeiten und Zukunft.
21. März 2020: Ich schalte den Fernseher ein. In den Nachrichten gibt es nur noch Berichte über das Corona-Virus und stündlich werden die Zahlen der Infizierten und Toten aktualisiert. Ich zappe durch mehrere Sender, alle reden sie über die Corona-Pandemie. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber jetzt sehne ich mich nach einer dieser kitschigen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, die ich sonst jeden Sonntagabend mit meiner Oma geschaut habe. Zwar habe ich das bisher immer als ziemlich schrecklich empfunden, aber jetzt käme mir eine derartige Ablenkung, die mich auf andere Gedanken bringt, ganz gelegen. Aber weder läuft gerade eine Schmonzette im Fernsehen, noch kann ich momentan bei meiner Oma sein. Schon vor einer Woche haben meine Eltern mit meiner Oma beschlossen, dass wir uns vorerst nicht mehr gegenseitig besuchen werden. Meine Oma ist zwar noch super fit, aber sie gehört zu der Risikogruppe der älteren Menschen und wir möchten sie daher schützen. Für meine kleine Schwester Ruby und mich war das eine ganz schöne Umstellung, immerhin war sie drei Mal in der Woche bei uns, hat für uns gekocht, mit uns gespielt und Hausaufgaben gemacht. Naja, zumindest hat sie es probiert. Oma denkt immer noch, dass ich ihr kleines Mädchen bin. Die Tatsache, dass ich schon 17 Jahre alt bin und nächstes Jahr mein Abitur mache, übersieht sie gekonnt.
Meine Eltern arbeiten beide in Vollzeit. Meine Mutter arbeitet als Ärztin in der Charité und mein Vater ist Inhaber eines kleinen Cafés, keine 500 Meter von unserem Zuhause entfernt. Während diese ganze Krise dazu geführt hat, dass wir Mama eigentlich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, da sie den ganzen Tag von früh bis spät, fast ohne Pausen, ununterbrochen arbeitet, ist Papa jetzt den ganzen Tag zu Hause. Schweren Herzens musste er sein Café schließen. Das ist für uns ein großes Problem, denn mein Vater weiß nun nicht so recht, wie es weitergehen wird. Möglich, dass er seine Angestellten entlassen muss, denn keiner weiß, wie lange diese Pandemie und damit die Beschränkungen noch andauern werden. So müssen wir jetzt auch besonders auf unser Geld achten, denn ohne den Verdienst von Papa haben wir im Moment ja nur das Gehalt von Mama.
Mein Vater kommt ins Wohnzimmer und reißt mich aus meinen Gedanken. In der Hand hält er triumphierend eine Packung Klopapier, wie ein Sportler einen Pokal. Er grinst über das ganze Gesicht und ist stolz wie Bolle, als er mir erzählt, wie er heute Morgen schon vor Ladenöffnung mit ca. 100 anderen Leuten vor dem Supermarkt gewartet hat, um dann schließlich die vorletzte Packung Klopapier zu ergattern. Er hat wohl eine begeisterte Reaktion von mir erwartet. Als diese nicht kommt, zeigt er mir stolz den blauen Fleck am Arm, den eine ältere Dame ihm verpasst hat. Damit hat es ihn noch mild getroffen, hinter ihm hatten sich dann schließlich sieben Leute um die letzte Klopapierpackung gekloppt. Ich schaue ihn entgeistert an. Was ist nur mit unserer Gesellschaft falsch gelaufen? Aber derartige Erzählungen habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Heute Morgen habe ich sogar gelesen, dass ein Auto aufgebrochen wurde, nur um das auf der Rückbank liegende Klopapier zu entwenden. Also, dass die Leute Nudeln und Mehl hamstern, ist zwar schon fragwürdig, jedoch kann ich das noch einigermaßen nachvollziehen, aber Klopapier, ernsthaft!?
Meine Schwester kommt ins Zimmer und verkündet ganz laut: „Papa, ich habe Huunnngerrr!“ Mein Vater lacht, sagt dann, dass Mama heute erst sehr spät zurückkommt, und geht dann in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Ruby kuschelt sich zu mir auf unser altes, gemütliches Sofa und wir schauen gemeinsam, wie der Moderator im Fernsehen gerade verkündigt, dass heute in Italien zum zweiten Mal über 600 Menschen an einem Tag an dem Corona-Virus gestorben sind. Die Krankenhäuser seien seit Tagen total überfüllt und die Regierung komplett überfordert. Es sind schreckliche Bilder, von Krankenhäusern im Ausnahmezustand, Leichensäcken, leergefegten Straßen und verzweifelnden Menschen. Der Moderator spricht von einer besorgniserregenden Bedrohung in immer mehr Staaten auf der ganzen Welt.
Hätte mir jemand vor nur wenigen Wochen erzählt, dass wegen eines grippeähnlichen Virus fast alle Länder Einreiseverbote für Ausländer verhängen, die Wirtschaft in den betroffenen Ländern zu einem großen Teil zum Erliegen kommt und durch Ausgangsbeschränkungen das öffentliche Leben in den Städten und Gemeinden stillgelegt wird, hätte ich demjenigen den Vogel gezeigt. Ich hätte es wahrscheinlicher gefunden, dass wir alle wegen des Klimawandels sterben, aber eine derartige Bedrohung durch eine Virusinfektion hätte ich mir aufgrund unseres fortschrittlichen Gesundheitswesens kaum vorstellen können. So etwas kenne ich nur aus Geschichtsbüchern, wie zum Beispiel die Pest, die jedoch im 14. Jahrhundert war. Aber obwohl es wahrscheinlich niemand gedacht hätte, ist das nun der Fall. Unsere Generation ist zum ersten Mal mit einem weltweiten Ausnahmezustand konfrontiert. Dabei können wir alle hoffen, dass es eine Ausnahme bleibt. Gerade jetzt stellen sich viele die Frage, wann oder ob das Ganze ein Ende haben wird, und wenn ja, wie es danach weitergehen wird. Im Moment herrscht überall Ungewissheit: Sind die Ausgangssperren und die Kontaktverbote nur eine vorübergehende Beschränkung oder werden sie für unser zukünftiges Leben so etwas wie Alltag sein? Was passiert, wenn sich dieser Ausnahmezustand in einen Normalzustand verwandelt? Selbst wenn das Ganze demnächst ein Ende hat, wird es nie mehr so sein wie zuvor, da bin ich mir ziemlich sicher.
Mein Kopf schwirrt von den ganzen Gedankengängen, die ich in den letzten Tagen immer wieder habe. Die Ungewissheit macht sich in mir breit. Wie sieht meine Zukunft aus, kann ich mein Abitur zum geplanten Zeitpunkt machen, wird es später möglich sein zu reisen, kann mein Papa irgendwann sein Café wieder öffnen? In meiner Brust spüre ich einen schweren Druck und ich bin erleichtert, als mein Papa uns zum Essen ruft und ich meinem Gehirn eine kleine Auszeit geben kann. Abends liege ich in meinem Bett. Ich bin total erschöpft und meine Gedanken kreisen immer noch wie verrückt. Mein Handy vibriert. Es ist eine Nachricht von meiner Mutter. Sie schreibt mir, dass sie heute nicht nach Hause kommen wird. Auf der Arbeit ist super viel los und sie haben gerade einen neuen Patienten reinbekommen, der noch dringend versorgt werden muss. Sie sagt, sie hofft, dass es mir gut geht und ich mir nicht zu viele Gedanken mache. Zuletzt wünscht sie mir noch eine gute Nacht. Ich schaue in den wolkenlosen Himmel über mir und ohne dass ich es zunächst bemerke, laufen mir langsam Tränen über meine Wangen.
10 Jahre später, es ist Abend und ich liege im Bett. Ich bin nun schon 27 Jahre alt. Ich schaue in den Himmel, schaue in die wolkenlose Nacht.
Am Himmel leuchten die Sterne hell und ich bin irgendwie dankbar, dankbar für die Krise, diesen Ausnahmezustand damals während der Corona-Pandemie. Und ich bin damit nicht allein. Wenn man sich an das Jahr 2020 zurückerinnert, sind das zwar nicht unbedingt schöne Dinge, die einem in den Sinn kommen, aber die meisten von uns empfinden eine gewisse Dankbarkeit. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, wir sind ganz sicher nicht dankbar für die vielen Todesopfer, die das Virus gefordert hat, dennoch hat sich die Welt seit der Pandemie verändert und zwar, im Gegensatz zu den Krisen vorheriger Zeiten, sichtlich zum Guten. Die Menschen haben in der Quarantäne viel dazugelernt und haben die Dinge, die für sie zuvor ganz normal und alltäglich waren, angefangen stärker wertzuschätzen. Viele Leute haben ihr Leben entschleunigt und den Fokus wieder auf die für sie und die Gemeinschaft wichtigen Dinge im Leben gerichtet. Übermäßiges Konsumverhalten, Vielfliegerei und Massentourismus haben stark abgenommen. Die Menschen hinterfragen ihr Tun mehr und machen sich Gedanken darüber, warum sie auf dieser Erde sind und wie ein sinnvolles Leben aussehen kann. Die meisten Menschen sind bedachter und liebevoller in ihrem Handeln geworden. Sie sind sich bewusster über dieses Geschenk, leben zu dürfen. Auch die Wirtschaft hat sich verändert. Themen wie Nachhaltigkeit sind in den Vordergrund gerückt, wohingegen schlechte Arbeitsbedingungen nur noch sehr selten sind. Der Klimawandel wurde verlangsamt und die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels bis 2050 ist heute sehr realistisch.
Vieles hat sich verändert und obwohl es niemand geglaubt hat, hat sich Vieles zum Guten gewendet. Das Jahr 2020 wird in den Geschichtsbüchern zwar immer für schlimme Ereignisse stehen, aber auch für Hoffnung, neue Möglichkeiten und Zukunft.
(Helena Schoen)
Neunte Geschichte
„Wow, wir sollten wirklich hoffen, dass dieses Virus die Menschen bedachter und liebevoller macht“, sagt ein Mädchen in meinem Alter. Die Geschichte hat uns alle zum Nachdenken angeregt. Nach ein paar Minuten macht sich eine etwas unbehagliche Stille breit, deshalb fängt eine rothaarige Frau an, eine Geschichte über eine weitere Virusinfektion zu erzählen.
Heute war ich an der Reihe, zu dem kleinen Einkaufsladen unseres Dorfes zu gehen, um die wichtigsten Lebensmittel, die meine Familie und ich brauchten, zu besorgen. Seitdem das ganze Land von einer sehr gefährlichen Virusinfektion befallen ist, steht auch unser Dorf unter Quarantäne. Das heißt, dass hier niemand rein-, geschweige denn rauskommt. Dies ist auch der Grund, weswegen immer nur eine Person aus dem Hausstand raus darf, und daher wechselten wir uns regelmäßig mit dem Einkaufen ab. Bevor ich mich auf den Weg machte, zog ich mich dick an und setzte mir vorsichtshalber einen Mundschutz mit integriertem Filter auf, um einer Infektion zu entkommen. Ich ging zu unserer Haustür, als ich meine Mutter hinter mir noch rufen hörte: „Pass auf dich auf, Schatz, und vergiss bitte nicht, einen neuen Mundschutz aufzusetzen.“ Ich verabschiedete mich und sagte, dass ich mir bereits einen neuen genommen hätte. So öffnete ich die Tür, schloss sie hinter mir und sofort spürte ich, wie die kühle Luft mich umhüllte. Ich atmete tief ein, denn ich war seit Tagen nicht mehr draußen und genoss die frische Luft wie nie zuvor.
Ich lief los und auf meinem Weg zu Tommys Einkaufsladen sah ich erstaunlich viele Menschen, die, mit geknicktem Kopf nach unten, alle mit derselben Geschwindigkeit wie Zombies durch die Straßen liefen. Es dämmerte schon und daher jagten mir die emotionslosen, fahlen und müde wirkenden Gesichter Angst ein. Ein älterer Herr ging gerade an mir vorbei und raunte mir mit rauer und kratziger Stimme zu: „Rette und verschanz dich zuhause, solange du noch kannst.“ Daraufhin hustete er laut und ich ging schnell weiter. Es war weit und breit keine Panik mehr zu spüren, wie noch vor ein paar Wochen, allerdings wusste ich nicht, ob mir dieser Zustand besser gefiel. Vor ein paar Monaten noch hätte ich niemals mit so einer großen Ausbreitung der Krankheit gerechnet, schließlich ist die Viruserkrankung mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie geworden und hat somit auch unser Dorf befallen.
Jetzt kam ich am Friedhof vorbei und mir verschlug es mit einem Mal die Sprache, ich blieb stehen und schlug die Hand vor mein Gesicht. Ich sah einen riesigen Wagen, der mich an einen Film über die Pest im Mittelalter erinnerte, den wir einmal im Geschichtsunterricht geschaut haben und der mich damals schon teilweise verstört hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas selbst einmal sehen würde. Denn der Wagen war nicht das Verstörende, sondern die tausend leblosen Körper, die darauf gestapelt waren und gerade mit weiteren Autos und weiteren Wagen auf den Friedhof einbogen. Ein Leichenwagen also, wie er auch zu Zeiten der Pest benutzt wurde. Ich wusste, dass unser großer Friedhof der einzige in unserer Umgebung war, aber dass so viele Menschen an dem Virus starben und ausgerechnet hier beerdigt werden müssen, war mir vorher nicht bewusst. Ich ging weiter und versuchte, das, was ich gesehen hatte, zu vergessen.
Als ich bei Tommys Einkaufsladen ankam, hörte ich schon von draußen ein lautes Geschrei. Daher beschleunigte ich meine Schritte. Die Tür zum Einkaufsladen öffnete automatisch und ich sah, wie zwei ältere Männer sich um die letzten drei Packungen Toilettenpapier stritten. Zwischen den beiden stand Tommy, der Inhaber des Ladens, der kläglich versuchte, die beiden Streithähne auseinanderzuzerren. Ich eilte sofort hin und schaffte es, mit Tommy die beiden Männer zu trennen und zu beruhigen. Tommy ergriff sofort das Wort und gab ihnen laut zu verstehen, dass sie sich in seinem Laden gefälligst zusammenreißen und nicht egoistisch sein sollen, denn schließlich brauchen auch andere Leute noch Toilettenpapier. Dabei fiel mir auf, dass der eine Herr schon vier Packungen Toilettenpapier in seinem Einkaufswagen liegen hatte und außerdem noch jede Menge Konserven, Nudelpackungen und Mehl. Ein Hamsterkäufer also. Ich hatte mir schon in den letzten Wochen Gedanken zu dem Thema „Hamsterkäufe“ gemacht und verstehe einfach nicht, warum die Menschen so egoistisch sein müssen, den anderen einfach alles vor der Nase wegzukaufen. Die Supermärkte und Einkaufsläden werden sowieso nicht schließen, also warum muss man denn dann den ganzen Laden leerkaufen? Während ich so darüber nachdachte, klärten die beiden Männer und Tommy alles und die beiden Kunden zischten mit ihren Einkaufswagen davon.
Tommy bedankte sich daraufhin bei mir, dass ich ihm geholfen hatte, die beiden Männer zu trennen, und erst jetzt fiel mir auf, wie müde und kaputt Tommy auf mich wirkte. Er hatte tiefe, dunkle Ringe unter den Augen und sein sonst so herzliches Lächeln war nicht mehr zu sehen. Tommy erzählte mir, dass er in den letzten Tagen schlecht geschlafen habe, da die Leute wie verrückt seien und ihn die ganze Situation unheimlich deprimiere. Es sei schließlich nicht der erste Kampf um Lebensmittel in seinem Laden gewesen, bei dem aggressive, Zombie-ähnliche Kreaturen einander fast die Augen auskratzen und er dazwischengehen muss. Außerdem meint er, dass sich seine Kraft so langsam dem Ende zuneigt und er mittlerweile hoffnungslos sei, da er nicht wisse, wie es weitergehen solle. Wir werden eh alle sterben. Das traf mich. Denn erst jetzt, mit den Eindrücken vom Friedhof, wurde mir bewusst, dass bisher niemand versucht hatte, den Menschen zu vermitteln, wie wichtig es jetzt ist, die Hoffnung beizubehalten und nicht aufzugeben.
Alles schlug auf einmal bei mir ein und ich begann lautstark zu reden. Ich sagte Sachen wie, dass die Situation nicht besser davon werde, wenn man so hoffnungslos mit allem umgehe und das ganze Dorf voll von Negativität sei, sodass die Menschen anfangen sich anzufeinden und es sogar bis zu Prügeleien komme. Es bringe schließlich nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn in genau solchen schweren Zeiten sei Solidarität gefragt und wir alle müssen jetzt nun einmal zusammenhalten. Wir müssen zusammen versuchen, gegen die Krankheit zu kämpfen, und dürfen unseren Kampfgeist nicht verlieren. Wir müssen uns alle gegenseitig aufbauen und mit ein wenig Zuversicht, dass diese schwere Zeit bald vorbeigeht, schaffen wir Menschen alles.
Als ich fertig war mit Reden, sah Tommy mich erstaunt und gleichzeitig erschrocken an. Erst jetzt realisierte ich, dass ich einfach drauf los geredet hatte, und mir wurde ganz warm. Tommy fing an zu reden und sagte, dass es endlich jemanden geben müsse, der die Menschen versuchen solle zu beruhigen. Außerdem sollte jemand da sein, der den Menschen klarmacht, wie wichtig Zuversicht, Zusammenhalt und Solidarität in so einer kritischen Zeit seien. Also alles, was ich erwähnt hatte. Nachdem er dies gesagt hatte, schlug er vor, dass ich diejenige sein solle, die den Leuten wieder Hoffnung macht und sie ermutigt. Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten soll und ich konnte es auch gar nicht, da Tommy erneut anfing zu reden und meinte, dass er einen guten Draht zum Bürgermeister unseres Dorfes hätte und ihn sofort anrufen würde. Das tat er dann auch. Ein paar Tage später saßen meine Familie und ich, natürlich noch immer in Quarantäne, zuhause vor dem Fernseher und warteten gespannt darauf, was ich in meiner Rede von gestern zu sagen hatte. Wegen der immer noch andauernden Quarantäne und den Maßnahmen zur Pandemie konnte ich die Rede zur aktuellen Situation nicht öffentlich halten, jedoch wurde sie im Fernsehen ausgestrahlt und angekündigt, sodass jeder in unserem Land sie hoffentlich zu hören bekommen hat. Es ist immer noch verrückt für mich zu wissen, dass ich versucht habe, den Menschen in meinem Land zu vermitteln, was jetzt zu tun sei und wie wir zusammenhalten müssen. Durch die ganzen Eindrücke mit den Zombie-artigen Menschen wurde mir bewusst, wie sehr die Menschen ihren geistigen bzw. mentalen Zustand verändern können, wenn es zu einem Ausnahmezustand kommt.
(Maike Ludwig)
Zehnte Geschichte
Nach dieser Geschichte werden die Ersten langsam etwas unruhig, weil es doch schon etwas später ist. Ich schlage vor, dass wir nach der nächsten Geschichte für heute Schluss machen können, auch weil zehn so eine schöne und runde Zahl sei. Die letzte Geschichte für heute kommt von einem 16-jährigen Jungen. Er nennt sie: „Corona – Ist doch eh alles gelogen!“ und damit fängt er an zu erzählen.
Ich heiße Nikolas und bin 16 Jahre alt. Zurzeit gehe ich in die 11. Klasse des Gymnasiums. Naja, richtig zum Gymnasium gehen kann ich aktuell nicht mehr wirklich. Ihr wisst sicherlich warum: Corona. Meiner Meinung nach ist das alles totaler Blödsinn. Welcher hirnverbrannte Mensch glaubt denn so etwas?! Wie sich herausstellt, ist fast unsere gesamte Gesellschaft hirnverbrannt. Die bleiben alle brav Zuhause. Richtige Systemsklaven sind das. Die verstehen doch gar nicht, was der Staat überhaupt mit uns vorhat! Die wollen doch nur das Bargeld abschaffen und die Pharmaindustrie will mal wieder ihren Profit aus der Angst der Menschen ziehen. Angeblich durchlaufen wir gerade eine Pandemie, aber ich kenne nicht eine Person, die krank ist! Nicht eine! Ich lasse mir so etwas ganz sicher nicht erzählen! Ich mache weiterhin das, was ich will! Ich werde mich mit meinen Freunden treffen, von mir aus auch zu zehnt! Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner Oma deswegen überhaupt nichts passieren wird.
„Nikolas?“ „Ja, Mama?“ „Wo willst du denn schon wieder hin?!“ „Ich treffe mich mit Max und Baran.“ „Sag mal, was soll das?! Schon mal was von Corona gehört?! Du kannst dich doch nicht jeden Tag mit Freunden treffen! Und schon gar nicht, wenn es mehr als ein Freund ist und ihr euch nicht an den Mindestabstand haltet! Hast du schon mal an die Konsequenzen davon gedacht?! Du siehst deine Oma fast jeden Tag, was ist, wenn sie sich durch dich mit Corona infiziert?!“ „Boah, Mama! Ganz ehrlich, nerv’ mich doch nicht! Bis jetzt ist Oma auch noch nichts passiert! Würde es Corona geben, hätten wir alle es schon längst! Das ist alles nur eine große Lüge!“ „Jetzt sag mir bloß nicht, du gehörst auch zu dieser Verschwörungstheoretiker-Truppe!“ „Ja, ja, nennt uns nur weiter so! Nur weil wir keine dummen Systemsklaven sind, die blind dem Staat folgen!“ „Sag mal, hörst du dich selbst überhaupt reden?!“ „Ach, komm. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven! Ich verzieh’ mich jetzt! Ciao!“ Ich knalle die Tür hinter mir zu. Ich höre meine Mutter noch schreien: „Das ist ja nicht zu fassen!“ Aber das ist mir völlig egal. Die kann mich mal!
Ich werde von den lauten Stimmen meiner Eltern aus dem Schlaf gerissen. Was ist denn jetzt schon wieder los?! Kann ich nicht einmal in Ruhe ausschlafen? Ich stehe mürrisch auf und reiße meine Tür auf. „Ey, was soll das?! Ich versuche hier zu schlafen!“ „Halt den Mund, du verantwortungsloser Bengel! Deine Oma ist im Krankenhaus!“ „Was?! Was ist passiert?!“ „Sie hat starke Atemprobleme! Die Ärzte gehen von Corona aus! Habe ich dir nicht gesagt, dass dein verantwortungsloses Verhalten noch Konsequenzen haben wird?!“ „Schieb’ nicht mir die Schuld in die Schuhe! Corona gibt’s nicht! Das ist was Anderes!“ „Jetzt hör auf zu diskutieren! Zieh dich an und wir fahren sofort ins Krankenhaus!“ Im Krankenhaus herrscht großes Chaos. Überall sieht man Ärzte und Krankenpfleger umherrennen. Meine Eltern erkundigen sich an der Rezeption nach meiner Oma. Ihnen wird die Zimmernummer gesagt und wir machen uns auf den Weg dahin. Als wir gerade vor der Tür stehen, tritt ein Arzt heraus. „Guten Tag, Herr Doktor! Ich bin die Tochter Ihrer Patientin. Wie sieht‘s aus?“ „Ihre Mutter ist soweit stabil. Wir gehen, wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, stark von einer Infizierung mit Covid-19 aus. Es steht aber noch nicht sicher fest. In einer Stunde müssten die Ergebnisse bereitliegen.“ „Dürfen wir sie dann sehen?“ „Jetzt noch nicht, sie benötigt noch etwas Ruhe. Bitte nehmen Sie im Wartebereich Platz.“ Was der da redet. Sie würden von einer Infizierung mit Covid-19 ausgehen. Pah, was ein Quatsch! Die werden noch alle sehen, dass ich im Recht bin! Der soll mal gefälligst schnell mit dem Ergebnis machen! Anderthalb Stunden später kommt der Arzt auf uns zugelaufen. Meine Eltern stehen energisch auf. „Und, Herr Doktor?“ „Die Ergebnisse liegen vor. Wir können nun mit Sicherheit sagen, dass es sich bei Ihrer Mutter um eine Infizierung mit dem Virus Covid-19 handelt.“ Die Fäuste meiner Mutter ballen sich zusammen.
(Nual Al-Yousef)
„Wir sollten das alles echt nicht unterschätzen. Auch wenn ich mir die Geschichte in der Form nur ausgedacht habe, gibt es genug Leute, die so verantwortungslos damit umgehen wie die Person in der Geschichte, und wir haben ja gesehen, wie das ausgegangen ist“, fügt er noch hinzu. Danach verabschieden sich alle und gehen auf ihre Zimmer. Ich finde, heute war ein voller Erfolg, und ich freue mich schon auf morgen.