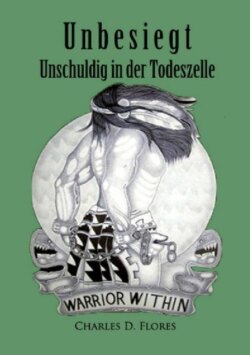Читать книгу Unbesiegt - Unschuldig in der Todeszelle - Charles Don Flores - Страница 6
Kapitel 2 Die Todesfahrt
ОглавлениеAm 2. April 1999, dem Karfreitagmorgen, wurde ich vom Leiter des Gefängnisses und mehreren anderen Wärtern geweckt, die an meine Zelle hämmerten. Ich war erst am vorigen Tag zum Tode verurteilt worden und hätte nicht erwartet, dass sie mich jetzt schon wieder belästigen würden. Als ich meine Augen öffnete und sie um meine Tür versammelt sah, wusste ich nicht, was ich zu erwarten hatte. Die Wärter in den Bezirksgefängnissen waren immer nur im Rudel anzutreffen, alleine waren sie Feiglinge, die jeden Konflikt scheuten. Zu zweit, zu dritt oder zu mehrt hatten sie plötzlich Courage und verwandelten sich in eine Meute von Schakalen. Immer wenn ich vier oder fünf von ihnen sah, schärften sich meine Sinne und ich begann sofort, jede ihrer Bewegungen zu beobachten.
Ihre Stimmen drangen an mein Ohr und ich konzentrierte mich darauf, irgendetwas aufzuschnappen, was mir helfen könnte zu verstehen, was vor sich geht. Wenn du mit Schakalen zu tun hast, weißt du nie, was du erwarten musst.
Ich öffnete meine Augen, sah den Captain an und fragte ihn, was er wolle. Es war nicht normal, dass einer der Supervisors vor der Tür stand. Normalerweise lungern sie nur irgendwo herum, trinken Kaffee und essen Donuts. Der Captain meinte nur: „Steh auf und mach dich fertig! Du musst wieder vor Gericht.“ Ich hörte, was er sagte, und während ich auf meiner Pritsche saß, musste ich dies erst einmal verarbeiten. Irgendetwas schien an dieser Situation nicht in Ordnung zu sein. Ich fühlte mich unbehaglich bei diesen Worten und meine inneren Alarmglocken schrillten. Es gibt nichts Übleres als diese feigen Rassisten, berauscht von der totalen Macht, die sie über ihre „Schützlinge“ ausüben.
Ich saß kurz nur da und sah sie an. Sie beobachteten mich durch das Drahtgeflecht, das jeder Zellentür als Fenster diente. Solange ich in meiner Zelle war, hatte ich einen Vorteil – sie waren draußen. Ein Jahr Erfahrung mit ihrer „Betreuung“ hatte mich gelehrt, jede Begegnung mit ihnen als potentiell tödlich einzustufen. Ich nutzte diese paar Sekunden, um vollständig aufzuwachen, sie gaben meinem Körper und meinem Geist die nötige Zeit, um die Situation vollständig zu erfassen. Dann fragte ich den Captain: „Ich muss wieder vor Gericht?“ Er bejahte nur und forderte mich auf, mich zu beeilen. Schnell wusch ich mein Gesicht und putzte meine Zähne. Ich war dankbar, dass ich diese Grundbedürfnisse erledigen durfte. Es gab Zeiten, wo sie an der Tür erschienen, mich aus der Zelle jagten und mir nicht erlaubten dies zu tun. Heute durfte ich. Sie waren nervös. Ich konnte die Spannung in der Luft spüren. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich heute um einen reibungslosen Ablauf der Dinge bemühten. Im Stillen fragte ich mich warum.
Tags zuvor war ich zum Tode verurteilt worden. Auf irgendeine Weise war ich froh, dass dieser Teil des Albtraums vorüber war. Ich dachte an das Telefongespräch mit meiner Familie am letzten Abend, wie ich sie gebeten hatte, sich keine Sorgen um mich zu machen und dass es mir gut ginge. Ich hatte ihnen erzählt, dass ich vermutlich noch ein paar Wochen mehr im Bundesgefängnis bleiben würde, bevor mich das TDCJ abholen würde, um mich in den Todestrakt zu transportieren. Ich freute mich auf diese Zeit der Einsamkeit. Ich plante, mich mental auf den Trip in die Hölle vorzubereiten, den ich bald beginnen sollte. Ich versicherte mir selbst, dass alles mit ein paar Wochen Vorbereitung gut werden würde. Die Umstellung vom Bundesgefängnis zum Todestrakt wird schon nicht zu schwierig werden.
Weil ich seit drei Monaten täglich vor Gericht war, hatte ich nicht einmal die Zeit gefunden, die nötigsten Dinge am Versorgungswagen einkaufen, der jeden Tag durch den Flur fuhr - leider zu der Zeit, zu der ich normalerweise im Gericht war. Nicht immer kam ich rechtzeitig zurück, um einzukaufen. Falls ich rechtzeitig kam, kaufte ich gleich große Mengen, damit es bis zum nächsten Mal reichte. Ich deckte mich mit einem Vorrat an den nötigsten Dingen ein. Ich hatte stangenweise Seife, einige Tuben Zahnpasta, Shampooflaschen und ein paar Snackartikel. Außerdem hatte ich einen Vorrat an Schreibsachen in einem Aktenordner, Papier, Stifte, Briefumschläge und Briefmarken. Ich wusste nie, wann ich wieder Gelegenheit zum Einkaufen haben würde, deshalb versuchte ich vorzusorgen. Mein Leben war weit von jeglicher Normalität entfernt. Es schien als ob ich mich für immer auf das Überleben in der Wildnis vorbereiten würde. Ich dachte immer weiter in diesem Spiel und tat mein Bestes, damit ich alles hatte, was ich brauchte.
Nachdem ich die Morgentoilette beendet hatte, ging ich zur Zellentür und gab dem Captain meine Kleidung durch den Essensschlitz. Ich kannte die Routine und diesmal war es für mich von Vorteil einfach weiterzumachen und keinen Ärger zu verursachen. Ich hatte gelernt, dass Ärger zu machen mich immer den Kürzeren ziehen ließ. Der Captain starrte mich mit Hass in den Augen an. Ich dachte, dass er mich verängstigen wollte. Das hatte noch nie bei mir funktioniert; es gibt nur wenige Dinge in meinem Leben, die mir Angst machen. Ich starrte nur zurück. Es zermürbte ihn, dass ich so dreist war und er wandte sich von meinem starren Blick ab. Auch dieser kleine Sieg hatte etwas Tröstliches. Der Captain hatte meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er war der Anführer des Rudels von Schakalen, das sich um meine Zelle versammelt hatte. Ich fragte ihn, ob er wisse, warum ich zurück vor Gericht müsse, aber er verneinte es.
Während er meine Kleidung durchsuchte, dachte ich über meine Situation nach. Ich hatte schon andere gesehen, die wieder vor Gericht mussten, nachdem sie verurteilt worden waren, und dachte, dass ich vielleicht zurück musste, um einige Papiere zu unterschreiben für den Berufungsanwalt, den das Gericht mir stellen musste. Ich redete mir also ein, dass genau dies passierte - nichts Ungewöhnliches. Dann gab mir der Captain meinen orangenen Jogginganzug und meine Schuhe wieder. Er warf meine Boxershortshorts und meine Socken auf den Flur außerhalb meiner Zelle, was mich total aufregte. Ich konnte erkennen, dass er mich für Abschaum hielt. Innerhalb von Sekunden war ich am Rande meiner Selbstbeherrschung. Ich stand an der Kante und sah in den Abgrund, in dem meine Wut brodelte. Ich war kurz davor, dem brutalen Bedürfnis nachzugeben. Ich fühlte den Kämpfer in mir an die Oberfläche kommen, bereit ihn anzugreifen. In diesem Moment wünschte ich mir, ich könnte diesem feigen, rassistischen Südstaatler vor mir an die Gurgel gehen. Ich sehnte mich danach, meinen Ärger an ihm auslassen zu können. Ich war es leid ständig ihrem Willen nachzugeben. Ich hatte nichts zu verlieren. Er konnte all dies in meinen Augen erkennen und entschloss sich als Erster zu sprechen: „Flores, du musst deinen Jogginganzug und deine Schuhe anziehen.“ Ich dachte über das, was gesagt hatte nach, aber es machte keinen Sinn. Ich bewegte mich nicht und fragte ihn stattdessen: „Wieso gebt ihr mir meine Boxershorts und die Socken nicht zurück?“ Er antwortete: „Du brauchst sie nicht“ Da wurde mir klar, dass alles ein Psychospielchen war und er sehen wollte, ob ich nach dem Köder schnappen würde. Ich ging jetzt davon aus, dass er wahrscheinlich hier unten in der Einzelhaft war, um für seine tägliche Portion Unterhaltung zu sorgen. In diesem Moment beschloss ich, dass ich nichts zu seiner Unterhaltung beitragen wollte. Ich sah den Schockgürtel, die Bauchkette, Handschellen und Fußfesseln. Mit unendlicher Anstrengung beherrschte ich meinen Ärger und meine Wut. Ich wich von der Tür zurück und zog meinen Jogginganzug an. Dann setzte ich mich auf meine Pritsche und zog meine Schuhe an. Ich saß dort, die Hände im Schoß und starrte auf den Captain. Jetzt schrie er nach dem Picket Control Officer, dass er die Tür öffnen sollte. Die elektronische Tür schwang automatisch zurück und die Wachen traten in meine Zelle.
Ich kannte die Prozedur. Ich stand auf und drehte mich langsam um. Ich hob meine Arme und ließ mir den Schockgürtel anlegen. Mit meinem Rücken zu ihnen zog ich langsam meinen Jogginganzug hoch und schnürte ihn mit der Schnur an meiner Brust fest. Ich kniete mich auf die Pritsche und ließ meine Füße über die Kante hängen, damit sie mir die Fußfesseln um meine Knöchel legen konnten. Dann fehlten nur noch die Hüftkette, die sie um meinen Bauch schnürten, und die Handschellen. Jetzt war ich „transportbereit“ und trat aus der Zelle. Sobald ich das gemacht hatte, befahl der Captain den Wachleuten, meinen Besitz mitzunehmen. Da wurde es mir schlagartig bewusst! Diese Hunde würden mich höchstpersönlich zum TDCJ, dem Texas Department of Criminal Justice, bringen! Ich beobachtete sie in meiner Zelle. Da war plötzlich eine Plastiktüte in der Hand eines Wärters und sie begannen meine Gerichtspapiere hineinzuschmeißen. Glücklicherweise wurde die Mappe, in der sich meine Schreibsachen befanden, auch hineingeworfen. „Vergesst mein Toiletzeug nicht“, warf ich schnell ein. Ich wusste, dass es mir erlaubt war diese Dinge zu behalten, wenn ich zum TDCJ transportiert werde. Der Captain fasste nach meinem Arm und zog mich von der Zellentür weg und ich konnte nicht länger sehen, was in die Plastiktüte getan wurde. Es war früh, vor 7 Uhr morgens und mein Freund und Zellennachbar Cowboy schlief noch. Ich fing an seinen Namen zu rufen: „COWBOY! COWBOY! Hey Junge, wach auf! COWBOY!“ Ich hörte, wie er mir antwortete und zu seiner Zellentür kam. Und ich erzählte ihm: „Sie bringen mich ins TDCJ. Du musst meine Mom anrufen und ihr ausrichten, dass ich weg bin!“ Ich rief ihm kurz die Telefonnummer zu, die er anrufen sollte und er schrieb sie auf und versprach, meine Verwandten anzurufen, sobald er die Möglichkeit dazu hätte. Ich war mir sicher, dass ich mich auf Cowboy verlassen konnte. Wir hatten schließlich nun für sechs Monate nebeneinander gelebt. Ich schätzte, dass der Großteil meiner Gebrauchsgegenstände in der Zelle zurückbleiben würde, sobald ich weg war. Ich überließ sie Cowboy; alles, was er tun musste, war, an sie ranzukommen.
Dann kamen die Wachen aus meiner Zelle mit meinen Habseligkeiten, die ich in dieser Plastiktüte mitnehmen sollte. Und so begann meine Reise.
Wir machten uns auf den Weg zum Aufzug und fuhren damit hinunter ins Erdgeschoss des Gefängnisses. Wir verließen es durch den Eingangsbereich und gingen weiter zur „Sallyport Area“, das ist der Bereich, in dem Gefangene zum Gefängnis gebracht und abgeholt werden. Als wir zum Parkbereich kamen, stand dort ein Dallas County Transportbus. Neben ihm standen zwei große Hilfssheriffs, die wie Polizisten gekleidet waren und dunkelblaue Uniformen trugen. An ihren Gürteln waren Schlagstöcke befestigt und in den Halftern steckten Maschinenpistolen. Langsam ging ich zur Rückseite des Busses und sie öffneten mir die Tür. Mit beträchtlicher Anstrengung schaffte ich es in den Bus. Es war nicht einfach mit all diesem Zeug an meinem Körper, den Wagen zu besteigen. Ich schaffte es trotzdem, ohne mich zu beschweren. Je schneller es vorbei war, desto besser.
Der Deputy schlug die Tür zu und ich war im hinteren Teil des Busses eingesperrt. Es gab keinen Weg nach draußen für mich. Wenn wir einen Unfall gehabt hätten und es den Wagen geschleudert und er Feuer gefangen hätte, hätte ich ein ernstes Problem gehabt. Es gab keinen Weg aus dieser Sardinenbüchse auf Rädern, in die ich eingesperrt war. Kurz darauf stiegen die Deputys vorne in den Bus ein. Ich sah, dass einer der beiden den Auslöser für den Schockgürtel hatte. Einer der Deputys fuhr, der andere kletterte in den hinteren Teil des Busses und nahm seinen Platz hinter dem Maschendrahtgeflecht ein, das den Wagen in zwei Hälften teilte. Er saß auf einer Bank und schnauzte mich an, still zu sitzen und ihm auf der Fahrt nach Huntsville keine Probleme zu machen. Jetzt war unser Ziel also kein Geheimnis mehr und er erzählte mir, wohin wir fuhren. Ich bereitete mich mental auf eine vierstündige Fahrt vor, während der ich mich so wenig wie möglich bewegen wollte. Ich hatte es bislang geschafft, keinen Stromstoß zu kriegen. Ich wollte ihnen keinen Anlass geben mich zu schocken, nun da es schon fast vorbei war.
Der Bus war mit Lichtern und Sirenen ausgestattet. Es war morgens und es war viel Verkehr. Die Autofahrer schienen alle auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Sobald wir auf dem Freeway waren, erkannte ich, dass die Deputys ihren Job sehr ernst nahmen. Der Fahrer machte die Blaulichter an. Wenn wir auf Staus auffuhren, machte er die Sirene an, scherte auf den Pannenstreifen aus und schoss an den Autos, die im Rush Hour Verkehr steckten vorbei, als würden sie still stehen. Das kostete mich den letzten Nerv. Es ist nicht wirklich lustig der Passagier zu sein, wenn ein anderer rücksichtslos fährt. Ich wurde dabei aber natürlich nicht gefragt.
Ich kannte die Strecke, die wir nach Huntsville nahmen. Ich war zumindest schon einmal dort gewesen und hatte also diesen kleinen Vorteil. Ich konnte mir unser Ziel vorstellen. Von dem Punkt im Wagen, an dem ich saß, konnte ich den Tachometer sehen. Als wir uns schließlich unseren Weg durch den Verkehr auf dem Highway 1-45 bahnten, begannen wir quasi abzuheben. Ich sah, wie der Wagen zuerst die 150, dann auch die 160, 170 und 180 km/h überschritt! Es war mir klar, dass der Deputy, der den Wagen fuhr, das Gaspedal bis zur Bodenplatte durchdrückte, um zu fahren, was der Wagen hergab. Ich hielt alles geduldig aus. Zum Glück war der Highway flach, lang und gerade. Ich konnte die Straße vor dem Wagen sehen und war froh, dass an diesem Morgen nicht mehr Verkehr war. Wenn uns ein Auto im Weg war, betätigte der Fahrer die Sirene, damit das Auto auswich. Wir blieben bei einer Geschwindigkeit von etwa 180 km/h und ich rechnete aus, dass wir es nach Huntsville in weniger als drei Stunden schaffen würden. Ich war schon damit zufrieden die Strecke in einem Stück zu überstehen.
So fuhr ich im hinteren Teil des Wagens zusammen mit dem Deputy, der nie den Blick von mir nahm. Als wir den Highway 1-45 hinunter rasten, fing ich an, über die Bedeutung dieser Verlegung nachzudenken. Ich hatte immer gedacht, dass ich erst mein inneres Gleichgewicht finden müsste, um auf diese Veränderung mental vorbereitet zu sein. Nun war diese Möglichkeit vorbei. Ich würde im texanischen Todestrakt gegen Abend ankommen und mit der Ungewissheit über das, was mich dort erwartet, musste ich halt fertig werden. Ich fühlte mich, wie wenn ich einen 500 Pfund schweren Gorilla auf meinem Rücken hätte. Wenn ich gezwungenermaßen in einer solch ungewissen Situation stecke, ist das immer so. Wenn ich keine Tatsachen kenne, aus denen ich irgendwelche Schlüsse ziehen kann, umgibt mich die Ungewissheit wie eine dunkle, bedrückende Wolke. Sie will meine Kraft und Entschlossenheit schwächen und mich in die Hysterie stürzen.
Dies waren einige meiner Gefühle und Gedanken auf dem Weg zum Todestrakt. Die Ungewissheit war das Allerschlimmste – nicht zu wissen, was mich erwartete, wie die Dinge im Todestrakt liefen, bereitete mir riesiges Kopfzerbrechen auf dieser Fahrt. Ich versuchte, mir die Entscheidung, die ich am vorigen Tag getroffen hatte, wieder gegenwärtig zu machen. Was auch immer passieren sollte, ich würde nie aufhören für mein Leben zu kämpfen. Was ich auch immer sehen, welchen Beleidigungen ich ausgesetzt sein sollte, sie würden nie meinen Geist brechen können. Das vergangene Jahr über hatte ich gelernt, manchen Schlachten aus dem Weg zu gehen und nur dann zu kämpfen, wenn ich eine Chance hatte zu gewinnen, und ich nahm diese hart erlernte Lektion mit. Ich fühlte mich kräftig genug und der Gedanke an eine körperliche Auseinandersetzung machte mir keine Angst. An diesem Punkt in meinem Leben begrüßte ich tatsächlich den Gedanken an solche Dinge, wenn es doch nur ein faires Schlachtfeld gewesen wäre. Wenn ich nicht all diese körperlichen Hindernisse an meinem Körper hätte, wenn meine Chancen etwas besser wären, dann hätten sie bestimmt alle Hände voll zu tun.
Wenn ich jetzt zurückblicke, ist mir klar, dass die unmenschliche Behandlung, die Tortur und der Missbrauch, denen ich während meines Aufenthalts im Bundesgefängnis ausgesetzt war, meine Gedankengänge verdreht hatten. Ich hielt alles für eine potentielle Bedrohung. Ich wollte nie wieder eine Situation falsch einschätzen. Ich hielt alles für einen Kampf um Leben und Tod. Nun bin ich mir bewusst, dass sie mich in dieser Phase meines Lebens zu unmenschlichen Gedanken und Verhaltensmustern gebracht hatten. Die Umwelt, in der ich gezwungen war zu überleben, hatte mir das angetan, aber ich habe das Beste aus allem gemacht, fest dazu entschlossen zu überleben. Dieser Gedanke ging nicht aus meinem Kopf: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter.“ Ich war stärker als je zuvor. Im Bezirksgefängnis hatten sie mit allen Mitteln versucht, meinen Geist zu brechen, aber sie hatten versagt.
Jetzt, da mir dieser Sieg bewusst wurde, gab er mir Kraft und Hoffnung. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr hieß ich die Veränderung willkommen. Ich umarmte die Ungewissheit. Ich freute mich auf den Todestrakt und somit umarmte ich den Tod selbst. Ich wusste ein wenig über den Todestrakt in Texas. Ich wusste, dass ich dort die Möglichkeit haben würde fernzusehen und ein Radio und andere persönliche Dinge anzuschaffen: Kleidung, Socken, Hosen, Boxershorts und T-Shirts zu kaufen und ich freute mich auf diese Dinge, die ich als Privilegien ansah. Ich stellte mir vor, im Todestrakt wieder einige Sonnenstrahlen genießen zu können. Auf diese Weise wurde meine Besorgnis zur aufgeregten Vorfreude.
All diese Gedanken gingen mir auf der Fahrt nach Huntsville durch den Kopf. Ich hielt meinen Blick auf den Highway gerichtet. Auf vielerlei Weise war dies die längste Fahrt meines Lebens, andererseits war es auch nur ein Tropfen im Meer der Zeit.
Instinktiv begann ich das Beste aus der Sache zu machen und ich tat dies, ohne dass es mir bewusst war. So begann ich mir eine der wichtigsten und wertvollsten Lektionen beizubringen. Ich lehrte mich, meinen Verstand in dieser von Menschen erschaffenen Hölle, namens Todestrakt Texas, zu bewahren. Ich wusste, dass wir in den Freeway nach Huntsville einbogen und ich saugte alles, was es zu sehen gab, mit meinen Augen auf. Nach einer kurzen Fahrt durch die Stadt kamen wir in der Diagnostic Unit, dem Bürokomplex, an. Ich wusste, dass ich mich an der Türschwelle zur Hölle befand, dass ich im Begriff war, die Höhle des Löwen zu betreten.