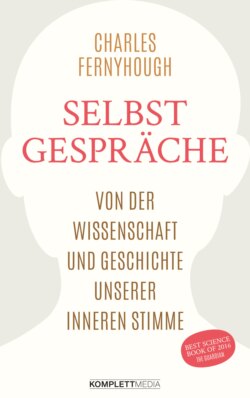Читать книгу Selbstgespräche - Charles Fernyhough - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 1
LUSTIGE KÄSESCHEIBEN
Es ist ein Herbsttag in Westlondon. Ich bin auf dem Weg zu einem Arbeitsessen und sitze in der U-Bahn Central Line. Der mittägliche Hochbetrieb hat noch nicht eingesetzt, und ich habe es geschafft, einen Platz in einem jener Waggons zu ergattern, in denen man sich in zwei Reihen gegenübersitzt, nahe genug, um die Titelseiten der Zeitungen zu überfliegen, die das Gegenüber liest. Die U-Bahn hat zwischen zwei Stationen angehalten, und wir warten auf eine Durchsage. Die Leute lesen Taschenbücher, die Klatschblätter, jene seltsamen technischen Bedienungsanleitungen, die allem Anschein nach nur in der U-Bahn studiert werden. Alle Übrigen starren auf die rätselhaft farbig gekennzeichneten Kabel, die im Tunnel direkt vor dem Abteilfenster entlangführen. Holland Park ist vermutlich noch 400 Meter entfernt. Ich tue nichts Ungewöhnliches, genau genommen tue ich überhaupt nichts. Es ist ein Moment der nur schwach bewussten Beschaulichkeit. Ich bin ein ganz normaler Mann Ende vierzig in gesunder mentaler und körperlicher Verfassung. Ich habe ein klein wenig zu lange geschlafen, ein bisschen zu wenig gegessen und freue mich mit einem guten, noch nicht befriedigten Appetit auf das Mittagessen in Notting Hill.
Auf einmal lache ich los. Noch einen Augenblick zuvor war ich ein anonymer Fahrgast mit elektronischer Oyster-Fahrkarte. Jetzt gebe ich meine Tarnung mit einem mehr als hörbaren Gekicher auf. Ich komme häufig nach London, aber ich bin es nicht gewohnt, dass mich so viele Fremde gleichzeitig anstarren. Ich besitze genügend Geistesgegenwart und bin mir meines Publikums ausreichend bewusst, um mein Gelächter in Schach zu halten, bevor ein privater Witz in allgemeine Verlegenheit ausartet. Interessant ist dabei nicht, worüber ich lache, sondern die Tatsache, dass ich überhaupt lache. Ich habe weder dem Witz eines anderen gelauscht noch einen lustigen Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Ich habe etwas viel Banaleres getan. Man könnte sagen, dass ich gerade die allernormalste Erfahrung gemacht habe, die ein Mensch in einer U-Bahn erleben kann: Mir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen.
Es handelte sich um einen ziemlich bedeutungslosen Gedanken, der mich an jenem Tag loslachen ließ. Es war keiner jener Momente, in denen ein Denker endlich auf die Lösung eines wichtigen Problems stößt, eine Idee hervorbringt, die die Industrie revolutionieren wird, oder die Anfangsverse eines großartigen Gedichts vollendet. Gedanken können Geschichte schreiben, doch das ist gewöhnlich nicht der Fall. Damals dachte ich zwischen den zwei U-Bahn-Stationen an eine Kurzgeschichte, an der ich gerade arbeitete. Es ging um die Geschichte einer ländlichen Gemeinde und um Zwietracht im post-agrarwirtschaftlichen Zeitalter, und ich wollte, dass mein Held, ein ehemaliger Bauer, eine außereheliche Beziehung führt. Ich hatte die Möglichkeiten erwogen, dass er eine Affäre mit der Frau eingeht, die den mobilen Postlaster fährt, und diese Affäre spielt sich hinter den geschlossenen Jalousien eines speziell umgebauten Ford Transit ab. Die beiden treffen sich jeden Donnerstagnachmittag nach den wöchentlichen Geschäftszeiten im Dorf. Die Türen werden verschlossen, das Sprechfunkgerät ausgeschaltet, und die beiden erkunden einander auf der von Hunderten von Kleingeldtransaktionen verkratzten Schaltertheke. Während ich die Szene in Gedanken konstruierte, hatte ich das Bild eines am Rand der Landstraße geparkten leuchtend roten Postlasters vor Augen, der auf mögliche Passanten wie stillgelegt und leer wirkt, dann aber mit einem hartnäckigen Quietschen der Federung zu schaukeln beginnt, als die Körper im Inneren anfangen, Reibung zu suchen …
Genau an diesem Punkt musste ich laut loslachen. Diese Wörter gingen mir durch den Kopf und amüsierten mich. Auf keinen der anderen Fahrgäste zeigten sie diese Wirkung, weil keiner die Pointe hörte. Aber meine Mitfahrenden wussten, dass es eine Pointe gab. Sie lachten nicht über meinen privaten Spaß (weil sie ihn nicht hören konnten), aber sie lachten mich auch nicht aus. Sie wussten, dass ich, wie die meisten Menschen in diesem U-Bahn-Wagen, mit Gedanken beschäftigt war, und sie verstanden, dass Gedanken – wilde Gedanken, banale Gedanken, heilige oder profane Überlegungen – gelegentlich Gelächter hervorrufen können. Selbstgespräche zu führen ist etwas ganz Normales, und die Menschen erkennen es, wenn sie es sehen. Nicht nur das, sie erkennen auch deren Privatheit an. Ihre Gedanken gehören nur Ihnen, und was immer sich dort auch abspielt, es findet in einem Bereich statt, zu dem andere Menschen keinen Zugang haben.
Ich bin jedes Mal über dieses Bewusstsein erstaunt. Unsere Erfahrung ist nicht nur für uns selbst faszinierend und lebhaft, sie ist es ausschließlich für uns. In der Sekunde oder in den zwei Sekunden nach meinem Lachanfall wurde mir klar, dass ich versuchte, soziale Signale auszusenden, die mein Verhalten entschuldigten. Man lacht in einem beinahe voll besetzten Zugabteil nicht laut los, ohne zumindest ein wenig Verlegenheit zu empfinden. Ich wollte nicht so tun, als hätte ich nicht gelacht, vielleicht indem ich versucht hätte, mein Lachen mit einem Hustenanfall zu kaschieren, aber ich bemühte mich dennoch, gewisse Botschaften auszusenden: Dass ich nicht verrückt bin, dass ich mich schnell wieder unter Kontrolle hatte, ja, dass es tatsächlich schon vorbei war – dass der Augenblick der Erheiterung jetzt vorüber war. Ich ertappte mich dabei, dass ich eine Miene aufsetzte, die so etwas wie ein Lächeln und eine Mischung aus Klugheit, Komplizenschaft und Verlegenheit ausdrückte. Ein anderer Gedanke ging mir durch den Kopf, eine Stimme, die sagte: »Die glauben doch nicht etwa, dass ich über sie lache, oder?« Lachen ist ein soziales Signal, aber dieser Spaß war privat. Ich hatte eine der Regeln des menschlichen Miteinanders verletzt und musste diese Tatsache durch irgendeine Bekundung einräumen.
Ich brauchte mir keine Sorgen zu machen. Die Menschen in dem Abteil würden das verstehen, es sei denn, es handelte sich um kleine Kinder, Außerirdische oder eine bestimmte Art von Psychiatriepatienten. Unsere Überzeugung, dass unser Innenleben privat ist, ist so ausgeprägt, dass Alternativen dazu – Gedankenlesen, Telepathie und Gedankeninvasion – Anlass für Erheiterung oder Entsetzen bieten können. Fremde in einem U-Bahn-Wagen werden die Auswirkungen dieses Merkmals von Gedanken rasch erkennen. Schließlich werden sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich wurde lediglich verblüffend an die Privatheit meiner Gedanken erinnert und mir ihrer direkten Wirkung auf mich deutlich bewusst. In diesem Augenblick war mein Gehirn in jedem Fall aktiv – anders hätte ich das Bild des schaukelnden Postlastwagens nicht heraufbeschwören können –, aber ich war mir darüber hinaus des inneren Ideenfeuerwerks bewusst. Und genau das bietet Ihnen das Gehirn: einen Logenplatz für eine Show nur für Sie allein.
Es war diese lebhafte innere Vorstellung, die mich hatte laut loslachen lassen. Zwar läuft ein großer Teil unserer mentalen Aktivität unterhalb der Bewusstseinsschwelle ab, doch vieles wird der Person bewusst, in der es sich abspielt. Wenn wir mit einem Problem zu kämpfen haben, uns eine Telefonnummer ins Gedächtnis rufen oder an eine romantische Begegnung zurückdenken, ist uns klar, dass wir dies tun. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei um ein komplettes oder korrektes Bild der daran beteiligten kognitiven Mechanismen handelt – wir sind bei Weitem keine verlässlichen Zeugen dessen, was unser Gehirn vollbringt –, aber es führt zumindest zu einer stimmigen Erfahrung. In der von Philosophen bevorzugten Sprache ist »etwas vorhanden, dem es ähnelt«2, wenn man sich des arbeitenden Gehirns bewusst ist. Sich mit einer Gedankenfolge zu beschäftigen ist ein Erlebnis, das spezielle Qualitäten besitzt, wie das Eintauchen in einen Swimmingpool oder die Trauer um einen geliebten Angehörigen.
Aber wir können noch etwas anderes Wichtiges über unsere innere Erfahrung3 sagen. In zahlreichen populärwissenschaftlichen Büchern wurde – häufig mit bewundernswerter Klarheit – dargestellt, was wir über das Funktionieren des Bewusstseins wissen. Allerdings neigen die Autoren dazu, sich auf das Wunder der perzeptuellen und affektiven Erfahrung zu konzentrieren: warum diese weiße Lilie diesen charakteristischen Duft verströmen kann; warum die Nachwirkungen eines Familienstreits so viele bittersüße emotionale Möglichkeiten eröffnen können. Mit anderen Worten: Die Betrachtung der mentalen Erfahrung konzentriert sich in diesen Büchern gewöhnlich auf die Reaktion des Gehirns auf Ereignisse der Außenwelt. Wenn wir anfangen, über das Denken nachzudenken, müssen wir erklären, wie das Bewusstsein seine eigene Show aufführen kann. Wir sind für unsere Gedanken verantwortlich, zumindest haben wir das starke Gefühl, dass es so ist. Das Denken ist eine Aktivität; es ist etwas, was wir tun. Das Denken treibt sich selbst an, erschafft etwas, wo zuvor nichts war, ohne von der Außenwelt irgendeine Richtungsvorgabe zu benötigen. Dies ist ein Teil dessen, was uns eindeutig zum Menschen macht: die Tatsache, dass ein Mensch sich in einem leeren Raum ohne jede äußere Stimulation zum Lachen oder Weinen bringen kann.
Wie ist es, solche Erfahrungen zu machen? Die Tatsache, dass das Denken etwas so Gewöhnliches ist, könnte paradoxerweise bedeuten, dass wir nicht groß darüber nachdenken, wie es funktioniert. Die Gesetze der geistigen Privatsphäre sorgen darüber hinaus dafür, dass das Erlebnis dem Blick der anderen verborgen bleibt. Wir können anderen den Inhalt unserer Gedanken mitteilen – wir können ihnen erzählen, worüber wir nachdenken –, aber es fällt uns deutlich schwerer, anderen die Qualität eines Phänomens zu vermitteln, das nur für uns selbst bestimmt ist. Wenn wir den Gedankengängen anderer Menschen lauschen könnten, würden wir dann feststellen, dass sie unseren eigenen ähnlich sind? Oder besitzen Gedanken einen persönlichen Stil oder eine emotionale Atmosphäre, die für den Denker charakteristisch sind? Was wäre gewesen, wenn die Leute an jenem Tag in der U-Bahn meine Gedanken tatsächlich hätten lesen können? Was würde ein mentaler Lauscher in diesem Moment hören, wenn er in der Lage wäre, Ihre Gedanken zu belauschen? Der Philosoph Ludwig Wittgenstein stellte fest, dass wir nicht in der Lage wären, einen Löwen zu verstehen, wenn er sprechen könnte.4 Ich vermute, dass etwas Ähnliches für unseren alltäglichen
Bewusstseinsstrom gilt. Selbst wenn wir unsere Gedanken irgendwie hörbar machen könnten, würden andere Menschen wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen.
Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass wir beim Denken Wörter auf eine sehr spezielle Art und Weise nutzen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich würde Sie fragen, in welcher Sprache Sie denken. Ich vermute, dass Sie möglicherweise nicht in der Lage sein könnten, die Frage für jeden Ihrer Gedanken ehrlich zu beantworten, aber Sie würden einräumen, dass diese Frage sinnvoll ist. Viele von uns würden zustimmen, dass das Denken eine sprachliche Qualität5 besitzt. Falls Sie zweisprachig sind, könnten Sie sogar wählen können, in welcher Sprache Sie denken wollen. Nichtsdestotrotz gibt es vielerlei Gedanken, deren sprachliche Eigenschaften nicht immer offensichtlich sind. Es gibt Dinge, die Sie sich beim Denken nicht selbst mitteilen müssen, weil Sie diese bereits kennen. Die Sprache kann stark vereinfacht werden, weil die Botschaft nur für Sie selbst bestimmt ist.
Ein weiterer Grund, weshalb unser Denken für andere Menschen unverständlich sein könnte, ist die Tatsache, dass daran gewöhnlich nicht nur Wörter beteiligt sind. In jenem Augenblick in der U-Bahn hatte ich neben allen anderen körperlichen und emotionalen Eindrücken einen Song aus dem Film High School Musical im Kopf. Während mein Blick ziellos auf die Kabel im Tunnel vor dem Abteilfenster geheftet war, war mein inneres Auge damit beschäftigt, das Bild des roten Postlastwagens heraufzubeschwören. Einige dieser Empfindungen hingen mit dem Denken zusammen, andere bildeten lediglich den geistigen Hintergrund. Entscheidend ist, dass das Denken ein multimediales Erlebnis ist. Die Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle, aber sie ist bei Weitem nicht alles.
In diesem Buch möchte ich der Frage nachgehen, wie es ist, wenn sich so etwas in Ihrem Kopf abspielt. Ich möchte herausfinden, wie es sich anfühlt, bei jener Flut von Eindrücken, Ideen und inneren Äußerungen ertappt zu werden, die unseren Bewusstseinsstrom bildet. Nicht alles, wozu unser Geist und Gehirn fähig sind, wird sich als diese Art von Erfahrung qualifizieren. Viele der wirklich klugen Dinge, die ein Mensch leisten kann, wie zum Beispiel, einen Kricketball zu fangen oder mithilfe des Sternenhimmels über den Pazifik zu navigieren, können ohne bewusste Wahrnehmung, wie sie zu vollbringen sind, erfolgreich durchgeführt werden. In gewissem Sinne bezieht sich »Denken« auf alles, was unser Bewusstsein (im Gegensatz zum Unterbewusstsein) tut. Aber diese Definition ist noch zu weit gefasst. Ich würde jene unglamourösen geistigen Leistungen, wie zum Beispiel das Zählen einer Handvoll Kieselsteine oder den Wechsel mentaler Bilder, die im Wesentlichen auf stark automatisierten, speziell entwickelten kognitiven Subsystemen basieren, nicht dazuzählen wollen. Ein Grund, weshalb diese Prozesse nicht einbezogen werden, ist die Tatsache, dass ihre Start- und Endpunkte eindeutig definiert sind. Der Zauber des Denkens liegt zum Teil darin begründet, dass es ziellos, im Kreis oder auf ein kaum definiertes Ziel gerichtet erfolgen kann.6 An jenem Tag in der U-Bahn wusste ich nicht, wie ich mit meiner Geschichte weitermachen sollte. Manchmal ist das Denken tatsächlich »zielgerichtet«, beispielsweise wenn es darum geht, eine bestimmte Art von intellektuellem Problem zu lösen. Aber der Bewusstseinsstrom kann sich auch ziellos dahinwinden. Häufig hat das Denken keinen offenkundigen Startpunkt, und oft verlangt es von uns, am Ziel anzukommen, bevor wir wirklich verstehen, was dieses ist.
Und das ist die Art von Denken, die mich interessiert. Dieses ist in dem Sinne bewusst, dass wir wissen, was wir gerade denken, aber auch in dem Sinne, dass es das besitzt, was Philosophen als phänomenologische Eigenschaft bezeichnen: Es gibt etwas Ähnliches, womit man es vergleichen kann. Es erfolgt sprachlich, und wie wir sehen werden, hängt das Denken häufig direkter mit der Sprache zusammen, als es anfänglich den Anschein hat. Auch die Bildsprache spielt eine Rolle, ebenso wie andere sensorische und emotionale Elemente, aber diese sind nur ein Teil des Ganzen. Darüber hinaus ist das Denken (in Wörtern oder auf andere Weise) privat: Was wir denken, denken wir im Kontext der bestimmten festen Annahme, dass es für andere nicht wahrnehmbar ist. Gedanken sind in der Regel kohärent: Sie fügen sich in Ideenstränge ein, die mit dem, was zuvor geschehen ist, in Verbindung stehen, egal, wie zufällig sie erfolgen. Und schließlich sind Gedanken aktiv: Denken ist etwas, was wir tun, und gewöhnlich erkennen wir es als unser eigenes Werk.
Ich bin nicht der Erste, der sich für die Rolle interessiert, die Wörter bei unseren mentalen Prozessen spielen. Seit Jahrhunderten streiten sich Philosophen über die Frage, ob Sprache für das Denken notwendig ist (während sie häufig ein bisschen vage bleiben, was sie mit »Denken« überhaupt meinen)7. Und Tierverhaltensforscher haben einfallsreiche Experimente durchgeführt, um herauszufinden, zu welcher Art von Denken Tiere fähig sind und ob ihnen eine Sprache beigebracht werden kann. All diese Erkenntnisse sind für meine Untersuchung relevant. Aber ich verfolge einen etwas anderen Ansatz. Ich möchte mit einer schlichten Tatsache beginnen: nämlich dass wir feststellen, dass unser Kopf voller Wörter ist, wenn wir über unsere eigenen Erfahrungen nachdenken oder wenn wir andere Menschen bitten, davon zu berichten, was bei ihnen im Kopf gerade vor sich geht. Das bedeutet nicht, dass jeder von solchen gedanklichen Wortströmen berichtet: Die Tatsache, dass es manche von uns nicht tun, bedarf einer Erklärung. Wird diese Frage richtiggestellt, dann kann sie sich über das Verhältnis von Sprache und Denken als sehr informativ erweisen.
Könnten wir Gedanken lesen, dann wären wir in der Lage, diese Frage einfach dadurch zu klären, dass wir die Gedanken der Menschen um uns herum lesen würden. Aber die geistige Privatsphäre ist nun einmal Realität, deshalb müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir können zum Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, mit welchen die Menschen ihre Gedanken mitteilen, indem sie erzählen, schreiben, bloggen, tweeten und texten, was bei ihnen im Kopf gerade vor sich geht. Wir können betrachten, was Autoren über innere Erfahrungen geschrieben und was Psychologen von den Beschreibungen der Menschen dokumentiert haben. Und wir werden von der Neurowissenschaft Hilfe erhalten, die uns die Bilder eines Scanners davon liefern wird, wie sich Gedanken im Gehirn formen. Wir können beobachten, wie sich das Denken in der Kindheit entwickelt, und was passiert, wenn es schiefläuft. Doch mein Ausgangspunkt ist näherliegend. Ich möchte ja nichts Fremdes oder Unbekanntes darstellen, wie zum Beispiel das Bewusstsein des Haustiers oder wie es ist, ein Neugeborenes zu sein. Ich weiß, wie es ist, wenn sich die Sache in meinem Kopf abspielt. Ich muss lediglich eine Möglichkeit finden, sie in Worte zu fassen.
In Terminal eins erhalten Sie lustige Käsescheiben. Es handelt sich nicht um den bedeutendsten Gedankengang, für den ich je verantwortlich war. Ich picke ihn aufs Geratewohl heraus, biete ihn nicht etwa als lebensverändernde Weisheit an, sondern als Beispiel für den Bewusstseinsstrom am heutigen Morgen. Als ich aufwachte, war er in meinem Kopf, aber ich war mir nicht bewusst, dass ich unmittelbar davor geträumt hatte oder dass der Gedanke in irgendeiner Weise mit etwas anderem zusammenhing. In Terminal eins erhalten Sie lustige Käsescheiben. Das ist alles. Ich weiß noch immer nicht, um welchen Flughafen es sich handelte oder was Käse überhaupt damit zu tun hat. Aber ich weiß, dass der Gedanke da war, wie die Äußerung einer schwachen inneren Stimme, und dass sie sich für mich real anfühlte. Ich behaupte, nicht zu wissen, woher sie kam, aber in gewisser Weise weiß ich es doch. Sie kam von mir. Als rationaler Psychologe würde ich sagen, dass es sich um einen jener Sätze handelte, die mir gewöhnlich in den Sinn kommen und Teil der geistigen Produktion sind, die den Bewusstseinsstrom am Laufen halten.
Auch bei Claire tauchen Sätze im Kopf auf. Ihre inneren Stimmen sprechen leise und eindringlich und sagen ihr Dinge wie »Du bist ein Stück Scheiße« oder »Du wirst nie irgendetwas erreichen«. Claire leidet an einer Depression. Sie unterzieht sich gerade einer kognitiven Verhaltenstherapie, um diese aufdringlichen und unerwünschten sprachlichen Gedanken zu bekämpfen: sie zu dokumentieren, sie wissenschaftlich zu untersuchen und sie damit insoweit zu untergraben, dass sie am Ende (hoffentlich) verschwinden werden.
Auch in Jays Kopf tauchen Wörter auf. Diese unterscheiden sich deutlich von Claires. In den meisten Fällen klingen sie so, als würde jemand mit ihm reden. Sie können einen Akzent haben, eine Tonhöhe und einen Tonfall. Manchmal sprechen sie in ganzen Sätzen, manchmal sind ihre Äußerungen eher bruchstückhaft. Sie kommentieren Jays Handlungen und weisen ihn an, bestimmte Dinge zu tun: harmlose Dinge, wie zum Beispiel in den Laden zu gehen und Milch zu kaufen. Bei anderen Gelegenheiten sind sie deutlich schwieriger zu erkennen. Jay hat mir erzählt, er wisse, dass eine Stimme da ist, selbst wenn sie nicht spricht. Bei diesen Gelegenheiten handelt es sich nicht um eine Stimme, sondern vielmehr um eine Präsenz in seinem Kopf. Aber was ist eine Stimme, die nicht spricht? Vor ein paar Jahren wurde bei Jay eine psychische Erkrankung diagnostiziert, und er erlebt jetzt das, was man eine »Genesungsgeschichte« nennt. Er erholt sich von einem Zustand, den manche Leute für eine degenerative Gehirnerkrankung8 halten. Er hört die Stimmen noch immer, aber jetzt hat er eine andere Einstellung ihnen gegenüber angenommen. Er lebt mit ihnen und fürchtet sich nicht mehr vor ihnen.
Eine Stimmenhörerin, die wortgewandt von ihrer Erfahrung berichtete, hat ebenfalls zu einer neuen Einstellung ihren Stimmen gegenüber gefunden. In einer Videokonferenz aus dem Jahr 2013, die mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, beschreibt Eleanor Longden, die Stimmen seien in der Zeit, als sie ihr Buch verfasste, so aggressiv geworden, dass sie plante, ein Loch in ihren Kopf zu bohren, um sie herauszulassen. Im Laufe mehrerer Jahre hat sich Eleanors Einstellung gegenüber ihren Stimmen ebenso wie Jays radikal verändert. Sie sind zwar noch immer gelegentlich sehr lästig, aber Eleanor betrachtet sie inzwischen als die Relikte eines »psychischen Bürgerkriegs«9, der von wiederholten Kindheitstraumata herrühre.
Es hat den Anschein, als könnten viele Menschen, wenn sie angemessene Unterstützung erhalten, das Verhältnis zu ihren Stimmen verändern und lernen, recht gut mit ihnen zu leben. Die Ansicht, dass Stimmen immer ein Zeichen einer ernsten geistigen Erkrankung sind, ist einschränkend und abträglich, weshalb ich den neutraleren Begriff Stimmenhören den negativen Konnotationen der Bezeichnung Halluzination vorziehe.10
Falls die Erfahrungen von Jay und Eleanor sich tatsächlich von meinen eigenen inneren Stimmen unterscheiden, dann stellt sich die Frage: Wie genau unterscheiden sie sich? Meine »Stimmen« haben häufig einen Akzent und eine Tonhöhe. Sie sind privat und nur für mich hörbar, und dennoch klingen sie häufig wie reale Personen. Doch auf einer bestimmten Ebene erkenne ich die Stimmen in meinem Kopf als meine eigenen, während Jay die seinen fremd zu sein scheinen. Er sagt, dass er gewöhnlich zwischen seinen Gedanken, die sich anfühlen, als wären sie seine eigenen Schöpfungen, und diesen anderen Erfahrungen unterscheiden kann, die von woanders zu kommen scheinen. Bei anderen Gelegenheiten ist die Unterscheidung deutlich verschwommener.
Ein weiterer Stimmenhörer, Adam, dessen Hauptstimme eine sehr klare, autoritäre Persönlichkeit besitzt (so sehr, dass Adam ihr den Spitznamen »der Captain« gegeben hat), erzählte mir, dass er trotzdem manchmal in Verwirrung geraten kann, ob es sich gerade um seine eigenen Gedanken oder um diejenigen seiner Stimme handelt. Ich habe erlebt, dass Stimmenhörer den Beginn ihrer ungewöhnlichen Erfahrungen beschrieben, als habe man einen Soundtrack eingeschaltet, der schon immer da gewesen sei, und als stelle er ein Hintergrundgeräusch des Bewusstseins dar, dem der Betroffene aus irgendeinem Grund auf einmal Aufmerksamkeit schenke.
Eine Ursache, weshalb Stimmenhörer ihre Erfahrungen einem äußeren Akteur zuschreiben, ist die Tatsache, dass die Stimmen Dinge sagen, die der Hörende meint, selbst niemals gesagt haben zu können. Eine Frau erzählte mir, ihre Stimme sage so schreckliche und widerliche Dinge, dass sie wisse, sie könnten unmöglich von ihr stammen.
Aber es kann auch genau umgekehrt sein. Ich habe Stimmenhörer über etwas, was ihre Stimme ihnen gerade ganz im Geheimen gesagt hatte, laut loslachen hören. Eine andere Stimmenhörerin erklärte mir, weshalb sie wisse, dass ihre witzelnde innere Stimme nicht »sie selbst« sein konnte: »Ich kann es nicht sein. Mir selbst würde niemals etwas so Lustiges einfallen.«
Es ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen besser verstehen lernen. Bei meinen sprachlichen Gedanken und den Stimmen, die Stimmenhörer vernehmen, kann es sich um ganz unterschiedliche Erfahrungen handeln, doch sie können wichtige Merkmale gemein haben. Auf einer bestimmten Ebene könnte es sich sogar um das Gleiche handeln. Wie immer in der Wissenschaft der menschlichen Erfahrung sind die Dinge komplizierter, als sie zunächst erscheinen. Es ist wichtig, nicht von der Annahme auszugehen, dass eine Art von Stimme die andere abwertet. In Wahrheit sollten wir uns vor der Mutmaßung hüten, dass irgendwas etwas anderes abwerten soll. Menschen machen diese Erfahrungen, und Menschen sind verschieden (ich kann zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass meine eigenen Selbstgespräche auch nur im Entferntesten den Ihren ähnlich sind).
In diesem Buch interessiere ich mich für all diese Stimmen: die freundlichen, die richtungweisenden, die ermunternden und gebieterischen, die Stimmen der Moral und Erinnerung und die manchmal schrecklichen, manchmal wohltuenden Stimmen derjenigen, die andere sprechen hören, obwohl niemand in der Nähe ist.
Als ich in den 1990er-Jahren nach Abschluss meines Studiums anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, wirkte es nicht wie ein empfehlenswerter Forschungsgegenstand. Meine Vorgesetzten hätten mich warnen können, dass die Untersuchung von etwas so Privatem und Unbeschreiblichem wie unsere inneren Stimmen wohl kaum den Grundstein für eine erfolgreiche Forscherkarriere legen würde. Erstens hatte es den Anschein, als sei sie von einer fast unmöglichen Aufgabe der Introspektion abhängig (des Nachdenkens über die eigenen Gedankenprozesse), die als wissenschaftliche Methode schon lange in Ungnade gefallen war. Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Vorstellung von einer »inneren Stimme« häufig vage und metaphorisch mit Bezug auf alles genutzt wird, vom Bauchgefühl bis hin zum schöpferischen Instinkt, ohne ernsthaft den Versuch einer klaren Definition zu unternehmen, die ja Voraussetzung für eine fundierte Untersuchung ist.
Es gab allerdings gute Gründe, an diesem Projekt festzuhalten, und in den letzten Jahren hat sich der Stand der Wissenschaft tief greifend verändert. Eines hat diese Forschung jedenfalls hervorgebracht, nämlich die Erkenntnis, dass die Wörter, die in unserem Kopf widerhallen, bei unserem Denken eine wichtige Rolle spielen. Psychologen demonstrieren, dass die innere Sprache, wie sie es nennen, uns hilft, unser Verhalten zu regulieren, uns zum Handeln zu motivieren, unsere Taten zu bewerten und uns unseres eigenen Selbst bewusst zu werden. Neurowissenschaftler belegen, dass innere Stimmen sich einiger der gleichen neuralen Systeme bedienen, die für das externe Sprechen verantwortlich sind, was mit wichtigen Konzepten ihrer Entstehung übereinstimmt.
Inzwischen wissen wir, dass die innere Sprache in unterschiedlichen Formen daherkommt und mit verschiedenen Zungen spricht; dass die Stimme einen Akzent und einen emotionalen Tonfall besitzt und dass wir ihre Fehler in etwa auf die gleiche Weise wie normale Versprecher korrigieren. Viele von uns denken tatsächlich in Wörtern, und es gibt gute und schlechte Formen bei dieser Art von Denken. Negative, von der inneren Sprache fortgesetzte Gedanken tragen zu dem von gewissen mentalen Störungen verursachten Leiden bei, aber sie können auch der Schlüssel zu deren Linderung sein.
Abseits des wissenschaftlichen Labors haben Fragen rund um die innere Sprache die Menschen fasziniert, seit sie über ihre eigenen Gedanken nachdenken. Eine Tatsache können wir über das Denken feststellen, nämlich dass es uns häufig wie eine Art Unterhaltung zwischen verschiedenen Stimmen erscheint, die gegensätzliche Auffassungen vertreten. Aber wie klingen diese Stimmen? Welche Sprache sprechen sie? Spricht Ihr denkendes Selbst in ganzen grammatikalischen Sätzen, oder ist es eher so, als hörten Sie etwas in Notizform Niedergeschriebenes? Sprechen Ihre Gedanken leise, oder erheben sie manchmal die Stimme? Und überhaupt, wer hört zu, wenn Ihr denkendes Selbst spricht? Wo befinden »Sie« sich bei alledem? Solche Fragen mögen seltsam klingen, und dennoch müssen diese Qualitäten des Denkens definieren, wie es ist, mit unserem eigenen Geist zu leben.
All diese Rätsel könnten geklärt werden, wenn wir das Konzept von Denken als Stimme (das für unsere Innenschau so überzeugend ist) beziehungsweise von Stimmen im Kopf ernst nehmen. Ich möchte dieses Konzept erkunden und es bis an seine Grenzen austesten. Dieser Ansatz, den ich als Modell des Dialogischen Denkens bezeichnen möchte, hat auf die ein oder andere Weise einen großen Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Psychologie inspiriert und wird der Schwerpunkt dieses Buchs sein. Es ergibt sich aus einer speziellen Theorie der Entwicklung des Denkens in der frühen Kindheit und wird von psychologischen und neurowissenschaftlichen Untersuchungen der normalen und gestörten Kognition bestätigt. Doch es ist ungeachtet der Tatsache, wie viele Beweise für das Modell vorliegen, klar, dass es viele Aspekte unserer inneren Erfahrungen gibt, die nicht verbal und stimmenähnlich sind, und ich werde untersuchen, ob die Hypothese aufgestellt und auch auf das Denken von Menschen angewendet werden kann, die keine Sprache haben, um damit zu denken, aber auch jene Belege berücksichtigen, dass ein großer Teil unseres inneren Erlebens visuell ist und auf Bildern basiert.
Ich habe das Glück, mich auf ein sehr breites Spektrum von Beweisen stützen zu können. Einige Aspekte des Rätsels rund um die inneren Stimmen fanden seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden Beachtung. Philosophen haben mit den schwierigen Problemen hinsichtlich der Frage gekämpft, wie der Geist Wissen darstellen kann. Und sie haben von Prinzipien geleitete Thesen über die Frage aufgestellt, ob das Denken zum Beispiel in natürlicher Sprache möglich ist. Psychologen haben Untersuchungsteilnehmern Denkaufgaben gestellt und sie aufgefordert, ihre Gedankenprozesse für eine eingehende Analyse laut auszusprechen. Neurowissenschaftler haben die innere Sprache untersucht, indem sie die elektrischen Signale der Sprachmuskulatur von Menschen aufzeichneten, die stumm dachten, oder indem sie Teile des Gehirns stimulierten und verfolgten, wie sich dies auf sprachliche Prozesse auswirkt. Seit Jahrhunderten haben Schriftsteller ihre Romane und Gedichte mit verbalen Gedanken gefüllt, und die Schilderungen ihres Bewusstseinsstroms, ihrer Gedankengänge und gedanklichen Sprünge liefern eine beispiellose Menge an Hinweisen, wie unsere geistigen Stimmen ihre Arbeit verrichten.
In den folgenden Kapiteln werde ich auf all diese Beweisquellen zurückgreifen. Wir werden von kleinen Kindern und von älteren Menschen erfahren, von Sportlern, Schriftstellern, Meditierenden, von bildenden Künstlern und Menschen, die Stimmen hören. Ist es zutreffend, dass kleine Kinder nicht in Wörtern denken? Verschwinden die Stimmen mancher Psychiatriepatienten tatsächlich, wenn sie ihren Mund aufmachen? Ist es möglich, in der inneren Sprache das eine zu denken und zugleich laut das genaue Gegenteil zu sagen? Was geschah im Kopf, Gehirn und Körper der Jeanne d’Arc, als sie eine »schöne, liebliche und leise Stimme« vernahm, die sie ermahnte, die Belagerung von Orléans zu beenden? Wie kommt es, dass die innere Sprache schneller sein kann als das normale Sprechen, ohne dem denkenden Menschen keineswegs gehetzt zu erscheinen? Warum sagen die Stimmen mancher Stimmenhörer so lustige Dinge? Ich werde untersuchen, wie literarische und andere künstlerische Darstellungen des Phänomens mit den Fakten übereinstimmen, die von der wissenschaftlichen Forschung herausgefunden wurden, und wie solch »objektive« Betrachtungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Introspektion abschneiden. Ich werde ein MRT meines Gehirns machen lassen und beobachten, wie es die Gedanken auf seinem Zauberwebstuhl11 hervorbringt. Ich werde die Flüchtigkeit der Stimmen in unserem Kopf beschreiben, aber auch ihre bedeutenderen Bahnen verfolgen. Außerdem werde ich genauer auf die Geschichten mehrerer Menschen eingehen, die Stimmen hören, und herauszufinden versuchen, wie sich das Erlebnis anfühlt, wie man damit umgehen kann und was es über das Wesen des Selbst enthüllt.
Ich hoffe, Sie am Ende dieses Buchs von mehreren Dingen überzeugen zu können. Nämlich dass Selbstgespräche ein Teil der menschlichen Existenz sind und – auch wenn sie keineswegs universell sind – in unserem geistigen Leben viele verschiedene Rollen zu spielen scheinen. Laut einer wichtigen Theorie fungieren die Wörter in unserem Kopf als psychologische »Werkzeuge«, die uns helfen, bei unserem Denken Dinge zu tun, so, wie die Werkzeuge eines Handwerkers Arbeiten ermöglichen, die ansonsten nicht durchgeführt werden könnten. Unsere Selbstgespräche können planen, anweisen, ermutigen, fragen, bedrängen, hindern und reflektieren. Die Menschen, von Kricketspielern bis hin zu Dichtern, führen auf viele verschiedene Arten und mit einer ganzen Reihe sehr unterschiedlicher Absichten Selbstgespräche.
Es leuchtet also ein, dass die Erfahrung viele Formen annimmt. Manchmal scheint die innere Sprache lediglich wie die laut ausgesprochene Sprache zu sein. Bei anderen Gelegenheiten ist sie telegrafischer und komprimierter, eine verkürzte
Version dessen, was wir laut äußern würden. Erst seit Kurzem haben Wissenschaftler begonnen, das Konzept ernst zu nehmen, dass die innere Sprache in verschiedenen Formen daherkommen kann, dass diese verschiedenen Formen der inneren Sprache sich unterschiedlichen Funktionen anpassen können und dass die Varianten des Phänomens auf verschiedene Grundlagen im Gehirn zurückzuführen sind.
Die vielfältigen Formen und Funktionen der inneren Sprache sind absolut sinnvoll, wenn wir betrachten, wie sie sich in der Kindheit entwickelt. Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass die innere Sprache sich entwickelt, während die Gespräche von Kindern mit anderen Menschen »untertauchen« beziehungsweise verinnerlicht werden, um eine stumme Version dieser externen Gespräche zu bilden. Das bedeutet, dass das Denken, das wir in Worten vornehmen, einige der Eigenschaften der Konversationen annehmen wird, die wir mit anderen Menschen führen und die wiederum durch die Interaktionsstile und sozialen Normen unserer Kultur geprägt sind. In den 1930er-Jahren schrieb der spanische Philosoph und Schriftsteller Miguel de Unamuno: »Denken ist, mit sich selbst zu sprechen, und jeder von uns führt aufgrund der Tatsache, dass wir miteinander sprechen müssen, Selbstgespräche.« Ich werde versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass einige der Geheimnisse der inneren Sprache gelüftet werden, wenn wir erkennen, dass sie die Eigenschaften eines Dialogs besitzt.
Der soziale Ursprung der inneren Sprache hilft uns darüber hinaus, die vertraute Vielstimmigkeit des menschlichen Bewusstseins zu verstehen. Wenn wir anerkennen, dass die innere Sprache eine Art Dialog ist, wird klar, weshalb in unserem Geist viele verschiedene Stimmen auftauchen können, genau wie ein Roman die Stimmen verschiedener Figuren mit verschiedenen Perspektiven enthält. Ich werde darlegen, dass diese Annahme uns hilft, einige wichtige Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins zu verstehen, auch die Offenheit für alternative Perspektiven, die eines der Kennzeichen für Kreativität sein könnte. Ich werde dieses Konzept unter Bezugnahme auf die Arbeiten sowohl sprachlicher als auch bildender Künstler untersuchen und erörtern, ob eine wichtige Voraussetzung für Kreativität darin besteht, Selbstgespräche zu führen.
Außerdem möchte ich Sie davon überzeugen, dass diese Auffassung von der inneren Sprache uns hilft, die ungewöhnlicheren Stimmen zu verstehen, die manche Menschen hören. Das Phänomen des Stimmenhörens (beziehungsweise der auditiven verbalen Halluzination) wird gewöhnlich mit Schizophrenie in Verbindung gebracht, tritt aber auch bei vielen anderen psychischen Störungen und bei einer signifikanten Minderheit von geistig gesunden Personen auf. Viele Psychiater und Psychologen sind der Meinung, dass es auf eine Störung der inneren Sprache zurückzuführen ist, durch die die Person dazu veranlasst wird, ihre eigenen inneren Äußerungen fälschlicherweise als Aussagen eines anderen zu interpretieren. Ein Problem besteht darin, dass die Wissenschaft die innere Sprache bis heute als Phänomen nicht ernst genug nimmt. Wenn wir mit einem korrekteren Bild der normalen Stimmen in unserem Kopf beginnen, werden wir am Ende vielleicht besser verstehen, warum manche Menschen Stimmen hören, obwohl niemand in der Nähe ist.
Doch die Chance ist gering, ein solides wissenschaftliches Verständnis dieser Erfahrung zu gewinnen, wenn wir nicht anerkennen, dass auch sie viele verschiedene Formen annimmt. Über die Jahrhunderte hinweg haben die Menschen – von den Mystikern des Mittelalters bis zu den Schöpfern literarischer Fiktion – ihre Erfahrungen mit dem Stimmenhören beschrieben. All diese Erfahrungsberichte müssen im Kontext der Lebensverhältnisse, der Epoche und Kulturen ihrer Entstehung untersucht werden. Das Verständnis für das Stimmenhören setzt voraus, dass wir die sehr starken Beziehungen zwischen dem Stimmenhören und frühen Leiderfahrungen sowie die Folge berücksichtigen, dass das Hören von Stimmen mit Erinnerungen an schreckliche Ereignisse zusammenhängt. Ich werde mit einigen Stimmenhörern sprechen, die der Meinung sind, dass ihre Stimmen als Botschaften aus ihrer Vergangenheit und der ungelösten emotionalen Konflikte verstanden werden sollten, nicht als wertlose Äußerungen eines verwirrten Geistes.
Inzwischen beginnt die Wissenschaft, das Stimmenhören als Phänomen zu verstehen, das von dem Gefühl begleitet ist, mit einer anderen Entität in Verbindung zu treten. Und das hat tief greifende Auswirkungen auf unsere Theorien darüber, wie wir soziale Beziehungen einkalkulieren, sowie auf unser Verständnis der normalen inneren Sprache.
Diese Betrachtungsweise der inneren Stimmen birgt selbstverständlich gewisse Probleme, und für die zukünftige Forschung sind die Wege bestens bereitet. Eine der Herausforderungen bei der Untersuchung der inneren Stimmen ist die Tatsache, dass manche Personen von überhaupt keiner inneren Sprache berichten. Wie funktioniert das Denken in diesen Fällen? Wie kommt es in Gang, wenn keine Sprache vorhanden ist, die es formen kann? Wie verbinden sich die Wörter mit den geistigen Bildern, um die lebhaften, multisensorischen Perspektiven des Denkens zu erzeugen? Es hat den Anschein, als könnten die Stimmen in unserem Kopf sich sowohl positiv als auch negativ auswirken, und die Untersuchung ihrer Entstehung kann aufschlussreich sein im Hinblick auf die Kräfte, die bei der Entstehung unseres Bewusstseins Sprache und Gedanken zusammengefügt haben könnten. Die Auswirkungen sind für alle von uns tief greifend. Könnten wir uns eines Tages zusammentun, um die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, zu verbessern und zu kontrollieren, sodass psychische Erkrankungen der Vergangenheit angehören werden? Können wir uns als Spezies weiterentwickeln und uns von aufdringlichen Gedanken, Irrationalität und Ablenkbarkeit befreien? Möglicherweise, aber dann könnte auch die Kreativität der Vergangenheit angehören.
Doch eines ist sicher, nämlich dass ein besseres Verständnis unserer inneren Stimmen uns mit einer größeren Wertschätzung dafür, wie unser Geist funktioniert, erfüllen und uns klarmachen kann, wie wir mit dem manchmal glücklichen, manchmal lästigen – aber immer flexiblen und kreativen – Gemurmel in unserem Kopf produktiver umgehen können.