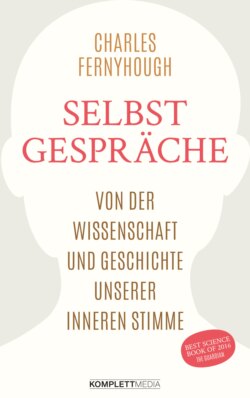Читать книгу Selbstgespräche - Charles Fernyhough - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 3
DIE QUASSELSTRIPPE
Nick Marshall kann die Gedanken von Frauen lesen. Nick (gespielt von Mel Gibson), der durch einen tragischen Unfall (Föhn, Badewanne) in seiner Wohnung in Chicago einen Stromschlag erlitten hat, erwacht mit der unheimlichen Fähigkeit, sich in die Gedanken der Frauen um ihn herum einklinken zu können. Der Film hat den Titel Was Frauen wollen, und die Handlung dreht sich darum, was passiert, wenn die Gesetze der geistigen Privatsphäre außer Kraft gesetzt werden. Für einen arroganten und chauvinistischen Werbefachmann wie Nick ist das Lesen der Gedanken von Frauen ein willkommener Trick. Er hilft ihm nicht nur, die Zahl seiner ohnehin schon beeindruckenden Eroberungen zu erhöhen, sondern ermöglicht es ihm darüber hinaus, die besten Ideen seiner Chefin zu stehlen und sie als seine eigenen auszugeben. Es handelt sich um eine Filmkomödie aus Hollywood, und die Geschichte von Nicks moralischer Herausforderung und allmählicher Humanisierung ist gespickt mit freundlichen Erinnerungen an die Werte, die es sich nicht lohnt, der Karriere zuliebe aufs Spiel zu setzen. Diebstahl ist falsch, aber es hat etwas besonders Abstoßendes, sich mit Gedanken aus dem Staub zu machen, deren Fehlen der Besitzer nicht einmal bemerken kann.
Wie andere Beschreibungen der Kunst der Telepathie erinnert uns auch Was Frauen wollen daran, wie sehr unsere geistige Gesundheit davon abhängig ist, dass unsere Gedanken anderen Menschen nicht zugänglich sind. Wir sehen Nick seine neuen Kräfte zum ersten Mal nutzen, als er nach dem Unfall durch den Föhn in seinem Apartment aufwacht. Seine Putzfrau hat ihn ohnmächtig auf dem Boden liegend gefunden und überlegt, ob er tot sein könnte. Doch ihre Überlegungen sind nicht mehr privat, so wie bisher, sondern Nick hört sie, als würden sie laut ausgesprochen. In dieser speziellen fiktionalen Welt ist das Denken eine Art von Sprechen, ein Sprechen, das (unter normalen Umständen) nur der Denkende hören kann. Nick hört den Gedankenstrom eines anderen Menschen in einer Stimme mit bestimmten Eigenschaften, die Wörter kombiniert, um einen Sinn zu ergeben, so, wie es bei der gesprochenen Sprache der Fall ist.
Vom Soundtrack einmal abgesehen ist ein Film ein intensives visuelles Werk. Nichts würde Regisseure davon abhalten, Gedanken als visuelle Bilder darzustellen – als Mini-Filmclips zum Beispiel, die über dem Kopf einer Figur ablaufen. Doch weder beim Film noch in den anderen Medien wird es gewöhnlich so gehandhabt. Wenn man die Gedankenblasen in einem Comic oder Bildroman betrachtet, sieht man, dass die Gedankenprozesse der Figuren als sprachliche Äußerungen dargestellt sind. Denken ist eine Stimme, so wird uns vermittelt, nämlich die Stimme des Selbst. Es handelt sich um einen stummen Monolog, der, würde er laut ausgesprochen, von jedem verstanden werden könnte, der unsere Sprache beherrscht.
In den folgenden Tagen wandelt sich Nicks Einstellung seinem Gedankenlesen gegenüber von Entsetzen hin zu Akzeptanz. Es gibt eine lustige Szene, in der Nick in dem Bemühen, weitere Beweise zu sammeln, die seinen schrecklichen Verdacht in Bezug auf seine neuen Fähigkeiten bestätigen, den Gehirnströmen seiner beiden hohlköpfigen Sekretärinnen lauschen will, aber feststellt, dass dort absolute Funkstille herrscht. In einer anderen denkwürdigen Szene kann Nick nicht verstehen, was seine Chefin, Darcy, sagt, weil sie zugleich mit Gedanken beschäftigt ist. Denken erfolgt sprachlich, aber was wir denken, ist nicht das Gleiche wie das, was wir sagen. Die Stimme von Darcys Bewusstsein liest von einem anderen Skript als ihre echte Stimme. Aber es handelt sich unverkennbar um eine Stimme. Als Darcy mitten in der Nacht Nick anruft und es dann doch nicht wagt, dem Kollegen, für den sie schwärmt, laut etwas zu sagen, hat Nick das außergewöhnliche Erlebnis, sie am Klang ihrer Gedanken zu erkennen.
Abgesehen von der zweifelhaften Genderpolitik werden in Was Frauen wollen auch bestimmte Dinge über das innere Erleben falsch dargestellt. Wenn wir in einer frühen Szene die Gedanken der Latina-Putzfrau hören, denkt sie in Englisch, obwohl es plausibler wäre, sie würde in ihrer Muttersprache denken. Es stellt sich heraus, dass zwei schwerhörige Frauen, die sich mithilfe von Gesten miteinander unterhalten, in gesprochenem Englisch denken, anstatt in ihrer Gebärdensprache, was wohl wahrscheinlicher wäre. Tatsächlich stellen Gehörlosigkeit und andere Erkrankungen, durch die die normale verbale Kommunikation gestört wird, eine heikle Herausforderung für das Verständnis der Beziehungen zwischen Sprechen, Sprache und Denken dar, wie wir später sehen werden, wenn wir uns mit den Beweisen der inneren Stimmen gehörloser Menschen befassen.
Wenn wir die hohen und niederen Künste verlassen und betrachten, wie Gelehrte den Prozess des Denkens beschrieben haben, finden wir weitere Bestätigungen von dessen enger Verbindung mit Selbstgesprächen. »Für viele von uns«, schreibt der Philosoph Ray Jackendoff, »hört der laufende Kommentar kaum jemals auf.« Andere Philosophen, wie zum Beispiel Ludwig Wittgenstein und Peter Carruthers, waren der Meinung, dass die normale Sprache nichts Geringeres als das Vehikel unserer Gedanken ist. Die vielleicht extremste Ansicht der Einzigartigkeit der inneren Sprache stammt von einem Psychologen. »Wir sind eine geschwätzige Spezies«, schrieb Bernard Baars 1997.25 »Der Drang, mit uns selbst zu reden, ist bemerkenswerterweise unwiderstehlich, wie wir leicht feststellen können, wenn wir versuchen, die innere Stimme so lange wie möglich verstummen zu lassen … Die innere Sprache ist eine der Grundgegebenheiten der menschlichen Natur.« Bei einer anderen Gelegenheit schreibt Baars mit geradezu wissenschaftlicher Autorität über die offenkundige Allgegenwart der inneren Sprache: »Menschen führen, wenn sie wach sind, zu jedem Zeitpunkt Selbstgespräche … Das laute Sprechen nimmt bis zu einem Zehntel der wachen Stunden in Anspruch; die innere Sprache geht dagegen unentwegt weiter.«26
Diese Ansichten konnten nur begrenzt empirisch untermauert werden.27 Zwar berichten manche Menschen, wie zum Beispiel Baars, dass sie ständig damit beschäftigt sind, andere beschreiben deutlich weniger aktive innere Stimmen. In einer Studie mit Teilnehmern, die behaupteten, in einem Kernspintomografen einige Minuten gar nichts zu tun (im sogenannten »Ruhezustand«), fanden die Forscher heraus, dass über 90 Prozent der Probanden in dieser Zeit eine gewisse innere Sprache hörten, aber dass dies nur bei 17 Prozent die dominante Denkweise war.28
Abseits des Hirnscanners belegt Russ Hurlburts DES-Methode, dass die Momente des Piepstons bei manchen Menschen ein hohes Maß an innerer Sprache enthalten (im Fall eines DES-Teilnehmers sogar 94 Prozent), während bei anderen gar keine enthalten ist. Nach Berechnungen des Durchschnitts aus zwei Studien fanden Hurlburt und seine Kollegen heraus, dass bei etwa 23 Prozent der Piepston-Momente innere Sprache vorhanden war, eine Zahl, die die beträchtlichen Unterschiede zwischen den Teilnehmern verschleiert.
Wie wir sehen werden, gibt es Anlass, solchen Zahlen gegenüber skeptisch zu sein. Nicht nur, weil sie im Grunde auf Introspektion basieren, die sich auf verschiedene Weise als problematisch erwiesen hat, sondern vor allem deshalb, weil die Befragung einer Testperson, wie viel innere Sprache sie feststellt, von ihr erfordert, dass sie an einen speziellen Zeitpunkt zurückdenken muss, was zur Folge hat, dass auch die Schwächen der Erinnerung ins Spiel kommen. Selbst die DES-Methode mit ihren sorgfältig hervorgelockten Momentaufnahmen des inneren Erlebens unterliegt den Tücken der Erinnerung. Außerdem müssen wir die gewaltigen Unterschiede im Wortreichtum der menschlichen Gedanken berücksichtigen.29 Manche Menschen verwenden überhaupt keine innere Sprache, und jede Theorie über deren Funktion muss die Tatsache berücksichtigen, dass sich im Kopf mancher Menschen gar keine innere Sprache abspielt.
Untersuchungen belegen jedoch, dass die innere Sprache ein signifikanter Bestandteil unseres geistigen Lebens ist. Ein Viertel bis zu einem Fünftel unserer wachen Momente sind eine Menge der wachen Momente, das heißt: jede Menge Selbstgespräche. Was macht all diese Sprache in unserem Kopf? Die Frage, wann und wie die Menschen in diesen inneren Redefluss eintauchen, könnte zur Klärung beitragen, welchen Nutzen wir daraus ziehen, unsere Gedanken in Worte zu fassen.
Michael spricht im Stillen mit sich selbst. Sein Beruf ist mit viel Warterei verbunden, unterbrochen von Augenblicken höchster Konzentration. Seine Tätigkeit erfordert eine nahezu übernatürliche Fähigkeit, Gedanken und Handeln in freiwillig gewählten Momenten zu kombinieren, die so kurz sind wie die Kniereflexe eines normalen Menschen. Michael ist Profi-Kricketspieler, und während er darauf wartet, dass ein Ball geworfen wird, führt er Selbstgespräche.30
»Ich gehe davon aus, dass ich nicht laut rede«, erzählt er mir, als ich ihn eines Tages nach dem Training im Bezirksstadion treffe. »Aber in meinem Kopf gebe ich Befehle, dass sich mein hinterer Fuß ein klein wenig bewegt, und ich schiebe ihn nur ein bisschen zur Seite. Und dann versuche ich, mir zu sagen: Okay, pass auf den Ball auf, fast so, als ob ich alle Gedanken, die damit verbunden sind, auslöschen wollte.«
Schon lange wurde beobachtet, dass diese Art von Selbstgespräch ein wichtiger Bestandteil von sportlichen Leistungen ist. In einer klassischen Studie aus dem Jahr 1974 lenkte der Sportpädagoge und Schriftsteller W. Timothy Gallwey die Aufmerksamkeit seiner Leser auf ein Szenario, das seiner Meinung nach auf jedem Tennisplatz zu beobachten ist: Die meisten Spieler reden auf dem Platz unentwegt mit sich selbst. »Streck dich nach dem Ball.« – »Ziele auf seine Rückhand.« – »Behalte den Ball im Auge.« – »Beuge deine Knie.« Die Befehle nehmen kein Ende. Für manche ist es, als würden sie im Kopf eine Tonbandaufnahme ihrer letzten Trainingsstunde hören. Dann, nach dem Schlag, geht dem Spieler ein anderer Gedanke durch den Kopf, der etwa wie folgt lauten könnte: »Du ungeschickter Ochse, deine Großmutter könnte besser spielen!«31
Obwohl das sowohl für die Ochsen als auch die Großmütter harsch klingen mag, Gallwey analysierte diese übliche Art der Selbstgespräche hinsichtlich einer Beziehung zwischen zwei Wesen, nämlich dem »Sprecher« und dem »Macher«. Man spricht, und der Körper hört zu. Gallweys Beobachtung bringt eine Unterscheidung zur Sprache, die in jeder Diskussion darüber, weshalb wir Selbstgespräche führen, aufs Tapet kommt: eine Trennung zwischen mir als Sprecher und mir als Zuhörer. Wenn wir wirklich zu uns selbst sprechen, dann muss die dabei verwendete Sprache einige der Eigenschaften eines Gesprächs zwischen verschiedenen Teilen unseres Wesens besitzen.
Das ist eine Idee, deren Ursprung im westlichen Denken mindestens bis Platon zurückreicht. »Ich meine die Rede, die die Seele bei jeder Erwägung mit sich selbst führt«, schrieb er im Theaitetos. »Eine Rede, welche die Seele bei sich selbst durchgeht über dasjenige, was sie erforschen will. Freilich nur als ein Nichtwissender kann ich es dir beschreiben. Denn so stellt es sich mir dar, dass, solange sie denkt, sie nichts anderes tut, als sich unterreden, indem sie sich selbst antwortet, bejaht und verneint.«32 Für William James, der seine Schriften Ende des 19. Jahrhunderts verfasste, war das Hören eines sprachlichen Gedankens während seines Auftauchens ein wesentlicher Bestandteil, um in der Lage zu sein, »seine Bedeutung zu fühlen, während er vorbeizieht«33. Das Selbst spricht, und das Selbst lauscht und versteht dadurch, was gedacht wird.
Der amerikanische Philosoph Charles Sanders Peirce, der etwa zur gleichen Zeit schrieb wie James, verstand das Denken als Dialog zwischen zwei verschiedenen Aspekten des Selbst,34 einschließlich des kritischen Selbst beziehungsweise Ichs, das das präsente Selbst beziehungsweise Mich fragt, was es denn gerade macht.
Für den Philosophen und Psychologen George Herbert Mead beinhaltet das Denken eine Konversation zwischen einem gesellschaftlich konstruierten Selbst und einem verinnerlichten Anderen,35 einem abstrakten inneren Gesprächspartner, der verschiedene Haltungen gegenüber dem, was das Selbst tut, einnehmen kann.
Der Spieler, der auf dem Tennisplatz Selbstgespräche führt, inszeniert etwas, was allen diesen verschiedenen Ansichten über das Denken gemein ist. Der Gedanke, der einen als »ungeschickten Ochsen« bezeichnet, stammt von einem Teil des Selbst, der eine kritische Distanz zu dem, was getan wird, einnehmen kann. Wenn man mit sich selbst spricht, tritt man für einen Augenblick aus sich selbst heraus und nimmt eine Perspektive gegenüber dem ein, was man gerade tut. Beim Sport können die Selbstgespräche laut oder stumm erfolgen.
Bei Gallweys Berichten vom Tennisplatz fallen zwei Arten von Selbstgesprächen auf. Die eine scheint eine kognitive Funktion zu besitzen: Ermahnungen an sich selbst, den Ball im Auge zu behalten und auf die Rückhand des Gegners zu zielen – Aufforderungen, in denen es um den Gebrauch von Wörtern zu gehen scheint, um das eigene Handeln zu regulieren. Die zweite Funktion ist motivierend, typisch für Spieler, die sich nach einem schlechten Schlag rüffeln. »Das war Mist«, würden wir sie vielleicht sagen hören. »Reiß dich zusammen.«
Beide Arten von Selbstgesprächen scheinen beim Sport wichtig zu sein. In einem Interview behauptete der Wimbledon-Gewinner Andy Murray 2013, dass er nie laut mit sich selbst reden würde, weder auf dem Platz noch außerhalb. Doch das änderte sich, nachdem er in einem Finale in Flushing Meadows eine Zwei-Satz-Führung gegen Novak Djokovic, der damaligen Nummer eins, aus den Händen gab. Murray unterbrach das Spiel für eine Toilettenpause und feuerte sich vor dem Spiegel an.
»Ich wusste, dass ich das, was sich innerlich abspielt, verändern musste«, erzählte er der Londoner Times.36»Deshalb habe ich angefangen zu reden. Und zwar laut. ›Du verlierst dieses Spiel nicht‹, sagte ich zu mir selbst. ›Du verlierst dieses Match NICHT.‹ Anfänglich war ich ein bisschen zaghaft, aber dann wurde meine Stimme lauter. ›Du lässt es dir nicht aus den Händen gleiten. Du lässt es dir NICHT aus den Händen gleiten … Gib alles, was du hast. Lass nichts ungenutzt.‹ Zuerst kam ich mir ein bisschen albern vor, aber ich spürte, dass sich innerlich etwas veränderte. Ich war über meine Reaktion erstaunt. Ich wusste, dass ich gewinnen konnte.«
Als Murray auf den Platz zurückkehrte, führte er seine Selbstgespräche fort, nahm Djokovic den Aufschlag ab und erzielte im fünften Satz eine Führung von drei Spielen. Schließlich gewann er die US Open und wurde seit mehr als sechsundsiebzig Jahren der erste männliche britische Grand-Slam-Gewinner im Einzel.
In Trainerkreisen werden Selbstgespräche für so wichtig erachtet, dass sowohl die laut ausgesprochene als auch die stumme Form recht gründlich untersucht wurde. Psychologen haben den persönlichen Zuspruch in so unterschiedlichen Sportarten wie Badminton, Skifahren und Wrestling studiert.37 Doch beim effektiven Einsatz von Selbstgesprächen geht es nicht nur um positive Psychologie und an sich selbst gerichtete Binsenweisheiten. Tatsächlich gelangte eine jüngere Auswertung der Literatur zu widersprüchlichen Ergebnissen in Bezug auf den Wert, sich selbst etwas Nettes zu sagen. Bei Tauchern, die sich um einen Platz im kanadischen Pan-Am-Team bewarben, war die Wahrscheinlichkeit beispielsweise geringer, sich zu qualifizieren, wenn die Bewerber von mehr positiven Selbstgesprächen, wie zum Beispiel Selbstlob, berichteten. Es hat den Anschein, als könnte man sich mit zu viel Liebe überschütten, zumindest beim Wettkampftauchen.
Ein positiveres Bild des Werts von Selbstgesprächen zeichnen experimentelle Studien, bei denen die Forscher die Konditionen manipulieren, unter welchen jemand seine Leistung erbringt, um zu sehen, welche Wirkung sie haben, anstatt die Teilnehmer einfach aufzufordern, darüber zu berichten, was sie während ihrer normalen sportlichen Betätigung tun.
Das Kneipenspiel Darts wird nicht häufig im Labor untersucht, aber eine Studie38 tat genau das und forderte Freiwillige auf, die Pfeile zu werfen und währenddessen verschiedene Arten von stummen Selbstgesprächen zu nutzen. Die Spieler schnitten unter Bedingungen, bei denen sie sich positiv zuredeten (und zum Beispiel sagten: »Du schaffst das«), besser ab als unter Bedingungen, bei denen sie sich heruntermachten (»Du schaffst das nicht«).
Ungeachtet der Wertigkeit des Selbstgesprächs (positiv oder negativ) scheinen erfolgreiche Sportler mehr mit sich selbst zu sprechen: Das war zumindest bei einer Analyse von Turnern39 der Fall, die sich für die amerikanische Olympiamannschaft qualifizieren wollten. Insbesondere die Beobachtungen von Tennisspielern liefern uns einige Gründe, die dafür sprechen, dass die Wertigkeit des Selbstgesprächs damit zusammenhängen könnte, ob es laut oder stumm geführt wird. Wie Sie von Fernsehübertragungen wissen werden, sind viele Äußerungen auf dem Tennisplatz ziemlich negativ. Es kann sein, dass Spieler wie Murray ihre aufmunternden Worte für sich behalten und zum Entsetzen aller Ballmädchen und Linienrichter nur die Rügen und Schelten laut aussprechen. Doch bedenken Sie, dass die Forschung über Selbstgespräche beim Sport in den meisten Fällen nicht zwischen offenem (lautem) und heimlichem (stummem) Sprechen unterscheidet, was zur Folge hat, dass die Hypothese, alle positiven Äußerungen würden für sich behalten, bisher schwer zu überprüfen war.
Auf der langen Liste der Sportarten, bei denen Selbstgespräche untersucht wurden, ist Kricket ein besonders interessanter Fall. Ein Schlagmann muss in der Lage sein, auf die Geschwindigkeit, die Flugbahn und den Aufprall eines Kricketballs zu reagieren, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 km/h auf ihn zukommt. (Ähnliches gilt für Baseball, allerdings wird dieser Fall durch die Tatsache ein wenig erleichtert, dass der Ball nicht auf den Boden aufprallt, bevor er den Schlagmann erreicht.) Psychologen haben berechnet, dass ein Schlagmann, der einem guten Werfer gegenübersteht, keine Chance hat, bewusst zu reagieren.40 Der Ball fliegt so schnell, dass der Annehmende instinktive Reaktionen entwickeln muss, die es ihm ermöglichen, die Flugbahn des Balls und deren Länge früh genug zu erahnen, um einen angemessenen Schlag zu vollführen. Das Erkennen, was in diesem Sekundenbruchteil zu tun ist, nachdem der Ball geworfen wurde, hat mit normalem Denken nichts zu tun; es bleibt für solch einen Luxus schlichtweg keine Zeit.
Das macht das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit in diesen entscheidenden Sekunden nach dem Wurf des Balls maßgeblich, um in der Lage zu sein, die Schläge zu vollführen und das Ausscheiden des Schlagmanns zu verhindern. Genauer gesagt, die Rolle des Schlagmanns setzt voraus, die Aufmerksamkeit schnell und effektiv verlagern zu können. Gewöhnlich sieht man einen Schlagmann wenige Sekunden vor dem Ankommen eines Balls nach allen Seiten auf den Boden blicken. Er ist nicht etwa gelangweilt, unaufmerksam oder sieht sich um, ob etwas Interessanteres zu entdecken ist. Nein, er schätzt das Spielfeld ab, prüft, wo die Feldspieler stehen, und berechnet somit, wo er seinen Run erzielen und verhindern kann, dass er den Ball bei der Annahme wild in die Höhe schleudert. Schon ein oder zwei Sekunden später muss er sein Augenmerk wesentlich begrenzen, vom breiteren Kontext des Spielfelds (es ist zu spät, um sich jetzt damit zu befassen) auf den glänzenden kleinen, von Leder umhüllten Korkball in der Hand des Werfers. Es ist diese Verlagerung der Aufmerksamkeit von umfassend auf verengend, die die Rolle des Schlagmanns so schwierig macht. Mit einem Mal muss er vom allgemeinen Überblick umschalten und sich auf den einen Gegenstand konzentrieren, der ihn bei einem Fehlschlag auf die Bank schicken könnte
Dies ist ein Fall, bei dem Selbstgespräche wirklich helfen könnten. Den Selbstgesprächen von Sportlern wurden schon viele mögliche Funktionen zugeschrieben, doch eine der wichtigsten könnte darin bestehen, die Aufmerksamkeit zu steuern. Ich bin kein Sportler, aber ich fahre Auto und rede beim Fahren häufig mit mir selbst, um damit meine Aufmerksamkeit in die eine oder andere Richtung zu lenken. Wenn ich zum Beispiel auf einen Verkehrskreisel zufahre, könnte ich mir sagen: »Schau nach rechts«, damit ich dem Verkehr, der aus dieser Richtung kommt, die Vorfahrt lasse. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dies tue, ist größer, wenn ich von einer Reise auf den Kontinent zurückkehre, wo ich höchstwahrscheinlich auf der anderen Straßenseite habe fahren müssen. Ich kann es wissenschaftlich nicht beweisen, aber diese wenigen Wörter scheinen mir zu helfen, aufmerksam zu bleiben.
Will man sich also für einen ankommenden Ball hochputschen, erfolgt das am besten mit Wörtern. Doch wenn man Kricketspieler danach fragt, wann und warum sie mit sich selbst sprechen, wird man möglicherweise nicht weit kommen. Wie Russ Hurlburt festgestellt hat, erhält man auf solche Fragen anstelle von Stichproben des Erlebens in der Regel nur Allgemeinplätze darüber, was der Einzelne über das Funktionieren seines Geistes denkt. Und das ist einer der Gründe, warum Russ der Methode von Fragebogen skeptisch gegenübersteht.
Eine neue Studie41 nutzte in dem Versuch, mehr darüber zu erfahren, wie Schlagmänner Selbstgespräche tatsächlich einsetzen, einen originellen Ansatz. Fünf Profi-Schlagmänner eines englischen Bezirksklubs nahmen daran teil. Für jeden Schlagmann wurde eine DVD mit Highlights von sechs kritischen Zwischenfällen eines einzigen Innings zusammengestellt: der Gang auf den Platz für den Schlag; die Konfrontation mit dem ersten Ball, ein schlechter Schlag, eine Auswechslung des Bowlers, die Berechnung der Ballflugbahn und das Ausscheiden. Eine Woche nach ihren Spielen setzte sich jeder Schlagmann zusammen mit einem der Forscher hin (die selbst jeweils hervorragende Kricketspieler waren), um sich jede Episode der Innings auf der DVD anzusehen, und der Spieler wurde aufgefordert, sich daran zu erinnern, was er in jedem dieser Momente zu sich gesagt hat.
Die Resultate zeichnen das Bild einer an sich selbst gerichteten Rede, die eine Reihe von Funktionen erfüllt. Ein Spieler berichtete, dass er sich, als er für den Schlag hinausging, darauf konzentrierte, einen Schlagrhythmus hinzubekommen und nicht darauf zu achten, was auf der Anzeigetafel steht. Ein anderer versuchte, sich für seine Innings durch eine einfache Selbstbestätigung in die richtige Stimmungslage zu versetzen: »Ich habe die Chance, ein Kricketmatch zu gewinnen.« Ein Teilnehmer blickte vor diesem entscheidenden ersten Ball auf die Löcher im Spielfeld und sagte zu sich: »Da ist eines direkt neben meinen Füßen.« Wie jeder Kricketspieler Ihnen bestätigen wird, beruhigt es die Nervosität vor den Innings enorm, wenn man schnell von der Markierung wegkommt und sicher schlägt.
Doch es geht selten lange so gut. Das Schlagen ist eine gnadenlose Aktivität: Ein Fehler, und man kann auf dem Weg in die Kabine sein. Sämtliche an dieser Studie teilnehmenden Schlagmänner sagten aus, dass sie nach einem schlechten Schlag am meisten mit sich selbst sprachen. Ein übliches Muster war eine Selbstbeschimpfung, gefolgt von einem Löffel Zucker. Ein Spieler erklärte, dass seine Selbstgespräche besonders nützlich seien, wenn er bei seinen Innings eine Pechsträhne habe, während ein anderer sich einfach ermahnte, gut zu spielen. Wenn es nicht gut lief, waren Ermahnungen, sich »zu entspannen« und »durchzuhalten« an der Tagesordnung. Vor allem im Laufe des Spiels, wenn die erforderliche Rate der Runs anstieg (es handelte sich jeweils um Limited-Overs-Spiele), sprachen die Spieler zu sich selbst, um sich bei der Vorausberechnung zu helfen, wo der Ball zu treffen sei. Einem Spieler half allein schon die Feststellung der Position der Feldspieler, um instinktiv gute Schläge abzuliefern. Letztlich nutzten sämtliche Spieler die Sprache, um sich nach ihrem Ausscheiden auszuschimpfen, aber auch um ihre Lektionen für das nächste Spiel zu lernen.
Im Großen und Ganzen wiesen die Berichte der Spieler auf unterschiedliche Selbstgespräche hin, die vor den Innings einsetzten und bis nach dem Ausscheiden fortgeführt wurden und insbesondere dann intensiv waren, wenn die Sache nicht gut lief. Was die Herausforderung der Aufmerksamkeitsverlagerung betraf, so sagte sich ein Teilnehmer tatsächlich das Wort »Ball«, wenn er seinen Fokus verengte. Falls Sie die Gelegenheit haben, sich ein Kricketspiel im Fernsehen anzuschauen, könnten Sie etwas Ähnliches live miterleben. Sollten Sie zum Beispiel Eoin Morgan, den Kapitän des englischen Kricketteams, beobachten, wenn er in der Mitte des Matches an die Reihe kommt, dann werden Sie ihn vor jedem Schlag klar zu sich selbst sagen sehen: »Pass auf den Ball auf.« Morgan scheint es für sinnvoll zu halten, an sich selbst gerichtete Wörter einzusetzen und damit in diesem entscheidenden Moment sein Augenmerk zu verengen.
Michaels Beschreibung seiner eigenen Selbstgespräche bestätigen die Ergebnisse der Videountersuchung. Wenn er in Form ist, nimmt das Geplapper in seinem Kopf an Intensität ab, es wird spezifischer und damit nützlicher. Nach einem schlechten Schlag hingegen reagiert er anders: »Ich würde zum Beispiel ›Komm schon‹ zu mir selbst sagen oder mich ein bisschen beschimpfen und zu mir sagen ›Pass auf den Ball auf‹ … Es ist also eher eine emotionale Erinnerung an das, was ich gerade getan habe, und eine Ermahnung, mich zusammenzureißen.«
Unser Treffen findet statt, kurz nachdem er im Erstliga-Kricket seine höchste Punktzahl erzielt hat, nämlich gute Hundert Punkte in einem vier Tage dauernden Bezirksmatch. Ich frage ihn, ob die Selbstgespräche sich verändern, wenn man einem solchen Meilenstein näherkommt. »Wahrscheinlich spreche ich nicht mehr zu mir, aber was ich sage, verändert sich im Laufe der Innings ein bisschen, wenn ich also die Neunzig erreiche, weiß ich, dass mir andere Ängste oder so durch den Kopf gehen.« Außerdem war Michael davon ausgegangen, dass es gefährlich sei, zu viele Selbstgespräche zu führen. »Ich versuche, sie so einfach wie möglich zu halten, damit ich nicht zu viel überlege und nicht zu viel mit mir rede.« Ich frage ihn, ob er die Stimme eines bestimmten Trainers in seinem Kopf hört, die ihm Ratschläge gibt. »Nicht so klischeehaft wie in einer Filmszene, wo man etwas genau mit ihrer Stimme hören kann, aber es gibt definitiv Tipps, die mir Menschen gegeben haben … Ich höre in meinem Kopf definitiv keine spezielle Stimme oder einen bestimmten Trainer. Ich denke vielleicht an einen Augenblick oder eine Erinnerung, und dann ermahne ich mich, dies in der Spielsituation umzusetzen.«
Michaels Bericht scheint Gallweys Beschreibung vom »Sprecher« und dem »Macher« auf dem Tennisplatz zu bestätigen. Dieser innere Trainer mag eher eine Kombination aus verschiedenen Trainingserfahrungen sein als eine spezielle Stimme, und tatsächlich scheinen in allen diesen Beschreibungen von Selbstgesprächen verschiedene Arten innerer Gesprächspartner vorhanden zu sein: ein strenger Kritiker, ein aufmunternder Freund, ein weiser Ratgeber und so weiter.
Bis vor Kurzem gab es nur wenige Versuche, die Vielzahl dieser inneren Gesprächspartner wissenschaftlich zu beschreiben. Dies änderte sich mit einer Untersuchung von Malgorzata Puchalska-Wasyl von der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. in Polen.42 Die Forscherin, die sich mehr auf die alltäglichen Selbstgespräche als auf diejenigen von Sportlern konzentriert, forderte Studenten auf, mithilfe einer Checkliste emotionaler Worte den inneren Gesprächspartner zu beschreiben, mit dem sie sich am häufigsten unterhalten. Diese Angaben wurden im Anschluss einer statistischen Analyse unterzogen, die ähnliche Beschreibungen in Gruppen sortierte.
Vier erkennbare Kategorien der inneren Stimme kamen zum Vorschein: der »treue Freund« (verbunden mit persönlicher Stärke, engen Beziehungen und positiven Gefühlen); der »ambivalente Elternteil« (der Stärke, Liebe und wohlmeinende Kritik in sich vereint); der »stolze Rivale« (der distanziert und erfolgsorientiert ist); und der »ruhige Optimist« (ein entspannter Gesprächspartner, der mit positiven, selbstgenügsamen Emotionen in Verbindung gebracht wird).
Eine Schwäche dieser Eingangsstudie bestand darin, dass sie nicht die ganze Bandbreite der inneren Stimmen berücksichtigte, mit denen die Teilnehmer sprachen, deshalb wurde sie mit Freiwilligen wiederholt, die aufgefordert wurden, die beiden häufigsten Gesprächspartner sowie zwei andere, die unterschiedliche Emotionen repräsentierten, zu beschreiben. Die ersten drei Kategorien traten wieder durch die statistische Analyse zutage, aber dieses Mal wurde der »ruhige Optimist« von einer Kategorie ersetzt, die »hilfloses Kind« genannt und von negativen Emotionen und sozialer Distanz charakterisiert wurde.
Ob wir nun eine dieser Rollen einnehmen, um uns selbst Ratschläge zu erteilen, uns zu trösten oder zu ermuntern, es hat jedenfalls den Anschein, als spiele es eine Rolle, wie wir den Teil des Selbst ansprechen, der zuhört. Bei seiner Aufmunterung vor dem Spiegel sprach Andy Murray sich tatsächlich selbst als andere Person an und sagte bei seinen Ermahnungen »du« anstelle von »ich« oder »mir«. Wenn Menschen aufgefordert werden, von sich mit ihrem Namen oder in der zweiten Person zu sprechen, scheinen sie eine Art Distanz zu dem Selbst zu gewinnen, die sie nicht einnähmen, wenn sie von sich als »ich« sprechen würden.
Dies wurde mithilfe einer Reihe von experimentellen Studien43 untersucht, die von Ethan Kross an der Universität von Michigan in Ann Arbor geleitet wurde und der Frage nachging, welche Wirkung es hat, wenn man in der ersten Person von sich spricht, während man sich auf bestimmte Aufgaben vorbereitet und diese durchführt. Bei einer dieser Aufgaben, ausgedacht, um soziale Ängste hervorzurufen, wurde den Teilnehmern nur eine beschränkte Zeit eingeräumt (fünf Minuten), um sich auf eine öffentliche Rede vorzubereiten – genauer gesagt, um eine Reihe von »Experten« (tatsächlich Mitglieder des Forschungsteams) davon zu überzeugen, dass der Teilnehmer für einen Traumjob qualifiziert sei. Verglichen mit denjenigen, die gebeten wurden, sich auf die Aufgabe vorzubereiten, indem sie davon sprachen, was »ich« tun sollte, schnitten die Freiwilligen, die nicht angewiesen worden waren, von sich in der ersten Person zu sprechen, in ihrer Rede besser ab, sie schätzten ihre Leistung positiver ein und grübelten im Anschluss weniger darüber nach. Das Vermeiden der Bezugnahme durch die erste Person schien den Teilnehmern eine Distanz zu sich selbst zu vermitteln, die es ihnen ermöglichte, ihr Verhalten effektiver anzupassen und vor allem mit Emotionen, wie zum Beispiel sozialen Ängsten, besser umzugehen.
Es scheint klar zu sein, dass der Nutzen bestimmter Arten von Selbstgesprächen sich nicht nur auf den Sport beschränkt. Eines tritt bei all diesen Studien zutage, nämlich dass das Sprechen mit sich selbst viele unterschiedliche Dinge bewerkstelligen kann.
Für einen Sportler kann das Selbstgespräch eine Rolle bei der Regulierung von Handlung und Erregung übernehmen, wenn man sich selbst unter herausfordernden Leistungsbedingungen anspornt und so die Aufmerksamkeit erhöht.
Für alle anderen gilt, dass die an uns selbst gerichtete Rede es uns ermöglicht, uns aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und eine gewisse kritische Distanz zu dem, was wir tun, einzunehmen.
Wie kommt es, dass flüchtige – sogar stumme – Wörter ihre Sprecher so stark beeinflussen können? Um zu verstehen, wie die Wörter in unserem Kopf eine solche Macht gewinnen können, müssen wir uns fragen, wie sie überhaupt dorthin gelangt sind.