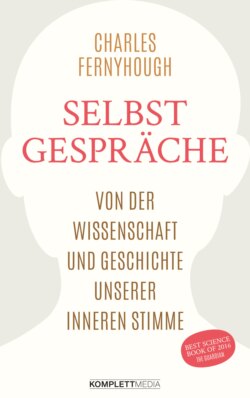Читать книгу Selbstgespräche - Charles Fernyhough - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
DAS GAS AUFDREHEN
Schließen Sie die Augen, und denken Sie. Es spielt keine Rolle, worüber Sie nachdenken: Es kann sich um ein tiefschürfendes oder banales Thema handeln. Halten Sie den Gedanken fest, kosten Sie ihn aus. Spielen Sie ihn in Ihrem Kopf durch. Und jetzt stellen Sie sich eine Frage: Wie war es, diesen Gedanken zu denken? Wir wissen, wie sich bestimmte Arten von geistiger Aktivität anfühlen: das Träumen zum Beispiel oder eine Summe im Kopf auszurechnen. Aber was für eine Aktivität ist das Denken?12 In welchen Varianten kommt es vor? Wie fühlt es sich an, diese normale, aber dennoch absolut bemerkenswerte Leistung zu vollbringen?
Erstens gehe ich nicht davon aus, dass Sie irgendwelche Schwierigkeiten hatten, Ihren Kopf ein oder zwei Sekunden lang zu beschäftigen. (Es wäre deutlich schwieriger gewesen, wenn ich Sie aufgefordert hätte, an nichts zu denken.) Wir denken unentwegt, nicht nur wenn wir Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen haben. Selbst wenn Ihr Gehirn allem Anschein nach eine Pause einlegt, ist Ihr Geist wahrscheinlich alles andere als inaktiv.13 Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, was unsere eigene Innenschau nahelegt: In den meisten unserer wachen Momente werden wir von einem inneren Strom von Gedanken und Eindrücken erfüllt, der unser Handeln steuert, unsere Erinnerungen speichert und den roten Faden unserer Erfahrungen bildet.
Jetzt stellen Sie sich noch ein paar weitere Fragen über den Gedanken, den Sie gerade hatten. Klang es so, als würde eine andere Person sprechen? Falls ja, waren »Sie« diese Person? Fühlte er sich wie irgendetwas an, oder war er nur das Nebenprodukt eines aktiven Gehirns, ohne überragende Qualitäten, die ihn von anderen Gedanken unterscheiden würden? Würden Sie den Gedanken wiedererkennen, wenn er erneut auftauchen sollte? Woher wissen Sie, dass er Ihr eigener war?
Ich bin der Meinung, dass all diese Fragen sinnvoll sind, aber dass man sie nur sehr schwer beantworten kann. Wir haben einen einzigartigen direkten Zugang zu unseren eigenen Gedanken, aber nur zu unseren eigenen. Das führt dazu, dass sie nur sehr schwer untersucht werden können. Es ist vor allem schwierig, sicher zu sein, dass Sie Ihre Erfahrungen verlässlich bewerten, weil Sie Ihre Einschätzungen nicht mit denjenigen anderer Menschen vergleichen können. Im vorherigen Kapitel habe ich einige Gründe für die Annahme aufgeführt, dass die innere Erfahrung vieler Menschen mit jeder Menge Wörtern einhergeht. Aber ist das wirklich der Fall? Wie können wir diese Frage beantworten – und was bedeutet diese Frage überhaupt, wenn es darum geht, nach unserer Innenwelt zu fragen? Wie können wir vorgehen, um den Inhalt unseres Kopfes zu untersuchen?
Der naheliegende Ansatz ist der Versuch, den direkten Zugang zu unserer eigenen Erfahrung zu nutzen. »Warum«, fragt der Philosoph Sokrates in Platons Theaitetos, »sollten wir nicht ruhig und beharrlich unsere eigenen Gedanken prüfen und erwägen, was diese Erscheinungen in uns tatsächlich sind?« Der französische Philosoph René Descartes hatte im 17. Jahrhundert mit dieser Vorstellung keine Probleme. Als er in seinem Winterschlafrock neben dem im Kamin brennenden Feuer saß, befasste er sich mit seinen eigenen Gedankenprozessen und erkannte, dass ihre Existenz das Einzige war, was er nicht infrage stellen konnte. Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. Die Reflexion über seine eigenen geistigen Zustände war das »erste Prinzip« der kartesischen Methode. Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James schrieb im Jahr 1890, dass die Existenz von Bewusstseinszuständen zwar unbestreitbar, sie in uns selbst zu beobachten, aber »schwierig und fehlbar«14 sei. Doch diese Art von Beobachtung sei dennoch möglich. Sie unterscheide sich im Prinzip nicht von jeder anderen Methode, die Welt zu beschreiben. Wenn der Mensch angeleitet werde, sorgfältig vorzugehen, könne er dazu gebracht werden, es besser zu machen.
Es war das Werk des deutschen Psychologen Wilhelm Wundt, das die Innenschau aus dem Philosophensessel ins wissenschaftliche Labor verlagerte. Wundt war der Gründer des ersten wissenschaftlichen psychologischen Labors, 1879 in Leipzig eingerichtet, aber er erlangte auch als Autor des ersten psychologischen Lehrbuchs Berühmtheit.
Wundt unterschied bei seinen Überlegungen über innere Erlebnisse zwischen zwei Arten der Introspektion.15 Zunächst gebe es das, was er als Selbstbeobachtung bezeichnete: jene Art von beiläufiger Beobachtung der eigenen geistigen Prozesse, die jeder Mensch in Angriff nehmen kann. Man braucht kein Descartes zu sein, um am Kamin zu sitzen und über die eigenen Gedanken nachzudenken. Aber es stellt sich die Frage, ob das wissenschaftlich fundiert ist?
Etwas ganz anderes war für Wundt die formalere Kategorie der inneren Wahrnehmung. Die wissenschaftliche Methodik verlangt, dass der Beobachter versucht, sich, wann immer möglich, aus dem Prozess der Beobachtung herauszuhalten, und dies hatte Wundt bei seinem zweiten Ansatz im Sinn, der eine gewissenhafte Trennung des Beobachters vom beobachteten Objekt voraussetzte. Bei Wundts Technik der inneren Wahrnehmung nahm der Wissenschaftler tatsächlich eine klinisch distanzierte Haltung seinen eigenen Gedanken gegenüber ein. Die innere Wahrnehmung war laut Wundt keine solide wissenschaftliche Methode. Doch sie könne nach einer gründlichen Ausbildung der Teilnehmer eine solche werden.
Und Wundt bildete seine Teilnehmer aus. Kritiker der Innenschau vermittelten gelegentlich den Eindruck, dass es sich bei der Leipziger Introspektion um eine ziemlich legere – in Wahrheit kartesische – Reflektion im Lehnstuhl über die eigenen geistigen Prozesse handele. Aber Wundts Selbstbeobachter waren ausgebildete Fachkräfte. Es wurde berichtet, dass ein Mitglied von Wundts Labor nicht weniger als 10.000 introspektive »Erscheinungen«16 gehabt haben musste, um Daten für Forschungsveröffentlichungen beitragen zu dürfen.
Bei der Analyse von William James unterschied sich die Introspektion nicht von jeder anderen Art der Beobachtung; sie konnte gut oder schlecht durchgeführt werden. Man musste eben lernen, es gut zu machen. Nur die Erfahrung zu haben reichte nicht aus, um zu garantieren, dass man irgendeine Fähigkeit besaß, um diese Erfahrung zu beobachten oder zu beschreiben. Andernfalls, so stellte James fest, wären Babys ausgezeichnete Selbstbeobachter.17
Wundts Bemühungen führten zu einer neuen Methodik für die Untersuchung innerer Erfahrungen, die schließlich über den Atlantik nach Amerika gelangte. In den Händen von Wundts Anhängern, wie zum Beispiel Edward B. Titchener, wurde die introspektive Methode begrenzter und mechanistischer, und ihre Schwächen – insbesondere ihre Abhängigkeit von einer nicht nachweisbaren Selbstbeobachtung – gerieten deutlicher in den Fokus.
Mitte des 20. Jahrhunderts stand die anglo-amerikanische Psychologie ganz im Bann der behavioristischen Theorien von John B. Watson und Burrhus F. Skinner und deren Behauptung, dass nur die Messung beobachtbaren Verhaltens eine solide Erforschung des Geistes garantieren könne. Die Selbstbeobachtung schien bereits der Vergangenheit anzugehören. Ein von William James angesprochenes Problem bestand darin, dass Introspektionen immer bis zu einem gewissen Grad Erinnerungen an Erfahrungen waren, nicht etwa die Erfahrungen selbst – und Erinnerungen sind bekanntermaßen mit Fehlern behaftet. Vor allem wurde man sich zunehmend bewusst, dass Erfahrungen nicht beschrieben werden konnten, ohne durch den Akt der Beobachtung selbst verändert zu werden. Der Versuch, über die eigenen Gedanken zu reflektieren, sei, mit den denkwürdigen Worten von James, als »würde man versuchen, das Gas [der Lampe] schnell genug aufzudrehen, um zu sehen, wie die Dunkelheit aussieht«18.
Für viele war die kognitive Revolution, die in den 1950er-Jahren begann und in den folgenden zwei Jahrzehnten an Fahrt gewann, der letzte Sargnagel der Selbstbeobachtung.19 Richard Nisbett und Timothy Wilson überprüften 1977 die Beweislage bezüglich der Korrektheit der Berichte von Menschen über ihre komplizierteren kognitiven Prozesse. Eines der Experimente, die sie unter die Lupe nahmen, war mit Menschen durchgeführt worden, die an Schlafproblemen gelitten hatten. Einigen der Teilnehmer wurde eine »anregende« Tablette verabreicht, ein Placebo, von dem es hieß, es würde die körperlichen und emotionalen Symptome von Schlaflosigkeit hervorrufen, in Wahrheit jedoch keine physiologische Wirkung hatte. Einer anderen Gruppe wurde mitgeteilt, ihre Tabletten (ebenfalls wirkstofffrei) würden sie entspannen. In beiden Fällen enthielten die Tabletten keinerlei aktive Wirkstoffe, aber die Erwartungen der Untersuchungsteilnehmer gegenüber deren Wirkung wurden manipuliert, sodass die Ergebnisse ganz unterschiedlich ausfielen.20
Die Forscher beobachteten, wie jede Gruppe mit ihrer Schlaflosigkeit umging. Wie erwartet, schliefen diejenigen Teilnehmer, denen gesagt worden war, ihre Tabletten würden sie wach halten, schneller ein als gewöhnlich, weil sie ihre erhöhte Wachheit der Wirkung der Tabletten statt ihrer eigenen Schlaflosigkeit zuschrieben. Bei der Gruppe mit den entspannenden Tabletten wurde das Gegenteil beobachtet. Die Teilnehmer dieser Gruppe brauchten tatsächlich länger, um einschlafen zu können. Vermutlich weil sie davon ausgingen, entspannt zu sein, sich aber ganz anders fühlten, was sie zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass sie noch aufgedrehter sein mussten als gewöhnlich.
Doch bei der anschließenden Befragung zeigten die Teilnehmer sehr geringe Einsicht in die psychologische Wirkung der Tabletten und führten die Veränderung ihres Schlafmusters stattdessen auf äußere Faktoren zurück, wie zum Beispiel auf ihr Abschneiden bei einer Prüfung oder auf Probleme mit der Freundin.
Nisbett und Wilson gelangten zu dem Schluss, dass es wenig Sinn hatte, Untersuchungsteilnehmer aufzufordern, ihre eigenen kognitiven Prozesse zu erklären. Trotz der vielen sorgfältigen Beobachtungen der Anhänger der Introspektion ist festzustellen, dass wir erstaunlich wenig wissen, wie unser eigener Geist tatsächlich funktioniert.
Es ist ein schwüler Julitag in Berlin, und Lara überlegt sich, ob sie noch ein Bier trinken soll.
»Ich stellte die leere Flasche ab, und es war, als würde ich denken: Will ich noch eines? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Wörter dachte. Und in diesem Moment war der Piepston zu hören.«
Lara ist eine junge Amerikanerin chinesischer Abstammung aus Los Angeles, die ein Studienjahr in Berlin absolviert. Sie nimmt an einem Experiment teil, für das sie ein kleines Gerät an ihrer Kleidung befestigt bei sich trägt (etwa von der Größe einer Tonkassette). In Zufallsintervallen schaltet sich das Gerät ein und gibt durch einen Ohrstecker ein piepsendes Geräusch ab. Das ist für sie das Signal, darauf zu achten, welche Erfahrung sie in dem Augenblick unmittelbar vor dem Piepsen gemacht hat. Dann muss sie sich in irgendeiner Form, die ihr günstig erscheint, auf einem ihr zu diesem Zweck ausgehändigten Notepad Notizen über den Augenblick der Erfahrung machen. Das tut sie, bis sie Notizen über sechs Signaltöne und sechs Momente der Wahrnehmung gesammelt hat, dann darf sie den Ohrstecker herausnehmen und weglegen.
Am folgenden Tag kommt sie ins Labor und wird ausführlich über diese sechs Augenblicke befragt. Der Vorfall mit dem Bier betraf das dritte Piepsen am ersten Tag ihrer Teilnahme an diesem Experiment. Über diese Bewusstseinsmomente wird sie von Russell T. Hurlburt befragt, dem Entwickler der Methode.
»Genau mit diesen Wörtern?«, fragt Russ.
»Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das meine genauen Wörter waren, weil ich sie mir nicht genau notiert habe … Ich erinnere mich an diesen Augenblick und an das Gefühl, kühles Bier zu trinken, und dass ich es wirklich genossen und mich gefragt habe: Will ich noch eines?«
»Also eine erinnerte Empfindung, ein Bier zu trinken?«
»Ja, und der Gedanke: Will ich mehr von dieser Erfahrung?«
Russ fragt, ob sie noch ein Bier wollte, oder ging es vielmehr um die Erinnerung, das kühle Bier eben genossen zu haben?
»Ich denke, es geht definitiv um beides, weil ich mir diese Frage gestellt habe und anfing, mich daran zu erinnern, um diese Frage zu beantworten, vermute ich.«
Was waren in diesem Augenblick ihre genauen Worte bei diesem Erlebnis? Lara kann sich nicht erinnern. Russ sagt, dass sie sich in Zukunft diese Wörter schnell notieren soll, weil es auf die genauen Wörter ankommt. Wenn wir herausfinden wollen, wie wir in unserem Kopf mit uns selbst sprechen (neben den vielen anderen Dingen, die sich dort abspielen), kommt es auf den genauen Wortlaut an.
»Und hörst du diese Wörter mit einer Stimme?«, fährt Russ fort. »Oder liest du sie, oder siehst du sie, oder …?
»Ja, sie haben eine Stimme, und das ist meine eigene Stimme.«
»Okay. Und ist diese Stimme so, als würdest du die Wörter aussprechen oder als würdest du sie hören oder …«
»Hm, ich denke, es ist, als würde ich sie aussprechen? Aber ich sage sie zu mir selbst, so, als würde jemand eine Frage stellen. Die Sache ist die, dass ich, während ich diese Fragen beantworte, einfach beunruhigt bin, dass sich das, was ich über diese Augenblicke berichte, verändern könnte, weil ich gründlicher darüber nachdenke, verstehen Sie?«
Hurlburt ist einer jener Wissenschaftler, die die Introspektion neu durchdenken.21 Er, ein großer Mann Ende sechzig mit grauen Haaren und einer Brille, begann sein Berufsleben als Ingenieur und arbeitete für eine Firma, die Atomwaffen herstellte. Eigentlich wäre er gern Trompeter geworden. Es war zur Zeit des Vietnamkriegs, und Russ erhielt eine Einberufungsnummer, die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hätte, dass er tatsächlich einberufen worden wäre, deshalb trat er freiwillig der Armeeband in Washington, D. C. bei. Dort fand sein Können als Trompetenspieler einen Einsatz, der einen indirekten und folgenreichen Einfluss auf seine spätere Karriere haben sollte. Er bekam nämlich die Aufgabe zugewiesen, den »Taps« (Zapfenstreich) zu spielen, jene zeremonielle Melodie, die bei Militärbegräbnissen gespielt wird. Seine Aufgabe bestand darin, am Nationalfriedhof Arlington zu warten, bis der Sarg ankam und die Gewehrsalven abgefeuert wurden, um dann den »Taps« über dem Sarg des armen in Vietnam Gefallenen zu spielen. Dann zog er sich diskret in sein Auto zurück, das er unter einem nahen Baum abgestellt hatte, um – noch immer in voller militärischer Montur – auf die nächste Beerdigung zu warten, die frühestens zwei Stunden später stattfand. Somit hatte er jede Menge Zeit, die er nutzte, um sein Auto mit Büchern aus der Bezirksbibliothek von Arlington zu füllen. Er las alles, was Ingenieure aus Zeitgründen gewöhnlich nicht lesen können: Literatur, Poesie, Bücher über die Geschichte und vor allem über die Psychologie. Innerhalb weniger Monate hatte er den gesamten Bestand der Bibliothek zum Thema Psychologie gelesen.
»Dabei habe ich herausgefunden, dass jedes Buch über Psychologie mit der Aussage beginnt: ›Ich werde Ihnen etwas Interessantes über die Menschen berichten‹, und wenn ich dann am Ende des Buchs angelangt bin, sage ich mir: Na ja, ich habe nichts erfahren, was ich für wirklich sehr interessant halte. Ich habe etwas über die Theorie gelernt, aber nichts über die Person.« Denn Russ wünschte sich, etwas über die Alltagserlebnisse der Menschen zu erfahren. »Ich dachte mir, wenn man über diese Dinge bloß Stichproben machen könnte, das wäre gut … Ich fuhr mit dem Truck durch die Wüste oder die ebenen Außenbezirke irgendeiner Stadt und sagte mir: Ich weiß, wie man einen Signaltongeber baut. Als ich bei der Universität von South Dakota ankam, an der ich mein Aufbaustudium absolvieren wollte, sagte der Direktor zu mir: ›Was möchten Sie machen, Russ?‹ Und ich antwortete: ›Ich möchte Stichproben von Gedanken sammeln, und auf dem Weg hierher habe ich herausgefunden, wie ich es machen kann.‹ Der Studienberater war von Russ‹ Idee beeindruckt, aber er war der Meinung, dass die Sache mit dem Signaltongeber technisch nicht durchführbar sei. Deshalb schlug er Russ einen Deal vor: Sollte Russ tatsächlich in der Lage sein, den Piepser zu bauen, würde er die Voraussetzung, dass Russ den Master in Psychologie erwerben müsste (er hatte bereits den Master in Ingenieurswissenschaft) in seinem Fall nicht anwenden und ihm gestatten, gleich das Promotionsprogramm zu absolvieren.
Im Herbst 1973 baute Russ den Piepser und gewann seine Wette. Er begann, sein neues technisches Gerät einzusetzen, und versuchte, die Gedanken seiner Untersuchungsteilnehmer zu erforschen, zunächst durch kurze Befragungen und die komplexen statistischen Analysen, die notwendig sind, damit der so gewonnene Berg an Daten Sinn ergibt. Schließlich wurde ihm klar, dass diese Methode nichts Interessanteres über die Gedanken oder die Menschen hervorgebracht hatte als die der Forscher, die er zuvor kritisiert hatte. Deshalb begann er, sich mehr auf die Qualität der Berichte zu konzentrieren: Auf die Beschreibungen der Gedankenprozesse seiner Teilnehmer und was diese für die jeweilige Person charakteristisch machte.
Seit nahezu vierzig Jahren ist Russ nun schon Fakultätsmitglied an der Universität von Nevada, Las Vegas (UNLV). Er hat seine Karriere der Verfeinerung und dem Testen seiner Methode für die Untersuchung des inneren Erlebens gewidmet, die er Descriptive Experience Sampling (DES) nennt.22 Als er an der UNLV anfing, trug er den DES-Piepser selbst ein ganzes Jahr lang, um herauszufinden, wie er anzuwenden ist. Aufgrund des unübersehbaren Ohrsteckers gingen seine Kollegen auf dem Campus davon aus, dass er schwerhörig sei, allerdings waren viele zu höflich, um ihn danach zu fragen. Bis heute neigen einige Leute auf dem Campus dazu, in seiner Gegenwart lauter zu sprechen.
Für Lara beginnt der Prozess genau an diesem Tag. Am ersten Tag kann sie ihre DES-Momente nicht gut beschreiben, weil das am ersten Tag niemandem gelingt. Russ erklärt, dass die Menschen ihre eigene Erfahrung in der Regel so schlecht beschreiben können, dass die Berichte des ersten Tages allesamt unbrauchbar sind. Aber Lara wird es immer besser machen. Bei der DES handelt es sich um einen iterativen Prozess, wie Russ ihn bezeichnet: Es geht darum, den Probanden und den Interviewer zu trainieren, um die »einzigartige innere Erfahrung des Subjekts mit zunehmender Genauigkeit« beschreiben zu können. Das gelingt nicht ohne Training und ohne die Bereitschaft, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Russ stellt fest, dass es den Menschen in der Regel besser gelingt, ihre Erlebnisse zu verbergen, als sie korrekt zu beschreiben.
Außerdem ist er der Meinung, dass die DES-Methode viele der Probleme umgeht, mit der das Unterfangen der Introspektion verbunden war. Zum einen hat Russ als Forscher kein anderes Ziel, als die Phänomene während ihres Auftretens zu erkunden, worum es sich auch immer handeln mag. Weder geht er die DES-Befragung mit einer Theorie befrachtet an noch steckt die DES ihre Interessenskategorien von vornherein ab, obwohl mit ihrer Hilfe festgestellt wurde, dass bestimmte Arten von Erfahrungen immer wieder auftauchen: Bildsprache, Körperempfindungen und innere Sprache. Russ Hurlburt bezeichnet letztere als »inneres Sprechen«, um den aktiven Charakter hervorzuheben. Aber er ist an der inneren Sprache nicht besonders interessiert, jedenfalls weniger als ich – eine Tatsache, die mich wahrscheinlich zu einem alles andere als idealen Nutzer dieser Methode macht.
Die DES ist vor allem von einer philosophischen Methode inspiriert, die als Phänomenologie bekannt ist. Phänomenologie bedeutet wörtlich die Erscheinungslehre, und durch ein kurioses Paradox war sie eine der Kräfte der Philosophie im 20. Jahrhundert, die zum Niedergang der Introspektion beitrug.
Als Russ mit den quantitativen Ergebnissen, die er durch den Piepser erhielt, unzufrieden war, beschäftigte er sich mit den Werken von Husserl und Heidegger und brachte sich selbst Deutsch bei, um ihre Schriften gründlicher studieren zu können. Für Russ besteht die wichtigste Lektion der Phänomenologie in dem, was als die »Einklammerung aller Vorurteile« bekannt ist: die Fähigkeit des Forschers, die eigenen vorgefassten Meinungen, wie die Dinge sein werden, beiseitezulassen und zu beobachten, wie sie tatsächlich sind. Will man herausfinden, was sich im Kopf eines anderen Menschen abspielt, sollte man nicht vor Beginn der Untersuchung mutmaßen, dass man es bereits wisse. Dies gilt insbesondere für die Untersuchung eines speziellen Phänomens wie der inneren Sprache. Wenn man zu Beginn davon ausgeht, dass die Menschen die ganze Zeit mit sich selbst sprechen, werden die Daten diese vorgefasste Meinung höchstwahrscheinlich wiedergeben.
Trotz der vielen Jahre, die Russ an der DES gearbeitet hat, betrachtet er die Methode nicht als perfekt. Zum einen sind die DES-Berichte stets durch die Erinnerung gefiltert – ein Problem, das William James bereits 1890 vorhersah –, und die Augenblicke des Bewusstseins werden nach dem Ereignis rekonstruiert. Das sind zwei der Gründe, weshalb Russ an den Details von Laras Gedanken über das Bier so interessiert ist. Sie hat festgestellt, dass sie sich unsicher war, was sie genau gedacht hat; es hat den Anschein, als führe der Prozess des intensiven Nachdenkens über die Erfahrung dazu, dass den Probanden Zweifel beschleichen. Das ist ganz normal, stellt Russ fest. »Wir machen den Job so gut, wie wir können«, versichert er ihr. »Wir erwarten nicht von dir, dass du perfekt bist, weil wir das für unmöglich halten. Wir wollen lediglich versuchen, es gut zu machen.«
Ich frage Lara nach den Wörtern, aus denen der Gedanke bestand. War es: Will ich noch ein BIER haben? Oder: Will ich noch EINES? »Ich würde sagen, eines«, antwortet Lara, »definitiv eines.« Das sind die Arten von Details, mit denen wir uns in den folgenden Wochen beschäftigen werden. Lara beschließt, sich im Augenblick, in dem das Piepen ertönt, mehr Notizen zu machen und genauere Angaben über die Momente des Bewusstseins, die sie beschreibt, zu liefern. Lara ist eine unserer ersten Studienteilnehmerinnen, sie ist intelligent und engagiert, beflissen, es zu probieren und zu versuchen, dass es funktioniert. Man kann sich auf so etwas nicht beiläufig oder halbherzig einlassen. Dafür bedeutet es zu viel Arbeit. Für Lara sind die Augenblicke, die sie beschreiben soll, so flüchtig, so fern dessen, was sie normalerweise als Fokus ihrer Gedanken betrachten würde, dass es ihr schwerfällt, darüber zu sprechen. »Weißt du, so, wie wenn man nach einem Traum aufwacht und ihn dann sofort vergisst? So ist das.« Russ ermuntert sie, am Ball zu bleiben. Es wird mit der Zeit einfacher werden. Es wird nie perfekt sein, aber so nahe an »perfekt« heranreichen, wie es die Wissenschaft aktuell vermag.
An diesem Abend kehre ich in mein Hotel zurück und übertrage die Notizen der Befragung. Ein Gewitter geht über Dahlem nieder, das grüne Stadtviertel, in dem sich das Max Planck Institut für Bildungsforschung befindet und in dem wir die Studie durchführen. Jenseits meiner Tätigkeit als Schriftsteller habe ich noch nie so viel Zeit damit verbracht, über die Details der Erlebnisse anderer Menschen nachzugrübeln. Ich schicke die Notizen per E-Mail an Russ, und er antwortet sofort und weist mich auf Fehler hin, die ich gemacht habe, auf Stellen, bei denen meine Erwartungen, wie Laras Erfahrung sein sollte, einer korrekten Wiedergabe im Weg standen. Die Einklammerung aller Vorurteile ist der Dreh- und Angelpunkt. Man muss lernen, diese detaillierten Berichte über die eigenen Erfahrungen zu erstellen, und man muss darüber hinaus lernen, wie man mit denen umzugehen hat, die andere Menschen einem liefern.
Das klingt nach sehr viel Arbeit, allerdings steht auch viel auf dem Spiel. Die Kritiker der Introspektion sind nicht verstummt. Ein Behaviorist könnte behaupten, dass es zu fehlerbehaftet, zu unwissenschaftlich ist, in den Kopf anderer zu spähen, und dass wir Gedanken und Gefühle insgesamt umgehen und uns stattdessen mit Ereignissen befassen sollten, von denen wir »objektiv« berichten können. Ein Anhänger der Introspektion würde darauf antworten, dass eine Wissenschaft des Geistes, die dem subjektiven Erleben keine Beachtung schenkt, inhaltsleer und bedeutungslos ist und weit hinter dem zurückbleibt, was die Wissenschaft eigentlich leisten soll.
Dieses Problem scheint durch die Entwicklung neuer Techniken, mit denen man in das Gehirn blicken kann, noch verschärft zu werden. Das Gebiet der kognitiven Neurowissenschaft, die Methoden der Psychologie mit Techniken zur Untersuchung neuraler Systeme (mithilfe von Bildgebung, elektrischer Stimulation oder der Untersuchung von Gehirnschädigungen) kombiniert, hat in vielen Bereichen begonnen, ihr Versprechen einer einheitlichen Erforschung von Gehirn und Geist einzuhalten. Dennoch wissen wir noch immer nicht, was darin vor sich geht. Menschen können die Aktivierung ihres visuellen Kortex oder die Modulation der Amygdala durch Hippocampusaktivität nicht spüren: Sie erleben visuelle Bilder und emotionale Erinnerungen. Wenn wir uns eine integrierte Wissenschaft des Geistes wünschen, brauchen wir eine Möglichkeit, um an diese Erfahrungen heranzukommen. Wir brauchen die DES oder etwas Ähnliches.
Abgesehen davon stellt sich heraus, dass die Kritik an der Introspektion, die Nisbett und Wilson zugeschrieben wird, am Ziel ziemlich vorbeigeht. Man erinnere sich, dass ihre Abhandlung von 1977 viele Beispiele von Menschen enthielt, die nicht in der Lage waren, verlässlich zu beantworten, weshalb sie bestimmte Entscheidungen getroffen hatten. Menschen können tatsächlich sehr schlecht darin sein, die Gründe für ihr Verhalten zu benennen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht gut darin werden können, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Tatsächlich haben Nisbett und Wilson nach der Überprüfung vorhandener Studien die Tür für zukünftige Methoden offen gelassen, die die Aufgabe angehen könnten, mit ausreichender Sorgfalt Daten über das innere Erleben zu sammeln.
»Die Studien reichen nicht aus«, schrieben sie, »um zu beweisen, dass die Menschen über die damit verbundenen Prozesse niemals korrekt berichten können.«23 Wäre eine Methode in der Lage, einen Erlebnismoment in den Vordergrund zu rücken, ohne ihn zu stören, und sicherzustellen, dass die Teilnehmer sorgfältig darauf achten, was in diesem Moment in ihrem Kopf vor sich geht, und könnte sie außerdem dazu beitragen, dass sie im Nachdenken über dieses Erlebnis besser werden, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Für Hurlburt ist das eine recht gute Beschreibung der DES.
Doch auch diese Methode hat ihre Kritiker.24 Kognitionswissenschaftler bemängeln, dass die DES umständlich und mühsam und dass es darüber hinaus unmöglich sei, von einem einzelnen DES-Teilnehmer auf irgendetwas, was ein bedeutsamer Teil der psychologischen Theorie sein könnte, zu verallgemeinern. Philosophen argumentieren, dass Hurlburt sich zu sicher ist, seine eigenen Mutmaßungen über Erfahrungen ausklammern oder vermeiden zu können, und dass er durch seine Befragung die Prozesse, die er zu beschreiben hofft, beeinflusst. Russ reagiert darauf, indem er hervorhebt, dass man, will man seine Methode ernst nehmen, akzeptieren muss, dass wir uns bei der Beurteilung dessen, was sich in unserem Kopf abspielt, häufig täuschen.
Im Gegensatz zum typischen Forscher auf dem Gebiet der Psychologie, der davon besessen ist, die Gültigkeit der Ergebnisse festzustellen, versteht Russ seine Methode als Entwicklung einer gemeinsamen Sprache zur Erforschung der Eigenheiten der inneren Welt eines Untersuchungsteilnehmers, anstatt die verschiedenen Erfahrungen der Menschen in vorgegebene Kategorien zu quetschen. »Es ist wie bei den Spähern und den Kriegern«, erklärt er mir. »Die Späher sagen dir, wohin du gehen sollst, dann müssen die Krieger dort sein. Man muss beide haben, um den Kampf zu gewinnen. Doch gegenwärtig gibt es in der Psychologie nicht viele gute Späher.«
Mein eigener Eindruck ist, dass die DES-Methode eine nützliche Technik ist, die mit anderen, unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweisenden Methoden kombiniert werden muss. (Tatsächlich halten wir uns in Berlin auf, um die erste Verknüpfung der DES-Methode mit Neuroimaging-Verfahren durchzuführen. In wenigen Tagen wird bei Lara genau zu diesem Zweck im Scanner ein MRT ihres Gehirns erstellt.)
Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, wurden die Stimmen in unserem Kopf mithilfe vieler verschiedener Techniken untersucht, von denen manche so direkt vorgehen wie die DES, andere eher indirekt. Darüber hinaus vermute ich, dass die DES die Häufigkeit der inneren Sprache, die tatsächlich stattfindet, unterschätzen könnte – zum Teil, weil sie hohe Anforderungen stellt, dass Teilnehmer korrekt berichten, welche Wörter ihnen durch den Kopf gingen, und zum Teil aufgrund der kulturellen Annahmen, welcher Art die innere Sprache sein kann.
Im Verlauf meines Aufenthalts in Berlin erhalte ich die Gelegenheit, selbst ein paar Befragungen durchzuführen, und stelle fest, dass ich mich bemühe, meine eigenen Annahmen bezüglich der Erfahrungen der Menschen, mit denen ich spreche, auszuklammern und dass mir das gelegentlich auch gelingt. Als ich Russ für dieses Buch befrage, bin ich mir bewusst, dass ich meine Worte besonders sorgfältig wähle. Welche Auswirkung hat all diese Beachtung der feinen Details der menschlichen Erfahrungen auf den Entwickler der DES? Abgesehen von dem einen Jahr, in dem er den Piepser fast unentwegt getragen hat, scheut er aus Sorge, dass seine eigene Erfahrung sich auf seine Erwartungen, was er bei anderen herausfinden würde, abfärben könnte, davor zurück, ihn weiter zu tragen. Darüber hinaus hat sich die Methode, die er seit nahezu vierzig Jahren entwickelt, auf die meisten Aspekte seines Lebens ausgewirkt. Er hat eine Art und Weise des Umgangs mit Menschen entwickelt, der rücksichtsvoll, zugewandt, aufmerksam und unvoreingenommen ist. Doch Russ kann nicht sagen, ob er infolge der vielen Jahre, in denen er die DES-Methode anwendet, so geworden ist oder ob die DES diese Qualitäten ihres Entwicklers widerspiegelt. Er ist ein vorbildlicher Zuhörer und ein außergewöhnlich aufmerksamer Befrager. »Die Einklammerung aller Vorurteile geht bei mir ziemlich tief«, erzählt er mir. »Die Methode und ich sind eng miteinander verflochten.«
Und welche Auswirkung hat die DES auf diejenigen, die an der Untersuchung teilnehmen? Wenn man den Details der Erfahrungen anderer Menschen so viel Aufmerksamkeit schenkt, verändert sich der Blick auf das farbenfrohe Spektakel des geistigen Lebens des Menschen automatisch. Als Lehrling der DES-Befragung, der inzwischen viele Stunden zugehört hat, wie Menschen ihre Gedanken und Gefühle sehr detailliert beschreiben, hat mir dies eine ähnliche Freude bereitet wie das Lesen von Romanen. Eine der Aufgaben, die Romanschriftstellern und Verfassern von Kurzgeschichten Vergnügen bereitet, ist die Rekonstruktion eines Bewusstseins auf dem Papier. Wenn man einem großen Schriftsteller zusieht, wie er die Details der Erfahrung einer Figur niederschreibt, ist in etwa die gleiche Aufmerksamkeit zu erkennen.
Für diejenigen, die über ihre Erfahrungen berichten, können die Auswirkungen sogar noch tief greifender sein. Die DES kann ein paar eindrucksvolle Beweise liefern, wie die eigenen Vorurteile über die persönlichen Erfahrungen über den Haufen geworfen werden können. Ruth, eine Untersuchungsteilnehmerin, sagte, dass die Teilnahme an der DES-Studie bei ihr mehr Bewusstsein für den Augenblick geweckt und ihr einen Anhaltspunkt geliefert hat, welche Art von Geist sie besitzt, obwohl sie den Prozess anstrengend fand. Der Rückblick auf die Momente des Piepstons offenbarte, dass sie im Allgemeinen viel fröhlicher war, als sie vermutet hatte, und dass sie sich in einem Maß an kleinen Dingen erfreute – wie zum Beispiel an dem Verhalten von zwei ihr vertrauten Rotkehlchen in ihrem Garten –, das sie zuvor nicht wahrgenommen hatte.
Russ selbst hat seit beinahe vier Jahrzehnten beobachtet, welche Wirkung seine Methode auf die Menschen hat. »Die häufigste Antwort der Menschen, die diese Methode angewandt haben, lautet: ›Ich habe mehr über mich selbst erfahren als jemals zuvor, weder durch meine Frau, den Barmann meiner Lieblingskneipe oder meinem Psychologen, bei dem ich seit fünf Jahren in Behandlung bin.‹ Und das ist an sich ziemlich bemerkenswert, weil wir nichts anderes getan haben, als den Versuch zu unternehmen, einen sehr genauen Blick auf die 25 Millisekunden ihrer Erfahrung zu werfen.« Für manche Menschen ist die Anwendung der DES-Methode »wirklich lebensverändernd«, so Russ.
Und zugleich stellen solche Methoden eine gewaltige Herausforderung für diejenigen dar, die das menschliche Erleben wissenschaftlich untersuchen wollen. Was hat es zu bedeuten, wenn man feststellt, dass jemand wie Ruth mit einer falschen Vorstellung ihres eigenen Erlebens die Untersuchung antreten kann? Was die innere Sprache anbelangt, so hat Russ viele Fälle erlebt, bei denen Menschen die DES mit der vorgefassten Meinung begannen, dass ihr Kopf voller Wörter ist (ich würde wahrscheinlich mit der gleichen Vorstellung starten), nur um dann herauszufinden, dass ihre Erfahrung tatsächlich gar nicht sehr verbal abläuft. Wie ist es möglich, dass ich mich »täuschen« kann, was in meinem eigenen Kopf vor sich geht? Eine andere Ansicht, nämlich dass ich darüber, was sich bei meiner Erfahrung abspielt, gar nichts mit Sicherheit wissen kann, scheint ebenso bizarr zu sein – doch genau zu dieser Schlussfolgerung sind einige Kritiker der Introspektion gelangt. Eines ist sicher: Wenn wir eine wissenschaftliche Untersuchung der Stimmen in unserem Kopf durchführen wollen, benötigen wir etwas wie die sorgfältige Beobachtung unserer alltäglichen, flüchtigen Erlebnismomente, etwas wie die DES-Methode.