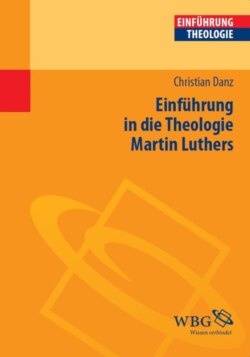Читать книгу Einführung in die Theologie Martin Luthers - Christian Danz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Einleitung 1.1 Methodische Probleme der Lutherdeutung
ОглавлениеHegels Reformationsdeutung
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) hatte in seinen zwischen 1822 und 1831 mehrfach gehaltenen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie in der Reformation und in der Gestalt Martin Luthers die „Hauptrevolution“ erblickt, in der „aus der unendlichen Entzweiung […] der Geist zum Bewußtsein der Versöhnung seiner selbst kam“ ([68], S. 128). Die Reformation ist das weltgeschichtliche Datum, mit dem das Zeitalter der Subjektivität und der Freiheit des Individuums anhebt ([68], S. 130f.; [59]), auch die Gestalt Luthers trägt für Hegel durch und durch die Züge der Neuzeit, welche das dunkle Mittelalter weit hinter sich lässt. Eine solche Deutung des Reformators – der er selbst Vorschub geleistet hat – findet sich freilich nicht nur bei Hegel, sie ist geradezu signifikant für den Protestantismus des 19. Jahrhunderts ([76], S. 11–32). Den Beginn der Moderne machten protestantische Intellektuelle an der Reformation fest, so dass sie ihre eigene Gegenwart in unmittelbarer Kontinuität mit der Reformation sehen konnten.
Ernst Troeltsch
Differenzierter fällt das Urteil von Ernst Troeltsch (1865–1923) zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. In seiner großen Studie über Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit von 1906 unterscheidet er zwischen dem Alt- und dem Neuprotestantismus und ordnet sowohl Luther als auch den Protestantismus des 16. und 17. Jahrhunderts dem Mittelalter zu. Die Neuzeit beginnt Troeltsch zufolge erst mit der Aufklärung und sei – entgegen allem Pathos, mit dem protestantische Theoretiker die Moderne als unmittelbare Folge der Reformation herausstellen –, jedenfalls was die Reformation betrifft, eine Wirkung wider Willen gewesen. Die Stiefkinder der Reformation, die Täufer und Spiritualisten, von den Reformationskirchen in die neue Welt vertrieben und von dort rückwirkend auf die alte Welt, haben die Aufklärung hervorgebracht und mit ihr eine völlig neue Form des Protestantismus und seiner Theologie ([93], S. 268). Der Neuprotestantismus steht Spiritualisten wie Sebastian Franck (1499–1542/43) näher als Luther, welcher für Troeltsch noch völlig in die mittelalterliche Einheitskultur gehört ([92], S. 193).
Die Deutung und geistesgeschichtliche Einordnung Luthers ist – wie die genannten Beispiele zeigen – äußerst kontrovers und vor allem voraussetzungsreich. Das betrifft zum Beispiel schon die umstrittene Frage nach dem sogenannten reformatorischen Durchbruch Luthers, also dem Zeitpunkt, an dem er zu seiner neuen Deutung des Christentums durchgedrungen ist. War Luther bereits 1514 evangelisch, wie die sogenannten Frühdatierer behaupten, oder ist seine grundlegende Entdeckung erst 1518 anzusetzen, so dass er noch katholisch war, als er am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Tür der Schlosskapelle in Wittenberg hämmerte? Sowohl für die Früh- als auch für die Spätdatierung der reformatorischen Entdeckung gibt es gute Argumente. Ihre Plausibilität und Überzeugungskraft hängt indes davon ab, was man genauer unter ‚reformatorisch‘ versteht. Je nach dem Vorverständnis fällt dann auch die Datierung des reformatorischen Durchbruchs aus. Schon hier wird ein methodisches Problem der Deutung der Theologie Luthers sichtbar, welches keineswegs nur die Frage nach dem Zeitpunkt der reformatorischen Wende betrifft. Es tangiert ebenso die geistesgeschichtliche Einordnung der Reformation im Ganzen als auch den Werdegang Luthers sowie die Interpretation seiner Theologie insgesamt ([71], S. 468–543; [76]).
Luther selbst hat seine Theologie nicht in Form eines theologischen Kompendiums oder gar einer Dogmatik vorgelegt. Seine Schriften sind fast ausschließlich Gelegenheitsschriften und verdanken sich jeweils konkreten Anlässen. In den zahllosen Debatten, in denen Luther zur Feder greift, verschiebt und verändert sich naturgemäß auch seine eigene Position. Schon die frühen Vorlesungen repräsentieren eine äußerst komplexe Entwicklung, die anschaulich macht, wie der junge Wittenberger Professor um eine eigene Position ringt. In den innerreformatorischen Streitigkeiten der 1520er und 1530er Jahre unterliegt seine Haltung gegenüber bestimmten Themen einem Wandel. Hiermit ist das methodische Folgeproblem verbunden, wie die Theologie Luthers am sinnvollsten dargestellt werden kann. Zwei Möglichkeiten werden in der Lutherforschung hauptsächlich in den Blick genommen: die systematisch-theologische und die historisch-genetische Darstellung der Theologie Luthers [82].
Systematischtheologische Darstellungen
Nimmt man Gesamtdarstellungen des Werkes des Reformators zur Hand, dann stellt man fest, dass systematisch-theologische Rekonstruktionen überwiegen. Bereits die erste große Deutung von Luthers Theologie aus dem 19. Jahrhundert von Theodosius Harnack (1816–1889) mit dem Titel Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre, die 1862–1886 erschien, ist systematisch-theologisch aufgebaut [32]. Sie war ungemein folgenreich. Die Theologie Luthers wird von Harnack in Form einer Dogmatik dargestellt: die verstreuten und in unterschiedlichen Debattenkontexten stehenden Äußerungen des Wittenberger Theologen werden den entsprechenden Locis der Dogmatik zugeordnet. Im 20. Jahrhundert wurde dieses Verfahren von Erich Seeberg (1888–1945) [43], Friedrich Gogarten (1887–1967) [31] und Paul Althaus (1888–1966) angewandt [26]. Althaus beispielsweise setzt in seiner Theologie Martin Luthers mit dem Problem der Gotteserkenntnis ein, also mit einem klassischen Thema der Prolegomena der Dogmatik und geht dann zu der materialen Dogmatik über, indem er von der Gotteslehre über Anthropologie, Christologie, Ekklesiologie bis hin zur Eschatologie Luthers Aussagen einordnet und systematisiert. Bei dem systematischen Darstellungsverfahren von Luthers Theologie wird allerdings nicht nur eine gegenwärtige Anordnung des dogmatischen Stoffes auf Luther übergestülpt, sondern auch die werkgeschichtliche Entwicklung von dessen Denken ausgeblendet. Emanuel Hirsch (1888–1972) bemerkt in seiner Besprechung von Erich Seebergs 1940 erschienener Schrift Grundzüge der Theologie Luthers nicht zu Unrecht [42], „eine Darstellung von Luthers Theologie als ein gegliedertes Ganzes“ sei eine Aufgabe, die bisher – Seeberg nicht ausgenommen – „noch keinem geglückt ist“ ([70], S. 218).
Historischgenetische Darstellungen
Im Gegensatz zur systematisch-theologischen Darstellung der Theologie des Reformators ist die historisch-genetische werkgeschichtlich orientiert. Die Entwicklung des Denkens von Luther wird in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und auf eine systematische Zusammenschau verzichtet. Einem solchen werkgeschichtlichen Verfahren sind die Lutherstudien Karl Holls (1866–1926) und Emanuel Hirschs ([230]; [135]; [175]) verpflichtet. Holl führt in seinem Buch Luther von 1921 Einzelaspekte von Luthers Theologie in einer an den Quellen ausgewiesenen genetischen Perspektive vor [71]. Martin Brecht (geb. 1932) hat es in seiner großen dreibändigen Lutherbiographie unternommen, die Entwicklung des Reformators von den Anfängen bis zur Entfaltung des reformatorischen Programms in einem breiten geistesgeschichtlichen und politisch-gesellschaftlichen Rahmen nachzuzeichnen [23]. Man muss allerdings sagen, auch eine werkgeschichtliche und biographische Darstellung des Werkes des Reformators kommt nicht ohne steuernde Kategorien aus. Die Einheit eines Werkes oder einer Biographie, das zeigen zum Beispiel die Ausführungen von Brecht, liegt nicht einfach vor, sondern sie ist in einem hohen Maße eine Konstruktion, deren Einheitsprinzipien alles andere als selbstverständlich sind. Man braucht nur eine ältere katholische Lutherbiographie neben die von Brecht zu legen, um zu sehen, wie die eigenen Interessen die Anordnung und Interpretation des historischen Stoffes prägen. An den oben bereits erwähnten höchst unterschiedlichen Einordnungen der Reformation durch Hegel und Troeltsch wurde das in Frage stehende Problem bereits sichtbar.
Weder eine Darstellung der Theologie Luthers noch die von anderen historischen Begebenheiten und Ereignissen kann gegenwartsbezogene Interessen ausschalten. Der Versuch, das vergangene Geschehen so nachzuzeichnen, wie es wirklich gewesen ist, stellt eine Abstraktion dar, die verkennt, dass man sich geschichtlichen Gestalten nur aus der jeweils eigenen Gegenwart zuwenden kann. Lutherdarstellungen sind gegenwärtige Konstruktionen, die freilich an dessen Texten und an der geistes- und religionsgeschichtlichen Entwicklung überprüft werden müssen und selbst schon in der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Reformators stehen ([57]; [90]).
Um den methodischen Schwierigkeiten einer angemessenen Rekonstruktion der Theologie Luthers Rechnung zu tragen, hatte Bernhard Lohse (1928–1997) den Versuch unternommen, die werkgeschichtliche Entwicklung des Denkens des Reformators mit einer systematischen Zusammenschau der Hauptpunkte von dessen Theologie zu verzahnen ([37]; [82]). Im ersten Teil seiner Studie geht er der Entwicklung des Wittenberger Theologen im Horizont wichtiger zeitgenössischer theologischer Traditionen, grundlegender Stationen seines Werdegangs sowie den Kontroversen nach, die für die Herausbildung von dessen theologischem Denken relevant waren. Der systematischen Zusammenschau von Luthers Theologie ist der zweite Teil gewidmet. Er ist an dem Aufbau einer theologischen Dogmatik orientiert.
Die vorliegende Einführung in die Theologie des Reformators stellt zunächst Grundzüge seines Denkens in einer werkgeschichtlichen Perspektive dar und entfaltet sodann vor diesem Hintergrund dessen zentrale Themenfelder. Auf eine systematische Zusammenschau von Luthers Theologie wird verzichtet, auch wenn mit dem Bußgedanken sowie der theologia crucis (Kreuzestheologie) Motive benannt werden, denen eine Schlüsselfunktion für sein theologisches Denken zukommen.