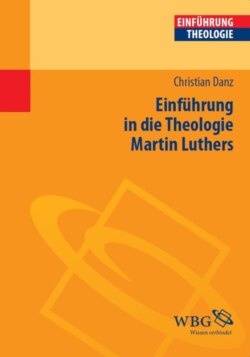Читать книгу Einführung in die Theologie Martin Luthers - Christian Danz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Zum Stand der Lutherforschung
ОглавлениеDie Interpretationen der Theologie des Reformators sowie seines Werdegangs sind immer ein Ausdruck der jeweiligen Zeit, in der sie geschrieben wurden. Insofern spiegeln sie auch ausnahmslos zeitgenössische theologische Optionen wider ([96], S. 1–3; [54]; [91]). Das ist indes nicht überraschend, als die Auseinandersetzungen mit der Gestalt des Reformators in einem hohen Maße der Selbstverständigung des Protestantismus über seine eigene Identität dient. Auch da, wo wie bei Troeltsch der Abstand zwischen der Zeit Luthers und der eigenen Gegenwart in den Vordergrund rückt, geht es um das Selbstverständnis des Protestantismus.
Anfänge der Lutherforschung
In der lutherischen Theologie des 16. und 17. Jahrhunderts ist der Wittenberger Reformator zwar die zentrale Bezugsgestalt, aber zu einer historischen Erforschung seines Werkes kommt es freilich noch nicht ([49]; [85]). Erste Ansätze hierzu bilden sich im Jahrhundert der Aufklärung heraus. Der Hallenser Theologe Johann Salomo Semler (1725–1791) unterscheidet zwischen Luther und der altprotestantischen Theologie und knüpft auf der Grundlage seiner historischen Theologie an das Schriftverständnis des Reformators an [87]. Geradezu im Sinne eines Vorreiters der Aufklärung bezieht sich Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) auf den Wittenberger. Er habe die Menschheit vom Joch der Tradition befreit, nun müsse es aber darum gehen, „uns von dem unerträglichern Joche des Buchstabens“ zu erlösen. „Wer bringt uns endlich ein Christentum, wie du es itzt lehren würdest; wie Christus es selbst lehren würde!“ ([79], S. 442)
Im Streit um seine Versöhnungslehre beruft sich der Erlanger Theologe Johann Christian Konrad von Hofmann (1810–1877) gegenüber seinen Widersachern ausdrücklich auf Unterschiede zwischen Luther und dem Altprotestantismus ([88], S. 685–692). Damit wird von ihm methodisch die Differenz zwischen dem Wittenberger Reformator und seinen Nachfolgern in die Debatte eingeführt. Die Lutherdarstellung von Theodosius Harnack, welche die Versöhnungslehre in den Fokus rückt, wendet sich gegen von Hofmann. Eine Deutung der Theologie des Reformators, welche zwischen diesem und dem dogmatischen Lehrbegriff seiner Epigonen unterscheidet, arbeitet der Göttinger Theologe Albrecht Ritschl (1822–1889) in seinem Hauptwerk Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung aus [48]. Ambivalent fällt das Urteil Adolf von Harnacks (1851–1930) in seiner Dogmengeschichte aus. Zwar habe der Wittenberger Reformator ähnlich wie zuvor Augustin (354–430) die Innerlichkeit in der Religion (wieder)entdeckt, aber zugleich das dogmatische Christentum der Alten Kirche wiederbelebt. „Derselbe Mann, der das Evangelium von Jesu Christo aus dem Kirchenthum und dem Moralismus befreit hat, hat seine Geltung in den Formen der altkatholischen Theologie verstärkt, ja diesen Formen nach Jahrhunderte langer Quiescirung erst wieder Sinn und Bedeutung für den Glauben verliehen.“ ([67], S. 814; [94]; [47])
Karl Holl
Als Begründer der Lutherforschung im eigentlichen Sinne darf der Berliner Kirchenhistoriker Karl Holl gelten. 1921 legte er unter dem Titel Luther eine Sammlung von Aufsätzen über die Theologie des Reformators vor, die eine breite Wirkung erzielte und nach wie vor zu den Standardwerken der Forschung gehört ([71]; [95]). Die gedankliche Dichte von Holls Lutherbuch resultiert aus einer Verknüpfung von historischer Rekonstruktion und systematischem Interesse. Die Rückbesinnung auf Luther dient der Steuerung der eigenen, als krisenhaft erfahrenen Gegenwart. Holls Studien sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zunächst arbeitet er die systematische Problemstellung Luthers heraus. Im Zentrum der Theologie des Wittenberger Reformators steht die Rechtfertigungslehre. Mit hoher methodischer Präzision rekonstruiert der Berliner Kirchenhistoriker das Werden von Luthers Verständnis der Rechtfertigung des Menschen durch Gott anhand der frühen Texte, insbesondere der frühen Vorlesungen. Dabei verknüpft Holl in seiner Deutung der Rechtfertigungslehre Luthers eine Erfahrungsdimension mit einer theozentrischen Perspektive. Der Mensch erfährt sich als der Gemeinschaft mit Gott völlig unwürdig. Dass Gott aber den Menschen anerkennt und Gemeinschaft mit ihm stiftet, ist die Erfahrung der Rechtfertigung. Der Ort des Gottesverhältnisses ist für Holl das Gewissen des Menschen. Luthers Religion sei deshalb, wie Holl der Theologie des 20. Jahrhunderts einschärfte, in ihrem Kern eine sittlich bestimmte Gewissensreligion ([71], S. 1–110).
Für seine Deutung der Theologie des Reformators kommen Holl zwei wichtige Ergebnisse der vorangegangenen Forschung zugute: Einmal die seit 1883 erscheinende kritische Gesamtausgabe der Werke Luthers. Durch die Weimarer Ausgabe erhielt die Lutherforschung eine methodischen Standards genügende Textgrundlage. Zweitens wurden Luthers frühe Vorlesungen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt. Seine Römerbriefvorlesung von 1515/16 veröffentlichte Johannes Ficker (1861–1944) im Jahre 1908 [13]. Der Forschung wurden dadurch Texte zugänglich, die in den früheren Jahrhunderten unbekannt waren und die es nun erlaubten, die Entwicklung der Theologie Luthers von seinen Anfängen an zu rekonstruieren. Holl ist der erste, der die neuen Quellen auswertet und zur Deutung von dessen Theologie heranzieht.
Holl-Schule
Die weitere Lutherforschung hat der Berliner Kirchenhistoriker entscheidend geprägt und die Themen vorgegeben, die im 20. Jahrhundert bearbeitet wurden. In den Untersuchungen von Holl und seinen zahlreichen Schülern – Emanuel Hirsch, Hanns Rückert (1901–1974), Heinrich Bornkamm (1901–1977) ([55]; [56]) – trat für die Folgezeit der junge Luther in den Mittelpunkt des Interesses [22]. Zahlreiche Studien zu dessen Theologie und zu der Frage des reformatorischen Durchbruchs erschienen in den 1920er und 1930er Jahren, so zum Beispiel die Untersuchung Die Anfänge von Luthers Christologie nach der 1. Psalmenvorlesung des Hirsch-Schülers Erich Vogelsang (1904–1944), die nach wie vor als ein Standardwerk einzustufen ist [208].
Lutherforschung nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg hat sowohl an die Resultate von Holl und seiner Schule angeknüpft als auch Modifikationen an dem von ihm geprägten Lutherbild vorgenommen. In der Kritik an Holls pointierter These von der Gewissensreligion Luthers spiegelt sich allerdings auch die theologische Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wider. Unter dem Eindruck der Theologie Karl Barths (1886–1968), die nach dem Zweiten Weltkrieg zur dominierenden Universitätstheologie an den deutschsprachigen Theologischen Fakultäten avancierte, und ihrer Betonung des Wortes Gottes sowie des strikten Gegensatzes von Gott und Welt verfiel Holls Verständnis der Gewissensreligion Luthers der Kritik. Von theologischem Zeitkolorit sind zahlreiche der Lutherdeutungen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Am deutlichsten ist das in der Studie von Ernst Bizer (1904–1975) der Fall, die 1958 unter dem Titel Fides ex auditu erschien [53]. Bizer untersucht die theologische Entwicklung des jungen Luther von der ersten bis zur zweiten Psalmenvorlesung. Im Unterschied zu Holl setzt er den reformatorischen Durchbruch nicht schon in der ersten Psalmenvorlesung an, sondern erst 1518. Freilich spricht Luther bereits in den Dictata super Psalterium von der iustitia Dei als einer Gabe Gottes, aber diese frühe Deutung der Gerechtigkeit Gottes steht, wie Bizer zu zeigen versucht, noch ganz im Horizont einer dem Mittelalter verbundenen Demutstheologie. Deshalb sei das Verständnis der Rechtfertigung bei dem jungen Luther noch vorreformatorisch, genauer eine monastische Humilitas-Theologie ([23], Bd. 1, S. 215–230; [103]). Grundlegend für Bizers Interpretation von Luthers Entdeckung ist die Annahme, unter dem eigentlich Reformatorischen sei das Wort Gottes als Gnadenmittel zu verstehen ([53], S. 154–160). Diese Deutung des Reformatorischen trägt jedoch deutlich die Spuren der Wort-Gottes-Theologie Karl Barths.
Gerhard Ebeling
Die Lutherforschung der 1960er und 1970er Jahre hat mit Ausläufern bis heute darum gestritten, ob die reformatorische Entdeckung früh oder spät zu datieren sei. Entscheidende Impulse erhielt die Diskussion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem durch Gerhard Ebeling (1912–2001) ([118]; [65]). Die Untersuchungen Ebelings lassen sich in ihrer Bedeutung nur mit denen von Karl Holl vergleichen. Wie der Berliner Kirchenhistoriker verbindet der Tübinger und Züricher Theologe einen historischen Zugriff auf Luther mit einer systematischen Fragestellung. Im Unterschied zu Holl, der die Rechtfertigung und den Gewissensbegriff ins Zentrum der Theologie Luthers gerückt hatte, tritt bei Ebeling die Lehre von der Schrift in den Blickpunkt. Wegweisende Untersuchungen zur Herausbildung von Luthers Schriftverständnis und seiner Hermeneutik verdanken wir Ebeling ([117]; [65], Bd. 1, S. 132–195).
Römisch-katholische Lutherforschung
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich auch eine breite katholische Lutherforschung etabliert. Die neuere römische Lutherforschung ist von der traditionellen Polemik gegenüber Luther, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Friedrich Heinrich Suso Denifle (1844–1905) [58] und Hartmann Grisar (1845–1932) zu finden ist [66], abgerückt und versucht, vor dem Hintergrund breiter Quellenforschung ein Lutherbild zu zeichnen, welches freilich auch in den 1960er und 1970er Jahren noch eine unverkennbare römisch-katholische Färbung trägt. Zu nennen sind insbesondere Joseph Lortz (1887–1975) [83], Erwin Iserloh (1915–1996) ([74]; [73]; [72]) und Otto Hermann Pesch (geb. 1931) ([40]; [86]). Sie gehen allesamt davon aus, dass die spätmittelalterliche Theologie und Frömmigkeit, welche Luther bekämpft hatte, gar nicht wirklich katholisch gewesen sei. Die Kritik Luthers an der spätmittelalterlichen Kirche wird als berechtigt anerkannt. Der Reformator sei – so die von den genannten Autoren gezogene Konsequenz – dem wirklichen und wahren Katholizismus enger verbunden, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Spaltung der Kirchen infolge der Reformation sei mithin auf historische Kontingenzen zurückzuführen, habe aber keinen Anhalt an den theologischen Kernthemen. Hinter solchen Lutherbildern – das wird schnell deutlich – steht eine bestimmte Auffassung von Ökumene, welche die Differenzen zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus als überholt verstehen möchte. Nun, da die Missstände in der Katholischen Kirche beseitigt sind, stehe auch einer Vereinigung beider Kirchen nichts mehr im Wege.
Haupttendenzen der neueren Forschung
Die neuere Forschung zu Luther ist dadurch ausgezeichnet, dass sie das Werk des Reformators stärker in seinen geistes-, mentalitäts- und sozialgeschichtlichen Horizont rückt und vor ihm versteht. Fünf Haupttendenzen der gegenwärtigen Debatte zeichnen sich ab ([78]; [77]). Zunächst wird in der gegenwärtigen Forschung Luther wesentlich stärker, als es früher der Fall war, in den Gesamtkontext der Wittenberger Universität gerückt. Themen wie Luther und Philipp Melanchthon (1497–1560) ([52]; [75]; [62]), Johann von Staupitz (1465–1524) [97] oder Nikolaus von Amsdorf (1483–1565) [61], Justus Jonas (1493–1555) [60] oder Georg Rörer (1492–1557) [84] treten in den Blickpunkt der Forschung. Sodann hat sich die Forschung in den letzten Jahren intensiv dem späten Luther zugewandt. In der Lutherforschung im Anschluss an Holl wurde primär der junge Luther und sein Werdegang hin zum reformatorischen Durchbruch untersucht. Auch heute noch hat das Spätwerk Luthers keine so hohe Aufmerksamkeit erfahren. Dabei geht es vor allem um Fragen des Übergangs von der Theologie des späten Luther zur Theologie des Altprotestantismus, also um Fragen, die mit der Konfessionalisierung in einem Zusammenhang stehen und höchst kontrovers diskutiert werden ([64]; [63]). Drittens fragt die neuere Forschung nach den geistigen Wurzeln des jungen Luther. Während die Deutungen in den Bahnen der Theologien Albrecht Ritschls und Karl Barths die Frage nach dem Einfluss der spätmittelalterlichen Mystik auf das Werk des Reformators weitgehend marginalisiert hatten, ist diesem Hintergrund in den letzten Jahren stärker nachgegangen worden ([124]; [50]). Eine vierte Tendenz der gegenwärtigen Lutherforschung liegt in der Auseinandersetzung mit der Gesamtdeutung Luthers durch Ebeling. Ebeling hatte in einer Vielzahl von Einzelveröffentlichungen ein aus den Quellen erarbeitetes Lutherbild von eindrucksvoller Geschlossenheit vorgelegt [30]. In sein Lutherbild lassen sich jedoch zahlreiche von der neueren Forschung herausgearbeitete Aspekte, wie die Bedeutung der Mystik, nur sehr schwer eintragen. Und schließlich wird fünftens nach der Rolle Luthers für die Bekenntnisbildung innerhalb der evangelischen Kirchen gefragt [81].