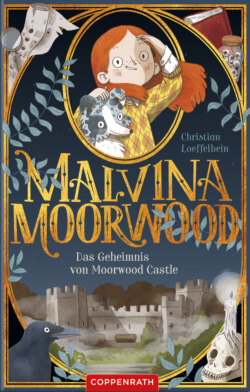Читать книгу Malvina Moorwood (Bd. 1) - Christian Loeffelbein - Страница 14
ОглавлениеZunächst musste ich erst mal den Ball flach halten, um nicht weiter Aufsehen zu erregen und am Ende noch irgendwelche Strafen wie Zimmerarrest zu kassieren. Deshalb war ich sehr froh, dass ich Mamas chinesische Vase nicht zerdeppert hatte. Überhaupt galt es jetzt, sich von Mamas unbeschreiblicher Coolness eine Scheibe abzuschneiden.
Am nächsten Tag stapfte ich also mit gleichmütigem Gesicht in die Küche und wünschte Tante Frida, die am Herd stand und in einer Pfanne Speck brutzelte, einen guten Morgen. Das Rührei war schon fertig und stand in einer Schüssel auf der Anrichte. Ich schnappte mir einen Toast und eine nicht allzu kleine Portion Rührei und verzog mich damit an den hintersten Winkel des Esstischs, gewissermaßen in die Schmollecke.
Das klappte prima.
Opa kam und legte mir einen seiner starken Arme auf die Schultern.
»Was sein muss, muss sein, das ist nun einmal so, meine Kleine«, sagte er.
»Warum muss es sein?«, fragte ich.
Eine Weile starrte Opa auf mein Rührei, und ich dachte schon, er wollte es mir wegfuttern, aber dann sagte er nur: »Wir haben kein Geld mehr, Malvina, und Moorwood verfällt so langsam. Der Dachstuhl muss renoviert werden, sonst stürzt er ein. Der Keller ist noch baufälliger. Und wir können das nicht bezahlen.«
Wenn Opa mich Malvina nannte, dann meinte er all das, was er um meinen Namen herum äußerte, ernst. Sehr ernst. Eigentlich nannte er mich nur Malvina, wenn er sauer auf mich war. Zum Beispiel, wenn ich am Waffenschrank herumhantiert oder Poldi einen seiner Orden umgehängt hatte.
Widerworte waren jetzt also eher nicht angebracht, trotzdem konnte ich sie mir nicht ganz verkneifen: »Papa und Onkel Bob haben doch die Reitschule. Und Mama ist Zahnärztin und bohrt ganz Moorwood für Geld in den Zähnen herum. Und du kriegst eine Pension oder wie das heißt, das haben wir in der Schule gelernt, alle alten Leute kriegen so was. Und Tristan könnte sich auch mal nützlich machen und arbeiten gehen. Er könnte bei McDonald’s Hamburger braten und ich würde mein ganzes Taschengeld …«
Opa drückte mich kurz an sich. Er drückte ziemlich doll.
Und da fiel mir noch etwas ein, weil ich gerade an den Waffenschrank gedacht hatte. Es gab nämlich noch so einen Schrank, drüben im Schloss. Da lagerten Opas antike Gewehre und Flinten. Und die waren echt was wert, das hatte Opa mir selbst mal gesagt.
»Du könntest dich von deiner antiken Waffensammlung trennen«, schlug ich vor.
Opa lachte einmal kurz, aber so richtig fröhlich klang es nicht.
»Eher erschieße ich mich«, sagte er dann, wurde aber sofort wieder ernst.
»Das reicht alles nicht, meine Süße. Allein das Dach kostet Millionen.«
Opa hatte sehr leise gesprochen, deswegen verstand ich, dass es Melonen kostete. Das war witzig, aber mir war nicht zum Lachen zumute.
Opa auch nicht.
Er stand auf, goss sich eine Tasse Tee ein und ging dann aus der Küche.
Als Nächstes kam Tristan ins Zimmer, gefolgt von Onkel Bob, der sogleich die Kaffeemaschine anschmiss, weil er Tee nicht ausstehen konnte.
Tristan setzte sich neben mich. Genau wie Opa legte er seinen Arm um meine Schulter.
»Das wird schon alles, Schwesterherz«, erklärte er vergnügt. »Wenn wir die Hütte erst mal vertickt haben, dann haben wir richtig Asche.«
»Asche interessiert mich nicht«, brummelte ich. »Ich will hier wohnen bleiben.«
»Ach, komm«, sagte Tristan und warf einen gierigen Blick auf mein Rührei.
Ich umfasste die Gabel etwas fester und machte mich bereit, mein Frühstück zu verteidigen, aber Tristan hatte flinke Finger und plötzlich Ei im Mund.
»Die Bude hier kracht demnächst zusammen«, verkündete er kauend. »Da ist es besser, wir wohnen woanders.«
»Geh lieber Burger braten«, sagte ich, »und lass mich in Ruhe.«
Den ersten Teil des Satzes verstand Tristan nicht, aber er ließ mich trotzdem in Ruhe und verzog sich.
Seinen Platz nahm Papa ein, der während des tiefsinnigen Gesprächs mit meinem Bruder zusammen mit den Zwillingen die Küche betreten hatte. Und wieder hatte ich einen männlichen Arm auf der Schulter liegen.
»Es geht leider nicht anders, Mäuschen«, sagte er.
»Ja, ja«, antwortete ich. »Hat mir Opa auch schon erklärt. Wir haben kein Geld für das Dach.«
Papa seufzte.
Er hatte schlecht geschlafen und sah ziemlich zerknittert aus. Das geschah ihm ganz recht, fand ich, aber er tat mir auch ein bisschen leid. Trotzdem sagte ich mit einem Anflug von Bockigkeit in der Stimme: »Lieber ein Schloss ohne Dach als gar kein Schloss.«
Papa seufzte erneut.
Bildete ich mir das nur ein oder schielte auch er auf mein Rührei? Vorsichtshalber stopfte ich mir eine große Portion davon in den Mund.
»Es ist nicht nur der Dachstuhl«, sagte er. Wie Opa sprach er sehr leise. »In den Keller sickert Moorwasser ein. Das ganze Gebäude müsste auf ein neues Fundament gestellt werden. Das kostet Millionen.«
Da waren sie wieder, die Melonen.
Von Dächern und Kellern und Fundamenten hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich wusste nur, dass unser Schloss schon seit Jahrhunderten da stand, wo es stand, und das offenbar ohne irgendwelche kostspieligen Baumaßnahmen. Aber da ich ja keinen Ärger machen wollte, hielt ich einfach die Klappe und schlürfte etwas von dem Kakao, den mir Mama vor die Nase gestellt hatte.
Kurz darauf saß sie neben mir, während Papa versuchte, sich mit Onkel Bobs frisch gebrühtem Kaffee in Stimmung zu bringen.
»Wir müssen jetzt alle vernünftig sein, Liebes«, sagte Mama und nickte mir aufmunternd zu. Offensichtlich war sie der Ansicht, dass ich für heute Morgen genug Arme auf meiner Schulter gehabt hatte, denn sie unterließ es, mir auf die Pelle zu rücken.
»Willst du was von meinem Rührei?«, bot ich an.
Mama schüttelte den Kopf und stand auf.
»Ich muss los«, sagte sie.
Das war mein Stichwort. »Nimmst du mich mit?«
»Was willst du denn so früh am Morgen in Moorwood?«, fragte Mama, allerdings ohne etwas zu sagen. Sie beherrschte die Kunst, mit Blicken zu sprechen.
Da ich das leider nicht konnte und sowieso lieber meinen Mund benutzte, antwortete ich: »Bin mit Tom verabredet.«
»Dann aber fix«, sagte Mama, wiederum ohne die Lippen zu bewegen. Unglaublich, wie sie das machte.
Ich schaufelte mir den Rest Rührei hinein und versuchte, so viel von dem süßen Kakao zu trinken wie möglich. Das war gar nicht so leicht, denn Mamas Platz hatten nun Amalia und Georgina eingenommen, und beide überboten sich darin, mir Fotos von Häusern in London zu zeigen, die sie auf den Bildschirmen ihrer Handys hin und her schoben. Scheinbar gingen die beiden davon aus, dass wir dort demnächst wohnen würden.
Abwarten, dachte ich.
»Schau mal, das hier liegt an den Kensington Gardens«, flötete Amalia.
»Und von hier aus kannst du direkt zum Shoppen in die Market Street«, trällerte Georgina.
»Ich muss los«, sagte ich. Das mit dem Kakao konnte ich vergessen. Ich bekam die Tasse nicht zum Mund, weil unentwegt Zwillingshände mit Telefonen vor meinem Gesicht herumwackelten.
Im Flur zur Eingangshalle stand plötzlich Tante Frida vor mir. Während Mama die Fähigkeit hatte, etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen, besaß Tante Frida die Gabe, an einem Ort aufzutauchen, ohne dass man wusste, wie sie dorthin gelangt war. Noch vor wenigen Sekunden hatte sie ja am Herd Frühstücksspeck gebraten.
»Ich muss dir was zeigen«, flüsterte sie mir zu.
Verschwörerisch. Geheimnisvoll. Vielversprechend.
Aber nicht so vielversprechend wie der Plan, den ich mit Onkel Frank ausgeheckt hatte. Deshalb erwiderte ich: »Nachher, wenn ich wieder da bin. Jetzt muss ich erst mal zu Tom.«
»Mach keine Dummheiten«, sagte Tante Frida mit einem unergründlichen Blick aus ihren unergründlichen großen Augen.
Ohne dass ich es verhindern konnte, zuckte ich zusammen. Wusste Tante Frida etwa, was ich vorhatte? Das war völlig unmöglich. Trotzdem schlüpfte ich ein wenig verunsichert in meine Turnschuhe.
Aber schon im Auto fühlte ich mich wieder völlig sicher. Was daran lag, dass ich mich immer so fühlte, wenn ich mit Mama durch die Gegend gondelte. Schon als kleines Kind liebte ich es, von ihr herumkutschiert zu werden, vor allem dann, wenn sie mit dem großen Geländewagen fuhr. Der war zwar alt und klapprig, vermittelte aber trotzdem den Eindruck, völlig unzerstörbar zu sein. Genau wie Mama. Und genau wie unser Schloss. Na ja, jedenfalls hatte ich das bislang gedacht. Schade, dass Mama in Sachen Schloss nicht auf meiner Seite war.
Schweigend bretterten wir durch die sommerliche Landschaft.
Ich versuchte, Mama eine Botschaft zu übermitteln, indem ich sie intensiv anstarrte und dachte: Moorwood Castle darf niemals verkauft werden. Moorwood Castle darf niemals verkauft werden.
»Ich muss später noch was einkaufen«, sagte Mama. »Danach kann ich dich bei Tom abholen. So gegen zwei. In Ordnung?«
Mist. Hatte nicht geklappt.
Mama parkte den Landrover vor dem roten Backsteinhaus, in dem sich ihre Zahnarztpraxis befand. Nicht weit entfernt hatte Toms Mutter ihren Kramladen, und wenn man von dort aus einmal um die Ecke bog, stand man direkt vor dem schmalen Wohnhaus der Baxters.
Wir stiegen aus, Mama winkte mir zum Abschied zu und verschwand. Ich blieb allein in der menschenleeren Straße zurück und fühlte mich nun ganz und gar nicht mehr sicher. Der Nachteil an meinem Plan war nämlich, dass ich ja noch gar keinen hatte. Genau genommen hatte ich noch nicht einmal eine Verabredung mit Tom.
Ich holte mein Handy aus der Hosentasche und wählte seine Nummer.
»Hallo«, sagte Tom. Er klang äußerst verpennt.
»Hallo«, sagte ich. »Wir müssen was unternehmen.«
»Du meinst, weil dein Vater euer Schloss verkauft hat?«, fragte er und gähnte.
»Er hat es noch nicht verkauft«, erklärte ich. »Diese Papiere, die wir gesehen haben, die bedeuten, dass es jemanden gibt, der es kaufen will, und zwar dieser Mr Bommel.«
»Aha«, machte Tom. Ich hörte ihn mit seiner Bettdecke rascheln und wurde neidisch.
»Wir müssen mehr über diesen Kerl herausfinden«, sagte ich. »Vielleicht können wir dann verhindern, dass er das Schloss kauft.«
»Wie sollen wir ihn denn daran hindern?«, fragte Tom.
Raschel. Raschel.
Der machte es sich jetzt so richtig schön gemütlich, während ich hier herumstand und mir vorkam wie bestellt und nicht abgeholt.
»Weiß ich noch nicht«, antwortete ich. »Erst mal stöbern wir diesen Typen auf und finden was über ihn heraus.«
»Du meinst wie Detektive?«
Tom hörte sich auf einmal nicht mehr ganz so verpennt an. Er mochte nämlich Detektivgeschichten, wie mir gerade einfiel. Tom mochte eigentlich jede Art von Büchern und las im Gegensatz zu mir von morgens bis abends (wenn er nicht irgendwelche Knobelaufgaben löste oder mit seiner Playstation herumdaddelte) – aber Detektivgeschichten, die las er besonders gern.
Ich hatte ihn am Haken.
»Ganz genau. Wie Detektive«, sagte ich. »Bist du dabei?«
»Bin ich«, bestätigte Tom.
»Schlag ein«, sagte ich und hob meine rechte Hand.
Tom raschelte mit seiner Bettdecke. Außerdem war das schrille Bimmeln einer Türglocke zu hören.
»Mach ich«, sagte Tom. »Wenn wir uns das nächste Mal treffen.«
Wieder das schrille Bimmeln.
»Es klingelt«, sagte ich.
»Ja«, brummte Tom. Durch den Lautsprecher meines Telefons hörte ich ihn eine Treppe hinuntertapern. Dann öffnete er die Haustür.
Davor stand ich. Mit erhobener rechter Hand.
»Huch!«, machte Tom.
»Schlag ein!«, wiederholte ich.
Tom gehorchte und donnerte pflichtschuldig seine große Pranke gegen meine kleine Handfläche.
Wenig später saß ich in der baxterschen Küche, die in etwa die Ausmaße des Kofferraums von unserem Geländewagen hatte. Überall standen Becher, Tonkrüge, Figürchen, mehr Becher und noch mehr Figürchen herum. Den meisten Platz aber nahm Toms Mutter ein, die im Gegensatz zu dem Haus, das sie bewohnte, gigantische Ausmaße hatte. Trotzdem schaffte sie es, keinen einzigen der Becher und Tonkrüge mit den schlackerigen Ärmeln ihrer Fransenbluse zu Fall zu bringen. Auch die dreitausend Figürchen kippten beim Auftischen von Speck, Rühreiern und Toastbrot nicht um.
Es roch nach Earl Grey Tee.
Und ich fühlte mich wunderbar.
Fast noch sicherer als bei Mama im Wagen.