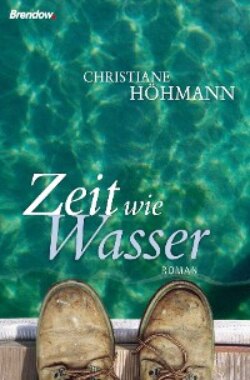Читать книгу Zeit wie Wasser - Christiane Höhmann - Страница 11
6
ОглавлениеHella war nicht da, als er mit Daisy zurückkehrte. An seiner Tür klebte ein Post-it-Zettel. »Bin zum Einkaufen.
Ab halb sechs ist Bernd von der Arbeit zurück.«
Bernd? Ach ja, Bernd, dachte Henry. Bis vor Kurzem war Hella immer nur Bernds Frau gewesen und jetzt hatte er stundenlang nicht daran gedacht, dass sie verheiratet war. Henry streckte sich auf der Wohnzimmercouch aus, Daisy neben sich auf einer Decke.
Er erwachte von ihrem heftigen Bellen. Hatte sie Hunger oder musste sie vielleicht noch einmal nach draußen? Mit dem Hund an der Leine trat er durch die Terrassentür in den Garten.
Daisy bellte weiter. Henry folgte ihrem Blick auf den Apfelbaum in Hellas und Bernds Rasenstück. Seine Zweige reichten bis tief auf den Rasen und überall lagen kleine grüne Äpfel, selbst jetzt noch, im Spätherbst, Klaräpfel, die keiner von ihnen aß.
Im Sommer stellten die Schulzes ihre Gartenmöbel unter den Baum, weil nur dieser in dem kleinen Garten Schatten spendete. Das tat der Baum nicht gerne. Im Gegenteil: Er schien nur darauf zu warten, dass man unter den schweren Zweigen Platz nahm, damit er seine Äpfel abwerfen konnte. Besonders auf mich, dachte Henry und betastete unwillkürlich seinen Kopf, so als könnte er die Beule vom letzten Grillessen im Garten immer noch fühlen.
Daisy bellte weiter. Henrys Blick wanderte nach oben. Bernd befand sich im Apfelbaum, man sah nur seine Beine und die Arme, die die Zweige beschnitten. So spät im Jahr, dachte Henry. So spät macht er das. Und es ist doch schon fast dunkel. Aber klar und trocken. Und es ist auch wirklich besser, wenn im nächsten Jahr mal niemand von den Äpfeln getroffen wird, dachte Henry.
Tief atmete er die Abendluft ein und aus. Es duftete nach Astern. Plötzlich sah er Bernds Hand, mit der er sich an einem Ast festklammerte. Mit der anderen winkte er Henry und Daisy zu, er rief etwas, das Henry nicht verstand, aber er konnte Bernds Lachen hören. Bestimmt fand der Nachbar es erheiternd, dass Henry mit Daisy spazieren gegangen war, genauer gesagt, Daisy mit Henry.
Als Henry die Hand hob, um zurückzuwinken, sah er die plötzlichen, unerwarteten Bewegungen der Äste. Ein Wind musste aufgekommen sein, der Baum versuchte, die fremde Last abzuwerfen.
Bernd klammerte sich jetzt mit beiden Armen fest, aber nicht fest genug, er schrie etwas, hörte schlagartig auf zu schreien, für einen Moment war alles still, nicht einmal die Pappeln an der Straße, durch die man jetzt den Wind gehen sah, waren zu hören.
Dann verlor Bernd den Halt und stürzte auf den Grasboden. Blätter raschelten, Zweige knackten und ein dumpfer Aufprall war zu hören, kein Schrei, kein Laut mehr. Etwas war zu Ende gegangen. Als Henry aus seiner Erstarrung erwachte, lief er hinüber. Daisy stand neben Bernd, der unter dem Baum lag, unter sich ein schwerer Ast, den er mit hinabgerissen hatte, seine Arme und Beine waren verdreht, die Augen wurden starr. Die Hündin bellte nicht.
Wie soll ich das nur Hella sagen?, fragte sich Henry wenig später, wie um Himmels willen erkläre ich ihr, dass der Notarztwagen vor ein paar Minuten auf ihrem Rasen gestanden hat? Wie sag ich ihr nur, dass Bernd schon nicht mehr am Leben war, als man ihn hineinschob und wegfuhr?
Und was kommt dann? Was mache ich jetzt?
Er saß auf dem blauen Sofa in Hellas Wohnzimmer und sah vor sich hin. Manchmal wäre es wirklich besser, man würde sich nicht vor den Spiegel stellen, rasieren, die Haare kämmen, die Nachbarin besuchen und dann mit ihrem Hund spazieren gehen. Oder vielleicht wäre es noch besser, gar keine Nachbarn zu haben, erst gar nicht mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, nicht in eine Wohnsiedlung zu ziehen …
Auf jeden Fall wäre es besser, wenn er mehr Übung damit hätte, Hella weinen zu sehen.
Als Hella die Plastiktüten an der Tür fallen ließ und wie immer, wenn sie heimkam, »Bernd« rief, saßen Henry und Daisy immer noch da, ohne sich bewegt zu haben.
Hella würde sich später vor allem an eins erinnern: »Ihr habt da so gesessen, so … so vielsagend. So, dass mir mit einem Schlag alles klar wurde. Ihr habt so auffällig geschwiegen, weißt du. Und dann bist du aufgestanden, bist langsam näher gekommen, hast deinen Kopf schief gelegt und die Augen auf mich gerichtet – so –«, sie setzte eine traurige Miene auf, und dann hast du den Arm gehoben und mir langsam und vorsichtig über die Wange gestrichen. Und hinter deiner Hand deine Augen …«
»Bernd Schulze ist verstorben. Mit 51«, erzählte Henry auf dem Friedhof am nächsten Tag, »er wird bald hier sein.«
Mutter hatte den ruhigen Mann gemocht, der hin und wieder in ihrem Haus etwas reparierte.
»Was? So früh? Er hatte doch das Leben noch vor sich«, hätte sie gesagt.
Es war gut zu wissen, was Mutter sagen würde, dachte Henry. Selbst heute beruhigte es ihn wieder.
Als er ein paar Wochen später neben Hella am Grab stand, vermisste er es schon, sich zu den Pflanzen hinunterzubeugen und zu reden. Oder murmelnd auf der Bank zu sitzen, wie ein Alter, ein Hinterbliebener, der sich noch nicht daran gewöhnt hatte, dass er jetzt alleine auf der Welt war.
So ein Verhalten kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben, dachte Henry.
Schwarz stand Hella gut. Ihre blonden, halblangen Haare wehten im Wind, sie wirkte wie ein junges Mädchen und stand doch mit kräftigen Beinen sicher an seiner Seite.
Jetzt bewunderte sie die Inschrift auf dem schwarzen Marmor:
»Ruhe sanft«, stand da, sonst nichts.
Henry hatte alle Grabsteininschriften der Friedhöfe in der Umgebung gelesen und sich notiert, bis er sich für diese beiden Worte entscheiden konnte. Natürlich kam »Ruhe sanft« auf dem Friedhof häufig vor, aber das konnte eigentlich doch nur für diese Worte sprechen.
Er sah von Hella zum Stein, vom Stein zu Hella. Dass sie nicht mehr jung war, war das Beste an ihr.
Letztes Jahr hatte sie ihren fünfzigsten Geburtstag gefeiert. An einem sehr heißen Tag.
Bernd stellte Mutter eine Liege in den Garten, wo er und Hella mit Henry und den anderen Nachbarn beim Barbecue unter dem Apfelbaum saßen. In sicherer Entfernung vom Apfelbaum lag Mutter den ganzen Nachmittag auf der Liege, trotz der Hitze hatte sie die Decke bis ans Kinn gezogen und starrte in den Himmel.
Henry steckte sich gerade ein saftiges Fleischstückchen in den Mund, als sie ihn bat, ihre Kamera zu holen. Als er endlich darauf reagiert hatte, ins Haus gegangen und mit der Kamera zurückgekehrt war, richtete sie sich auf und fotografierte Hellas Rosen und den Oleander. Nach einer Weile ließ sie sich zurücksinken und fing an, das Rufen der Amseln nachzuahmen. Wieder hörte er ihre schrille Altfrauenstimme und aus dem hohen Baum ein durchdringendes, fast tonloses, lang gezogenes Piepen, wie ein Kinderweinen. Die Gäste am Tisch verstummten plötzlich und hörten es auch. Mutter antwortete den Amseljungen.
Plötzlich wünschte sich Henry, er hätte den Vogelgesang seiner Mutter im letzten Sommer nicht als so peinlich empfunden. Eher als ein Zeichen von Leben, von Lebendigsein. Warum hatte er ihre letzten Lebensäußerungen nicht gefeiert oder zumindest begrüßt, statt sich verlegen abzuwenden?
Weil er nicht wusste, dass es ihre letzten waren, und wenn er es gewusst hätte, wären sie ihm immer noch peinlich gewesen, vielleicht noch mehr.
Hella kam jetzt öfter in sein Haus. Daisy hatte sich schon an die dunkle Ecke neben der Couchgarnitur gewöhnt und steuerte sie an, sobald sie mit ihrem Frauchen das Wohnzimmer betrat.
Aber heiraten werde ich Hella nicht, dachte er und blickte fest auf den schwarzen Grabstein, heiraten sicher nicht.