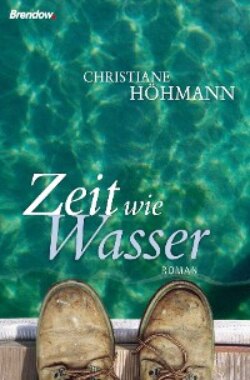Читать книгу Zeit wie Wasser - Christiane Höhmann - Страница 7
2
ОглавлениеAn dem Morgen, als sein Auto wieder in der Garage stand, ging Henry zum Friedhof, in der Hand Mutters kleine Messingkanne.
Die bescheuerten Friedhöfe liegen immer im Schatten, dachte er am Eingangstor, und jedes Mal vergisst man es wieder, bis zur nächsten Beerdigung. Er fröstelte. »Nimm dich zusammen, Henry, du bist doch kein Weichei«, sagte er halblaut.
Auf dem Weg hierher hatten sich seine Beine anders angefühlt als gewohnt, er musste die Füße nicht sorgsam über den Boden heben, Schritt für Schritt, sie tappelten über den Asphalt. Sie tappelten? Das Wort weckte Erinnerungen. Die Mutter hatte es gebraucht, wenn sie am Fenster saß und auf die Straße schaute. Die Kinder tappelten zum Spielplatz und zurück. Erwachsene tappeln nicht.
Doch, heute schon, Henry beobachtete seine Füße scharf, während er weiterlief.
Gestern, auf der Heimfahrt vom See, hatte er sich auf nichts so sehr gefreut wie auf das Erzählen. Die Stadt am See, die Schaukel, der Steg, Franz. Und schließlich diese Mischung aus Beschämung und Freude, sein fassungsloses Ein_ und Ausatmen, als er sein Auto wiedersah, die Tür aufschloss und sich hinter das Steuer setzte.
Sonne und Wind, Spazierengehen durch den Ort im Regen, Wörter, Ausdrücke, Sätze, alles sammelte und ordnete sich in seinem Kopf, wurde zu einer Geschichte – bis ihm einfiel, dass Mutter nicht mehr da war. Verstorben. Ihr Bett verschwunden.
Ich habe immer auf sie hin gelebt, dachte er. Alles gewann Bedeutung, wenn er es ihr erzählte. Dabei war die Zeit doch lange vorbei, in der ihr Urteil wichtiger gewesen war als seines. Doch, dachte er jetzt wieder, ich habe alles auf sie hin getan.
Sein Lächeln erlosch. Er hatte Wilhelm gebeten, sich um die Pflege des Grabes zu kümmern, aber die drei Petunien, die der gesetzt hatte, waren über das Rechteck gewuchert und längst verwelkt. Die Begrenzungen des Grabes waren gar nicht mehr zu erkennen. Er würde sich selbst darum kümmern müssen, auch darum.
Henry bückte sich und zog an einer der Pflanzen.
Eine Geschichte fiel ihm ein, die er kürzlich in einer Zeitschrift gelesen hatte. Oder stand sie in einem seiner neuen Bücher?
Ingo aus Altenburg, dachte er plötzlich, bei ihm habe ich sie gelesen, in dem Buch mit den Erzählungen:
Ein Mann steht am Grab seiner Mutter und stellt der Verstorbenen eine Frau vor. Er habe auch endlich eine Lebensgefährtin gefunden, erzählt er stolz. Und wie ähnlich sie der Mutter doch sei, dabei deutet er auf die Frau mit dem gelangweilten Blick neben sich.
Als er mit ihr den Friedhof verlässt, drückt er ihr fünfzig Euro in die Hand und beide gehen in unterschiedliche Richtungen davon.
Henry lachte. Beim zweiten Versuch ließ sich die Pflanze mit einem Ruck herausziehen.
»Hella Schulze hat sich die Haare blond färben lassen«, sagte er, während er sich zur nächsten Blume herunterbeugte.
»Und Wilhelm hat rübergemacht nach Meißen.« Rübergemacht, dachte Henry plötzlich, so nannte man das damals, wenn jemand in den Westen verschwand. Rübermachen geht jetzt auch rückwärts. Er lachte und bückte sich wieder auf das Grab. »In meiner alten Bude ist er jetzt. Zu Marie könnte er nicht mehr zurück, hat er gesagt. Vielleicht will sie sich scheiden lassen.«
Wilhelms Scheidungen konnten Mutter nicht mehr aufregen. Daran war sie gewöhnt.
Henry sah auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn, neuerdings schwitzte er schon, wenn er sich nur ein bisschen bewegte. Dabei schien nicht einmal die Sonne. Der Wind ließ die Bäume am Weg rauschen. Er schaute nach oben. Wolken brauten sich über den Baumkronen zusammen, er musste zurück.
Morgen würde er auf dem Weg zum Friedhof beim Gärtner vorbeifahren.
Das Haus war still. Und leer. Ich kann froh sein, dass Wilhelm mir nicht auch noch mein Bett weggenommen hat, dachte Henry. Und den Küchentisch, an dem er sein Abendbrot einnahm, zwei Scheiben Brot, eine mit Honig, eine mit Käse.
Aber das Brot rutschte nicht. Er hatte keinen Appetit. Henry legte die Hand auf den Magen. Dann nahm er sich eine Flasche Milch aus dem Kühlschrank.
Er pflanzte Astern auf das Grab und leuchtende Chrysanthemen, harkte, goss und erzählte der Mutter, was sie nicht wissen konnte, weil sie nicht mehr aus dem Wohnzimmerfenster schaute.
Es war viel. Ständig passierte etwas, jemand lief die Straße entlang, den er nicht kannte, Autos fuhren langsam, weil man im Wohngebiet neuerdings dreißig fahren musste, die Kinder gingen seltener in Richtung Park, seitdem sie nachmittags Schule hatten.
Einmal flogen Tauben auf von der Straße, glänzend, verheißungsvoll wie junge Schwalben, Silbervögel in der Sonne, vor der Kirche.
Tims Vater hatte Tauben, dachte Henry. Wieso fiel der ihm jetzt ein, in diesem Moment, an Mutters Fenster?
Tim, sein Freund von vor über vierzig Jahren, damals in Coswig. Er lehnte sich an die Fensterscheibe.
Tims Eltern waren nie weggefahren. Wer Brieftauben züchtet, kann nicht weg von zu Hause. Nicht dass Henrys Familie in den Urlaub gefahren wäre, aber sie hatten doch immer das Gefühl gehabt, dass sie fahren konnten, wenn sie es nur wollten. Und er war ja auch jedes Jahr im Ferienlager gewesen und später dann in Ungarn.
»Schulzes haben einen Hund«, erzählte er ein paar Tage, nachdem er mit dem Pflanzen fertig war, »einen Golden Retriever, er heißt Daisy, nein, sie heißt Daisy«, obwohl er sich für Hunde nicht interessierte, hatte er sich von Hella Schulze Rasse und Namen nennen lassen. Die würde Mutter wissen wollen.
»Erinnerst du dich noch daran, wie du die Allergie hattest?«, fragte er übergangslos. »Mich juckt es jetzt auch ständig. Das wird doch nicht vom Hund sein? Nein, ich glaub das auch nicht, ich hab ihn doch gar nicht angefasst.« Und der Magen, dachte er, den spüre ich ständig.
Von den leeren Stellen im Haus, wo Mutters Möbel gestanden hatten, sagte er nichts. Er würde die Lücken auch nicht füllen. Niemand würde mehr etwas im Haus der Mutter anrühren, solange er da war, das zu verhindern.
Wenn er auf dem Friedhof fertig war, ging er in die Stadt. Immer hatte er darauf geachtet, dass er seine tägliche Routine genau einhielt, und seitdem er nicht mehr arbeiten ging, war dies wichtiger als jemals zuvor. Am Morgen fuhr er mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Zwei Mal am Tag ging er Kaffee trinken. Nach dem Friedhof zu Karstadt, am Nachmittag in einen der modernen kleinen Läden, die nur wenige Sitzplätze im Thekenbereich hatten.
»Den 1,50er«, sagte er, wenn er das Starbucks betrat.
Den Kaffee für eins fünfzig gab es schon lange nicht mehr, er war offensichtlich ein Lockangebot bei der Eröffnung des Cafés gewesen. Aber das Mädchen hinter dem Tresen lächelte und hielt schon eine Tasse an die Maschine, wenn sie ihn vor der Tür stehen sah.
Zwei Mal am Tag Kaffee trinken zu gehen, hatte er Herbert auch empfohlen, als der Rentner wurde und dann auch noch seine Frau auszog. Genau die Hälfte des Hausstandes nahm sie mit, ebenso wie sie vorher genau die Hälfte bewohnt hatte, erzählte Herbert, immer genau die Hälfte der notwendigen Lebensmittel eingekauft und nach Möglichkeit auch immer nur ihre Hälfte verbraucht hatte.
Statt mit Henry Kaffee trinken zu gehen, fing Herbert nach dem Auszug seiner Frau an, zwei Mal am Tag die Eckkneipe aufzusuchen. Das erste Mal nach dem Frühstück – sechs Pils und ein Korn, 10 Euro, das zweite Mal vor dem Abendbrot – sechs Pils und ein Korn. Vorher hatte Herbert sein Bier zu Hause getrunken und auch erst abends damit angefangen.
Wie konnte man nur dieses Gesöff so hemmungslos in sich hineinschütten?, dachte Henry. Hin und wieder einen Wodka auf Eis, der machte das Leben schöner. Aber niemals vor fünf Uhr.
Eines Abends, nach dem zweiten Wodka, sagte Mutter zu Henry, dass er nicht gut rieche. »Wodka riecht doch gar nicht«, sagte er, aber er kaufte keine neue Flasche mehr.
Nach dem Starbucks ging er ins Internetcafé. Das letzte seiner Art in dieser Stadt befand sich in der Bahnhofstraße. Anscheinend war er einer der wenigen Einwohner dieser Stadt, die noch keinen Internetanschluss hatten und trotzdem online gingen. Murats Landsmänner benutzten das Café auch zum Telefonieren.
Murat winkte ihm am Eingang zu, ohne seine Zigarette hinzulegen, er schaltete wie immer die Nummer 1 frei.
Henry ging durch den dämmrigen Laden und setzte sich auf den Drehschemel vor dem Computer.
Links neben ihm standen Menschen verschiedener Nationalitäten in kleinen Telefonabteilen, rechts saßen Einzelne mit gesenkten Köpfen vor den Bildschirmen. Hier hatte noch niemand etwas vom Rauchverbot gehört, überall qualmte es.
»Billig telefonieren, rund um die Welt«, hatte Murat mit ungelenker Schrift quer über das Schaufenster geschrieben. Neben Henry mischten sich Stimmen, leises Murmeln, das immer wieder übertönt wurde durch heftige Laute, die jemand in seinen Hörer rief, in einer Sprache, die Henry nicht kannte.
Wenn er in sein Mailprogramm gegangen war, oft nur, um festzustellen, dass er nur Werbepost erhalten hatte, genehmigte er sich den Besuch auf ein paar schönen Seiten, darunter nur selten solche, die er sofort schließen musste, wenn Murat hinter ihn trat, »mein Freund« sagte und ihm auf den Rücken klopfte.
Am Ende ging er auf die Seite Google Earth. Mit wenigen Mausklicks bewegte er sich in seiner Heimat die Straßen entlang, die er als Junge gegangen war, über dem Elternhaus hielt er für eine längere Zeit an, dann über dem Nachbarhaus. Manchmal fuhr er auch mit dem Zeiger der Maus nach Meißen oder Dresden, oft blieb er einfach an einer der Brücken an der Elbe stehen. Eine Stadt muss einen Fluss, ein Ufer, eine Uferpromenade haben. Erst der Fluss gibt der Stadt ihr Gesicht.
Wenn er von diesen Reisen zurückkehrte, wusste er sekundenlang nicht mehr, wo er war und was er in dem verrauchten, überfüllten Raum tat, wo von kleinen Tischen hinter grauen Maschinen Menschen mit dunklen Augen den Blick vom Bildschirm hoben und ihn ansahen, wenn er plötzlich aufstand.