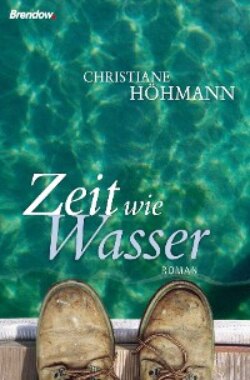Читать книгу Zeit wie Wasser - Christiane Höhmann - Страница 8
3
ОглавлениеDie Zeitung las er nach dem Frühstück von Anfang bis Ende durch, selbst, wenn ihn die Nachrichten und Berichte anödeten. Es reichte, die Artikelüberschriften von einem Tag zu lesen, um im Sessel zur Seite zu kippen, fand er, während er blätterte und dabei vor sich hin murmelte.
Startschuss für die Lesehasen
Licht von allen Seiten
Ein Tag für alle Kinder
So geht Sudoku
Einkaufen wie an der Wolga
Altersversorgung kommt teuer
CDU-Stil gescheitert
Mit Liste und Dose von Haus zu Haus
Tresorknacker unterwegs
Kinder erleben den Wald
Upps, komm Zähne putzen
Wir trauern um …
Hier stutzte er. Ein Name sprang ihm ins Gesicht. Fett gedruckte Zeilen wurden löchrig und verschwammen vor seinen Augen.
Günter Fiedler, stand da. 1949–2008. Günter Fiedler? Ja, das kam hin. Günter war der Nachbar von gegenüber. Früher war er oft stehen geblieben, bevor er in sein Auto stieg, um zum Dienst zu fahren. Er hatte sich an den Gartenzaun gelehnt, herübergegrüßt und manchmal mit der Mutter am Fenster ein Gespräch begonnen. Abends hatte Henry auch mal neben ihm am Tresen im Willi’s gestanden. Und war das nicht erst zwei Wochen her, dass Henry Günter im Supermarkt gesehen hatte?
Er dachte an den Blick, den der ihm im Eingangsbereich des Geschäfts zugeworfen hatte, als er ihn erkannte. Ein merkwürdiger Blick, unter dem sich Henry über die Haare strich. Er war doch gekämmt, das Hemd steckte in der Hose, die Hose hatte keine Flecken? Früher hatten ihm andere Blicke zugeworfen, eklige, geile Typen, die ihm auch schon mal in der Straßenbahn über den Rücken strichen und zwischen die Beine fassten. Es hatte eine Weile gedauert, bis ihm dämmerte, dass sie ihn für »andersherum« hielten. Ekelhaft, dachte Henry. Seitdem konnte er es nicht mehr gut aushalten, wenn er angestarrt wurde.
»Nach langer Krankheit.«
Günters Blässe war also kein Zufall gewesen. Und jetzt war er tot. Keine Abschiede, dachte Henry, keine Abschiede. Einfach so davongehen. Über die Mauer springen. So ist es richtig, so würde er es auch machen. Plötzlich spürte er wieder seinen Magen. Er hielt die Hand dagegen. Heute würde er nichts essen. Auch kein Müsli zum Frühstück und keine Gemüsesuppe zu Mittag. Ein Fastentag.
Als er im Keller die Wäsche in die Maschine stopfte, klingelte das Telefon. Er fluchte leise, ließ die Wäschestücke fallen und lief die Treppe hoch. Der Hörer war nicht an seinem Platz auf dem kleinen Tischchen im Wohnzimmer. Wo hatte er ihn hingelegt? Das dringender werdende Geräusch führte in Mutters Zimmer, zu ihrer Frisierkommode. Das Klingeln hörte auf. Auf dem Weg in die Waschküche setzte es wieder ein, Henry zog den Hörer vorsichtig aus seiner Hosentasche.
»Hallo?«, sagte er keuchend, »hallo?«
»Oh, ist da Brosche? Heinrich Brosche?«
»Ja«, sagte Henry, »und wer zum Teufel sind Sie?«
»Tobias Grün«, war die Antwort, »gut, dass ich Sie erreiche, wir machen eine Meinungsumfrage. Sie kennen doch sicher die Sender ARD und ZDF und auch RTL? Günter Jauch?«
Der Lautsprecher am Gerät war angestellt, die Stimme so durchdringend, dass Henry den Hörer vom Ohr abhalten musste.
»Hören Sie«, sagte Henry gefährlich ruhig, »Sie wissen doch, dass Werbeanrufe verboten sind?«
Der Mann machte keine Pause, er schnappte nicht nach Luft und zögerte keinen Moment, wie sie es manchmal taten, die vermeintlichen Meinungsforscher aus den Callcentern, wenn Henry seine Frage stellte.
»Sicher weiß ich, dass Werbeanrufe verboten sind«, Tobias Grüns Stimme hallte im Waschkeller wider, »aber was soll ich denn machen, es ist doch mein Job!«
»Such dir was Legales, mein Guter«, sagte Henry und drückte auf den Ausknopf.
Drei bis fünf Werbeanrufe in der Woche, dazu ein heiß gelaufenes Faxgerät, das immer wieder die gleiche Werbung ausspuckte. Zettel mit Tannenbäumen darauf, jeweils zwei Tannenbäume in einer Reihe nebeneinander. Man wusste nicht einmal, wofür da geworben wurde. Ein Jagdgrundstück zu vermieten? Abtransport alter Weihnachtsbäume? Gartengestaltung?
Und dann das Türklingeln.
Mindestens an jedem vierten Tag klingelte es und es standen Leute vor der Tür. Zeugen Jehovas, dann Bundeswehrsoldaten, die für Erhaltung und Neugestaltung von Kriegsgräbern sammelten, und der Zeitschriftenwerber, der angeblich nur deshalb Zeitschriftenabonnements verkaufte, weil er mit dem Erlös obdachlose Jugendliche unterstützen wollte.
»Haben auch Sie ein Herz für unsere jungen Menschen!« Mehr noch als diese Anrufe und die Besuche an der Tür fürchtete Henry die Zeit, wenn er die Anrufe nicht mehr sofort beenden, und die Besucher nicht schon an der Schwelle fertigmachen würde. Wenn es so weit käme, dass er Zeitschriftenwerber und religiöse Extremisten ins Haus bitten würde oder einen Anruf von einem vermeintlichen Meinungsforschungsinstitut annehmen und sich mit den Werbern unterhalten, vielleicht sogar streiten würde.
Wenn sich das Mädchen im Starbucks nicht mehr zu ihm umdrehen und lächeln würde, wenn er einen seiner Sprüche losließ. Oder wenn Murat sein schmuddeliges Internetcafé schließen und nach Izmir zurückgehen würde.
»Verstehst du das, Mutter?«, fragte er auf dem Friedhof und das Grab lag ruhig da, der Boden hart, die Knochen darunter kalt.
Die Mutti ist tot, dachte er, sie ist tot. Er stieß die Schaufel kräftig in den Boden und versuchte, sie zu drehen. Vergeblich. Es hatte schon Bodenfrost gegeben, die Narzissenzwiebeln musste er im Frühjahr setzen.
Auf den Stiel gestützt, betrachtete er den Stein, dann die Kastanienbäume. Diese Bäume mochte er, das musste er zugeben. Immer demonstrierten sie, dass sie noch lebten. Im Sommer, indem sie Früchte trugen, die sie später auf die Passanten warfen oder auf den Boden knallen ließen, den ganzen Winter lang durch dicke Knospen, die selbst der größten Kälte trotzten.
Auch Mutter hatte Bäume geliebt.
Im letzten Jahr wollte sie immer wieder fotografieren. Es fing mit den Bäumen an. Die Pappeln, die die Straße säumten, dann die Kinder, die jeden Tag an ihrem Fenster vorbeigingen, die Vögel, deren Rufe sie nachahmte. Sie verlangte nach der Kamera, dieser Billigkamera, die sie behielt, weil Wilhelm sie ihr geschenkt hatte. »Eine Bessere lohnt sich ja für mich nicht mehr«, sagte sie manchmal. Henry war froh, dass sie damit zufrieden war, ihre Umgebung zu knipsen.
Manchmal, zu der Zeit, als sie noch herumlaufen konnte, wartete er besorgt auf die Worte: »Lass uns nach Coswig fahren. Du hast doch ein Auto. Wir könnten doch an die Elbe, einmal noch nach Meißen. In die Heimat.« Er legte sich viele Worte zurecht, um zu verhindern, dass er sie dorthin fahren musste.
Es ist besser, man kehrt nicht an einen Ort zurück, der einem so viel bedeutet, dass man verloren ist für den Platz, an dem man lebt, dachte er. An dieser Formulierung hatte er lange gefeilt.
Er hatte Mutter nach der Wende sofort in den Westen geholt, in seine Nähe. Und dann suchte er dieses Haus für sie. Aber hier war sie immer fremd geblieben. Wie eine Touristin, die die Gegend am liebsten durch die Linse ihres Fotoapparates betrachtet.
Einmal konnte er die Kamera nicht schnell genug aus dem Schrank holen, er stand in der Küche am Herd und rührte Zwiebeln in Butter.
»Gleich, Mutter«, sagte er, »gleich nach dem Essen gebe ich dir die Kamera.«
»Nein, jetzt brauche ich sie, bitte, ich muss sie haben.«
»Aber warum denn jetzt gleich? Du hast doch so viel Zeit, die Bäume zu knipsen.«
»So viel Zeit?«, fragte sie, »so viel Zeit?«
Kurz darauf musste er sie ins Krankenhaus bringen lassen, weil sie nichts mehr zu sich nahm. Eine ganze Nacht lang spuckte sie schwarze, übel riechende Flüssigkeit in die Toilettenschüssel. Henry zögerte. Würden sich die Beschwerden nicht vielleicht doch wieder legen, ohne dass er ihr das Krankenhaus zumuten musste?
Sie sagte nicht, dass sie Schmerzen hätte, hob nur immer wieder den Kopf über der Toilette und schaute ihn geistesabwesend und verstört an, mit diesen fast blinden Augen.
Als er endlich gegen Morgen telefonierte und einen Rettungswagen bestellte, hörte er die Mutter ins Wohnzimmer gehen, Schränke öffnen und mit einem lauten Knall wieder schließen.
Mutter zog Tischtücher heraus, die sie schon lange nicht mehr benutzt hatte, und breitete sie über alle Tische im Haus.
In den nächsten Tagen ging Henry dann an den Tischen und Tischchen vorbei, alle mit sorgfältig gestärkten Tüchern bedeckt wie für eine große Feier, es dauerte Wochen, bevor er die Decken wieder einsammeln und in die Waschmaschine stecken konnte. Nachdem sie alle Tücher verteilt hatte, drückte sich Mutter in die hinterste Ecke des Wohnzimmers, mit starren, weit aufgerissenen Augen sah sie den Sanitätern entgegen. Wie ein Tier, dachte Henry, ein gejagtes Tier.
Er lehnte den Spaten an die Holzbank und setzte sich. Ihm war ein wenig übel im Magen, bestimmt übersäuert, dachte er, und dann fiel ihm auf, dass seit Langem kein Tag mehr vergangen war, an dem er nicht an sie dachte, an dem sie nicht immerzu da war in seinen Gedanken.
Näher als alle Lebenden ist die Mutti mir, dachte er. Und es ist so ärgerlich, dass sie das hier alles nicht sehen kann.
Er legte den Kopf in den Nacken. Die kleinen Knospen an den Kastanienbäumen, die erschienen waren, nachdem die letzten Blätter abfielen, würden noch lange brauchen, bis sie sichtbar größer wurden und plötzlich aufplatzten, aber dann würde alles schnell gehen.
Beim nächsten Blick wären schon die Blütenstände zu sehen und nicht lange danach würde ihm der Duft der Kastanien am Eingang des Friedhofs entgegenströmen.
»Wo sind eigentlich die Pappelbilder?«, fragte Henry jetzt laut und eine schwarz gekleidete Frau in der übernächsten Gräberreihe warf ihm einen erschreckten Blick zu. Er hob die Hand und winkte ihr beruhigend zu, bevor er umständlich aufstand, nach dem Spaten griff und dem Rechteck mit dem schwarzen Marmorstein den Rücken kehrte.