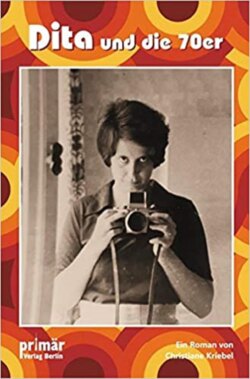Читать книгу Dita und die 70er - Christiane Kriebel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеBerlin, Herbst 1969
Mein Stirnband gab mir in Berlin ein neues Image. Eine Rolle, die es auszufüllen galt. Meine Mitstudenten sahen in mir einen Menschen, der ich gar nicht war. Ich wollte nur meine allzu widerspenstigen Locken bändigen, das Stirnband aber brachte mir bei den Regiestudenten den Namen Blumenkind ein. Meinen richtigen Namen kannte kaum einer. Meine Mutter hatte mich Dita genannt. Der Name kam aus Friesland, das lag in der BRD und dazu noch im Norden Deutschlands. Deine Mutter ist schuld, sagte mein Vater, als ich mich über meinen Namen beschwerte. Meine Mutter war an allem schuld, auch an meiner Erziehung. Diese und ein warnendes Verbotsschild an der Tür hinderten mich nicht, auf unserem Dachboden herumzustöbern. Die Dielen waren morsch oder fehlten an manchen Stellen gänzlich. Fremde Katzen huschten übers Dach. Es knisterte geheimnisvoll. In einer alten braunen Kiste fand ich eines Tages Briefe, die mit einer roten Schleife zusammengebunden waren. Auf dem Poststempel konnte ich die Jahreszahl 1946 erkennen. Vorsichtig öffnete ich sie. Das Papier war vergilbt, doch die Schrift konnte ich gut lesen. Die Briefe erzählten von einer Liebesgeschichte meiner Mutter mit einem Dittmar aus Friesland. Ich fand dieses poetische Intermezzo höchst interessant und stellte voller Genugtuung fest, dass es für meine Mutter noch eine andere Welt gegeben hatte. Wenn auch nur für kurz. Dann kam mein Vater zurück aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft. Er sah meine Mutter beim Heimatfest und tanzte mit ihr zu den Klängen des Boogie-Woogie. Meine Mutter entschied sich für ihre Jugendliebe. Zwei Jahre später heirateten sie und wenige Monate später kam ich auf die Welt. Seit dieser Zeit heiße ich Dita Rolle.
Die erste Hürde auf dem Weg zur berühmten Regisseurin war genommen. Ich lebte 1969 in Berlin, der riesigen Stadt an der Spree. So groß und verwirrend hatte ich sie mir nicht vorgestellt. Da gab es Straßenbahnen, S-Bahnen, U-Bahnen, breite Alleen, enge Gassen mit wandelnden Touristen aus aller Welt, pöbelnde Berliner in Kaufhäusern, hupende Autos und kesse Jören, die den Fahrern einen Vogel zeigten. Berliner haben es immer eilig. Was für ein Gegensatz zu den Thüringern, die gern einmal verweilen, eine Bratwurst essen und mitten auf der Kreuzung nach den Wolken sehen. In der Hauptstadt stand ich am ersten Tag meines Aufenthaltes aufmerksam an einer Ampel und wartete geduldig auf die Grünphase. Bei Grün darfst du gehen, bei Rot bleibe stehen. Aber noch während der Rotphase hatte eine alte Oma gerempelt und geschubst, „nu jeh endlich übern Damm oder willst hier übernachten“, motzte sie mich an. Die Begrüßung aller Studenten und die ersten Seminare fanden im großen Saal des Deutschen Fernsehfunks in Berlin-Adlershof statt. Jeden Morgen setzte ich mich in die S-Bahn, um zum Fernsehfunk zu fahren. Aber immer wieder landete ich, obwohl ich laut Karte in Adlershof landen sollte, in Berlin-Spindlersfeld. Nach einigen Wochen sagte mir ein Kommilitone, dem ich mich anvertraute: Du musst in Berlin-Schöneweide umsteigen.“ So kam ich anfangs immer zu spät. Ich betrat mutig den hell erleuchteten Seminarraum, zog mein Stirnband fest und lächelte schräg. Das empfanden meine Kommilitonen als stille Opposition. Nur meine blumenbemalten Turnschuhe hielten diesen Oppositionshabitus nicht lange durch, beim ersten Regen waren nur noch bunte Kringel zu sehen. Einerseits schmeichelte mir die Aufmerksamkeit meiner Studenten, aber irgendwie nervte sie mich auch. Ein stämmiger Typ unter ihnen, unter dessen Nase ein prächtiger Walrossbart prangte, zog ebenfalls die Blicke der anderen auf sich. Schon am ersten Tag war er mir aufgefallen, denn sein runder, kahl geschorener Kopf leuchtete im Neonlicht der Empfangshalle. Mit seinen blauen Knopfaugen musterte er die Runde und blieb bei mir hängen. Zuerst starrte er auf mein Stirnband, dann visierte er meine blumenverzierten Turnschuhe an. „Kommst du aus San Francisco oder aus Sachsen?“ Berliner mochten keine Sachsen, das wusste jeder. Der Kahlkopf war im Prenzlauerberg, in der Schönhauser Alle geboren, das hatte ich auf seinem Anmeldeformular gelesen. „Thüringen“, nuschelte ich. „Ah, Bratwurst“, sagte er und schmatzte. Mit seinem kurzen Zeigefinger zeigte er auf sich: „Bin Klaus und liebe Bratwurst“. „Ich mag es, in den Wald zu gehen.“ „Aha“, sagte Klaus und lächelte mich an. Von diesem Tag an waren wir Freunde. Er kam immer zu spät oder gar nicht. Wenn er in seinem roten Cordanzug den Hörsaal durchquerte und sich die letzten Frühstückskrümel aus seinem Bartgestrüpp zupfte, trommelten wir auf die Bänke. Er verbeugte sich, erklomm die Stufen zur letzten Reihe und setzte sich neben mich. Da saß oder lag er nun die nächsten Stunden und ließ die Ergüsse der jeweiligen Referenten über sich ergehen. Irgendwie sah er am Tag immer müde aus. In der Nacht erwachte er und sprühte vor Lebensfreude. Sobald Aufgaben verteilt wurden, wurde Klaus krank. Er hustete, röchelte und spülte seinen Hals mit hochprozentigem Alkohol. In den ersten Tagen hatten sich unter den Studenten Gruppen gebildet - die Angepassten, die Fleißigen, die Auffälligen, die stille Opposition, die Extremen, die Anarchisten. Es fiel mir schwer, mich irgendwo einzutakten. Manchmal schwieg oder träumte ich, ein anderes Mal stritt ich mit den Referenten und Kommilitonen. Mitunter neigte ich dazu, alles viel zu ernst zu nehmen. Egal – bald würde ich meine eigenen Filme machen.
An den Wochenenden fuhr ich nach Hause. Während der langen Zugfahrt konnte ich es kaum erwarten, die Berge, den Fluss, meine kleine Stadt und meine Familie zu sehen. Meine Freunde nannten mich plötzlich die Berlinerin. Es klang wie: Du hast es geschafft. Auf dem sonntäglichen Tanztee forderte mich ein Junge auf, der mich früher nie angesehen hatte: „Du, Dita, wie ist es in Berlin“? Wann bist du mit deinem Regiestudium fertig?“ Ich fühlte mich plötzlich fremd. Mit dem Frühzug am Montagmorgen fuhr ich zurück in die geteilte Stadt an der Spree.
Das nächste Wochenende blieb ich in Berlin. Ich wurde zur Party der so genannten Anarchisten eingeladen und nahm Klaus mit. Einer der Anarchisten, der mit den langen dunkelblonden Haaren und den lustigen Sommersprossen im Gesicht, forderte mich zum Tanzen auf. Eng umschlungen standen wir in seiner unaufgeräumten Küche. Auf der blau lackierten Anrichte stand ein nagelneues Tonband. Es dröhnten Songs der Stones durch die große Wohnküche. Unsere Körper bewegten sich zum Takt von „Sympathy for the devil“ und „Satisfaction“. Der Anarchist sprach von Trotzki und der kommenden Revolution. Klaus baggerte eine unscheinbare blonde Studentin an, die einsam auf einem dreibeinigen Stuhl kippelte. Er ließ sich vor ihren Füßen auf ein altes Bärenfell nieder und sprach unentwegt von Liebe und Kirschblüten. „Wer bist du?“, fragte Klaus, als ihm der Gesprächsstoff ausging. „Die Tochter des Ministerpräsidenten“, antwortete sie schlicht und legte die Hände in ihren Schoß. Mein Tanzpartner, der diese Worte ebenfalls vernommen hatte, bewegte sich nun wie in Trance auf das blonde Mädchen zu. Um Mitternacht, als wir auf dem morschen Dach des alten Mietshauses die Lichter der Großstadt bewunderten, verliebte sich die Tochter des Ministerpräsidenten in den dunkelblonden Anarchisten. Klaus blickte melancholisch in den Himmel und faselte was von unerfüllter Liebe. Die junge Frau, die bald im Zentrum des gesellschaftlichen Interesses stehen würde, verschwand mit dem jungen Anarchisten, um ihn zu zähmen.
In den darauffolgenden Wochen wuchsen mir die Menschen des Fernsehfunks immer mehr ans Herz. Ich liebte es, meinen Ausweis beim Pförtner vorzuzeigen, ich liebte es die heiligen Hallen, sprich Studios, zu betreten. Mir schmeckten die Bouletten in der Kantine, ich mochte die Gespräche der Kameraassistenten über die neuesten Filme und die Witze der Beleuchter über meine Bemühungen die Scheinwerfer zu unterscheiden. „Das ist ein 5 kw, nein, ein Zehner“, riet ich. „Nee, det sind gar keine Scheinwerfer, det sind Ditas Augen“, erwiderte Manne stotternd, der adrette Beleuchter mit dem Kaiser-Wilhelm-Bart. Ich bewunderte die Schauspielerinnen, die moderne Kleidung trugen, lässig über den letzten Dreh sprachen und mit den Regisseuren flirteten, als wäre das alles ganz normal und landläufig. Ganz anders unsere Dozenten. Sie schienen die Realität nicht zu kennen. Sie sprachen über Politik, sie sprachen über Volkswirtschaft, sie sprachen über den real existierenden Sozialismus, den wir in unseren zukünftigen Filmen, so schien es mir, erschaffen sollten. Meine Geschichten aus der Knochenmühle zweifelten sie an oder hielten sie für übertrieben. Klaus hielt sich bei Diskussionen mit den Seminarleitern zurück. Obwohl er sehr gute Argumente hatte und jeden aus dem Feld schlagen konnte, öffnete er während des Seminars seine blauen Augen nur so leicht, dass er seine Taschenuhr erkennen konnte. Wurde er zur Diskussion aufgefordert, blickte er den Dozenten müde an. An einem Wochenende im Oktober fuhren wir an den Müggelsee. Klaus rauchte Pfeife, blies den Rauch übers leicht gekräuselte Wasser, trank Rotwein und philosophierte. Er las mir aus einer Westzeitung vor, die Besucher aus West-Berlin liegen gelassen hatten. Einen Bericht über die Hippies verschlangen wir geradezu. Noch sind mir einige Sätze im Kopf, die so oder ähnlich lauteten: „An den Rändern der alten Gesellschaft begannen sie das ungebundene Dasein einer fröhlichen Boheme zu genießen. Der älteren Generation sind sie ein Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch.“ Klaus nickte bei jedem Wort. Ich dachte an meinen Vater. Er selbst hatte mich Gammlerin genannt, nur weil ich einige Tage freiwillig in der Schule gefehlt und seine Unterschrift kunstvoll nachempfunden hatte. Meine Versuche mich ihm zu erklären, schlugen fehl. Klaus verstand mich, sein Vater hatte ihn kurz vor Studienbeginn zum Friseur geschleift, damit er seine nackenlangen Haare stutzen ließ. Der neue Haarschnitt gefiel Klaus nicht und voller Wut rasierte er seinen Kopf kahl. Ich riss den Artikel sorgfältig aus der Zeitung, faltete ihn und steckte ihn in meine Lackledertasche, um ihn im Bett nochmals zu lesen. Klaus hatte andere Sorgen, in den folgenden Wochen wuchsen seine Haare nur einige Millimeter und schimmerten rötlich auf seinem Schädel. Seinen Haaren und seinem Vater gab er die Schuld, dass er bei der Tochter des Ministerpräsidenten nicht gelandet war. Im Spätherbst stießen neue Studenten zu uns. Sie hatten ihren dreijährigen Ehrendienst bei der Volksarmee absolviert und begannen erst jetzt mit ihrem Studium. Einer der neuen Studenten gefiel mir auf Anhieb, Peter. Er war das genaue Gegenteil von Klaus. Groß, schwarzhaarig, pünktlich. Mit seinem großen Fachwissen übertraf er manchen Dozenten. Von seiner Armeezeit erzählte er kaum etwas. „Ich musste dienen“, sagte er, „sonst hätte ich nicht studieren dürfen“. Sein Vater lebte im Westen und arbeitete als Kameramann bei der ARD. Nach dem ersten Kuss vertraute mir Peter an, dass er sich heimlich mit seinem Vater traf, wenn der nach Ost-Berlin kam. Einmal schenkte ihm sein Vater ein Buch über den französischen Regisseur Jean-Luc Godard. Ich lieh es mir aus und verschlang es in wenigen Tagen. In Gedanken zitierte ich Godard: „Filme machen heißt, in Platons Höhle dank Cezannes Licht klar zu sehen.“ Doch ich sah nicht mehr klar. Die DDR hatte Grenzen, für jedermann sichtbar. Nur für mich nicht, ich schwebte in anderen Sphären. Nach den Seminaren saßen Peter, Klaus und ich oft in einer Eckkneipe gegenüber der Rennbahn in Berlin-Karlshorst. Ich träumte mich nach dem zweiten Bier an die Seite Godards, obwohl ich nicht einen Film von ihm gesehen hatte. Peter dagegen verhielt sich weitaus realistischer, er nahm die Referate unserer Dozenten auseinander. Er schrieb während der Seminare mit, las uns Zitate aus ihren Referaten vor und ärgerte sich laut. Denken ist nicht gefragt, wir sollen auswendig lernen und ungefiltert Dogmen aufschreiben. Ich überlegte nicht lange und schrieb während der Seminare nicht mehr mit. Abends gingen wir in eine Adlershofer Eckkneipe, aßen, tranken ein wenig und sprachen laut von unserem Studium, so laut, dass es alle hören mussten. Wir gaben uns so, als würden wir schon zu den Absolventen gehören. Klaus nahm das Studium nicht allzu ernst, viel lieber flirtete er mit der vollbusigen Kellnerin. Jedes Mal, wenn sie sich über seine Schulter beugte, spähte er in ihren weiten Ausschnitt. Erst nach der 6. Boulette und dem 5. Bier mischte er sich in unser Gespräch ein.
Wir diskutierten über Godard, die nouvelle vague und die sterbenden Blumenkinder in den unerreichbaren USA. Wir ereiferten uns über den Slogan unserer Dozenten: ein Regisseur in unserem Staat muss parteilich sein. Wenn Peter sprach, hing ich an seinen Lippen. Er wusste so viel. Oft kritisierte er meine Naivität und ich konterte: „Dir fehlt dafür jegliche Spur von Romantik“. Klaus nickte bejahend in meine Richtung.
Eines Morgens im Mai kamen wir aus der Betriebsakademie, die Sonne schien über den heiligen Hallen des Fernsehfunks. Wir hatten gerade einen Film über den Vietnamkrieg gesehen. Klaus grummelte etwas in seinen Bart. Sein Magen knurrte. Da kamen Panzer aus dem gegenüberliegenden Regiment. Und LKWs mit bewaffneten Soldaten der NVA. Ich blieb stehen und blickte wütend auf die jungen Soldaten. „Hört denn das nie auf, diese Kriege, diese Demonstration von Macht. Ich gebe den Hippies vollkommen Recht, Liebe und Harmonie gegen Gewalt und Machtgier“. Den letzten Satz rief ich laut, doch er ging im Motorenlärm unter. Peter sah mich kurz an, dann sagte er in belehrendem Ton: „Wie willst du mit der Kraft der Blumen eine Gesellschaft verändern. Ost und West stehen sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber“. Ich blickte Peter böse an. Klaus kramte in seiner Tasche nach seinem Ausweis. „Und Mahatma Gandhi, was ist mit ihm und seiner Methode des gewaltlosen Widerstands?“, fragte ich Peter. Wir hatten den gestrengen Pförtner passiert und gingen Richtung Hauptgebäude. „Das musst du die Leute da draußen fragen“, Peter zeigte in Richtung Stadt. „Wer kennt schon Gandhi?“ „Das musst du den Regisseuren, Redakteuren und Politologen sagen, damit sie hier Filme über Gandhi senden“, forderte ich ihn auf. „Setz endlich deine rosarote Brille ab“, schrie mich Peter ungehalten an. Erschrocken blieb ich stehen. Klaus kam auf mich zu, ich zupfte an seinem Walrossbart. Klaus umarmte mich sanft, grinste Peter breit an und ließ seine Zähne blitzen. „Na, Peter, jetzt wird es ernst“, sagte Klaus. „Jetzt ist Handeln angesagt und nicht große Worte, hast doch gehört, was Dita dir vorgeschlagen hat“. „Ihr seid solche Idioten“, sagte Peter und lud uns ins Casino ein.
An den Wochenenden gingen wir zu Klaus, er hauste in einer engen Dachkammer in der Nähe des Adlergestells. Zu Peter konnten wir nicht, denn über ihn wachte seine strenge Vermieterin Frau Seipel. Ich wohnte mit zehn anderen Studentinnen in einer schäbigen Wohnung in Karlshorst. Da sie dem Fernsehfunk gehörte, brauchten wir keine Miete zu bezahlen, doch ab und zu kontrollierte der Wohnungsverwalter.
Eines Nachts im März, Klaus sang „Let the sunshine in“, saß Peter neben mir und flüsterte den deutschen Text in mein Ohr: Wir sehen einander hungrig in die Augen, in Wintermäntel eingehüllt und in Düften aus Retorten, reden von einer Freiheit, die nur auf dem Papier besteht, während mit Musik das Boot, in dem alle sitzen, schon untergeht. Lasst den Sonnschein in Euch hinein. Peter hauchte den Satz in mein Ohr, berührte mit seinen vollen Lippen meinen Hals, die Schulter, seine Hände streichelten mich sanft, mein Körper begann zu vibrieren. Doch irgendwie fühlte ich mich neben ihm unsicher. Ich war in eine Welt geraten, in der ich mich nicht auskannte. Ich kannte die Menschen in meiner Stadt, kannte ihre Geschichten, doch nun saß ein Mann neben mir, den ich zwar mochte, aber von dem ich kaum etwas wusste. Konnte ich ihm vertrauen? Klaus sang an diesem Abend sehr gefühlvoll und jedes Mal, wenn Klaus die Zeile „wir reden von Freiheit, die nur auf dem Papier besteht“ sang, bekam ich eine Ahnung davon, was in der Welt passiert. Wir jungen Studenten in der DDR lebten geschützt im Schatten der Mauer. Soldaten des Friedens mit scharfen Geschützen bewachten uns, sie ließen keinen hinaus und fremde Ideen nicht hinein.
Eines Abends, die letzten Aprilflocken schwebten von den Bäumen, waren wir wieder einmal bei Klaus. Ich hockte auf seinem alten Barhocker am Fenster. Von dort aus konnte ich über die Dächer von Berlin sehen. Peter saß auf einer der Holzkisten, Klaus lag auf seiner großen Matratze. Sein Zimmer quoll über vor Büchern, Schallplatten und Notenheften. Auf den braunen Dielen lagen seine Klamotten malerisch ausgebreitet. Er selbst trug seinen abgewetzten roten Cordanzug und zweifarbige Strümpfe. Peter las aus einem alten Artikel des „Spiegel“ vor, den er auf der Toilette, die sich eine halbe Treppe tiefer im Hausflur befand, gefunden hatte.
„So sehen sie aus, Deutschlands Gammler, langhaarig". Er hob seinen Blick kurz und sah Klaus spöttisch an. Peter zitierte weiter: "trinkfest, schmuddelig, ernähren sich von milden Gaben“. Ich sah zu Klaus. Peter spendierte Klaus oft seine Hauptmahlzeiten. „Der hat genug Westknete“, verteidigte sich Klaus jedes Mal, wenn ich ihn deswegen zur Rede stellte. Peter las weiter: „Sie sorgen sich nicht um ihr Leben und erstreben keinen persönlichen Besitz.“ „Dass die Hippies gegen den Vietnamkrieg sind, steht da nicht“, konterte Klaus und sah zu mir. Das tat er immer, wenn ihn Peter foppte. Es ist einfach unvorstellbar, mitten im Frieden Krieg“, überlegte ich laut und nickte Klaus zu. Da kam mir eine grandiose Idee. „Wir Drei könnten doch einen Kurzfilm drehen, Karl Marx, Lenin und Jesus vereint als Hippies, demonstrieren gegen Gewalt“, schlug ich vor und war über meine Worte erstaunt, die so ungehindert aus meinem Mund heraus spazierten. Peter kritzelte etwas in sein Notizheft. „Tolle Idee, die muss ich festhalten“, sagte er. Darauf war ich nicht gefasst. Wir diskutierten die ganze Nacht. Vor meinem geistigen Auge entstand ein grandioser Film, der die Welt aufrütteln würde. Am nächsten Morgen fuhr ich übermüdet nach Thüringen. Mein Vater feierte seinen 50. Geburtstag. Der D-Zug aus Berlin hatte Verspätung. Wütend saß ich im Abteil. Mein Anschlusszug nach Dornburg sauste im Saaletal an mir vorüber. Ich würde das große Festmahl verpassen. Der Schnellzug fuhr langsamer als gewöhnlich an meinem Heimatbahnhof vorbei, ich griff ohne Nachzudenken zur Notbremse, der Zug quietschte, hielt, es polterte Gepäck durcheinander. Meine rechte Hand riss die Tür auf, ich sprang, rannte zur Böschung und kroch durchs Gebüsch bis zu den Treppen, die mich in die Bahnhofsgaststätte führten. Total erledigt bestellte ich mir einen Kaffee. Die Wirtin gähnte, der Morgen dämmerte zum Fenster hinein. Die Wirtin reichte mir den Kaffee, ich lief auf einen der freien Tische zu, entdeckte in einer Ecke unseren Nachbarn, der aus der Nachtschicht kommend, dort immer noch verweilte. Er winkte mich zu sich heran. „Willste`n Bier?“, fragte mich der sonst so stille Mann. Ich schüttelte den Kopf. Schweigend saßen wir am Tisch. Mein Knie schmerzte und meine Hand zitterte leicht, als ich die Mitropa-Tasse an meine Lippen führte. Gegen Mittag sagte er: „Meine Frau kommt bald aus Apolda, ich muss gehen.“ Wir liefen langsam die vielen Stufen zum Ort hinauf, müde trug er meinen Koffer. Mein Knie schmerzte unerträglich, doch glücklich gratulierte ich meinem Vater zu seinem Ehrentag. Am späten Abend kam ein unerwarteter Gast, ein Gartennachbar meines Vaters. Er war im Dienst. Bevor er meinem Vater gratulierte, zog er seine Polizistenuniform glatt. Dann tuschelten sie und blickten zu mir. Ich unterhielt mich mit unserer Nachbarin. „Dita ist gerade erst gekommen“, sagte mein Vater laut. „Nein“, sagte die Nachbarin, „Dita ist doch schon seit heut Morgen da, mit dem Frühzug zusammen mit meinem Mann, als der aus der Nachtschicht kam“. „Und wer hat den Schnellzug angehalten?“, fragte der gütige Polizist nach seinem dritten Bier. Keiner wusste es, auch die Gäste aus Sachsen-Anhalt nicht, die ebenfalls mit dem Schnellzug gefahren waren. „Gott sei Dank kamen keine Personen zu Schaden“, sagte der Ordnungshüter zu meinem Vater und schüttelte seinen Kopf. „Du bekommst von mir die neue Sorte Kartoffeln“, versprach mein Vater seinem Nachbarn, dem Polizisten. Am nächsten Tag, einem Sonntag, humpelte ich durch meine Stadt und wurde von jedermann gegrüßt. Dita hast du schon gehört, irgendjemand hat den Schnellzug angehalten, Personen kamen aber nicht zu Schaden“, sagten sie. „Das hätte schief gehen können“, raunten die Alteingesessenen hinter vorgehaltener Hand und zwinkerten mir zu. Dann gingen sie nach Hause, aßen ihre Thüringer Klöße und tranken Apoldaer Glockenhell.
Der Monat April neigte sich seinem regenreichen Ende zu. Ich arbeitete das Treatment für unseren Film aus. Den Titel hatte ich schon: „Genosse Jesus und seine Brüder“. Mein Vater begann mit den Gartenarbeiten, neben ihm stand der Polizist und ließ sich erklären, wie er die neue Sorte Kartoffeln anbauen sollte. Ich fuhr zurück nach Berlin und freute mich auf meine Freunde. Als ich an Peter dachte, tanzten Schmetterlinge in meinem Bauch. Doch schon in der ersten Stunde unseres Wiedersehens spürte ich eine Spannung zwischen Peter und Klaus. Klaus hatte Peter im Alkohol einen Opportunisten genannt, mehr bekam ich nicht heraus. Auch mir gegenüber verhielt Peter sich merkwürdig. Griff ich nach seiner Hand, zuckte er zurück. Von meiner Filmidee wollte er nichts mehr hören. „Lass mich damit in Ruhe, lern lieber für die Prüfung“, fuhr er mich an und ließ mich einfach stehen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Klaus trank nur noch und lag mit der vollbusigen Kellnerin auf seiner großen Matratze. Die Tage vergingen. Mein Dozent Steil, ein zierlicher Mann Mitte Vierzig, nahm mich nach der Kameraprobe zur Seite und fragte mich: „Was ist denn los? So kenne ich dich gar nicht. Sitzt nur während der Proben und grübelst.“ Ich sah in seine großen braunen Augen. Und erzählte von Peter und von der Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. „Ich werde mit Peter sprechen“, versprach mir Steil. „Nein“, sagte ich, „werde meine Idee auch so durchziehen“. „Was für eine Idee?“, fragte er, doch wir wurden vom Kameraassistenten unterbrochen. „Ihre Frau wartet in der Requisite“, sagte er. Wir müssen sprechen“, sagte Steil und ging zu ihr. Am Wochenende lud Steil mich zu sich nach Hause ein. Er wohnte mit seiner Frau auf einem herrlichen Waldgrundstück in einem Vorort von Berlin. Am Abend tranken und aßen wir vorm Haus unter einer riesigen Blautanne. Nach der zweiten Flasche teuren Rotweins, seine Frau räumte den Tisch gerade ab und brachte die leeren Teller in die Küche, sagte Steil leise zu mir: „Wenn ich dir einen guten Rat geben kann, halt dich von Peter fern.“ Ich muss ihn so entsetzt angesehen haben, dass er aufstand und eine neue Flasche Wein holte. Ein Eichhörnchen flitzte im Morgengrauen über die taunasse Wiese, kletterte in Windeseile eine alte Eiche hoch und beäugte uns aus dem Wipfel. Wir sprachen über Ideale und Visionäre, von Peter sprachen wir nicht mehr. Einige Tage vor der Prüfung wurden Klaus und ich zu einem Gespräch in die Betriebsakademie eingeladen. Die Kommilitonen tuschelten und lernten eifrig für die Prüfung. „Das klingt wie eine Vorladung“, sagte die Tochter des Ministerpräsidenten freundlich, ich drücke euch die Daumen. Mit gemischten Gefühlen ging ich in die helle Baracke. Die Sommerhitze knallte auf das Dach. Mein Leinenhemd klebte an meiner Haut. „Was soll ich hier“? fragte ich mich immer wieder. Die große graue Uhr im Vorzimmer tickte wie ein Zeitzünder. Klaus kam aus der Tür des neuen Parteisekretärs, zog eine Grimasse und zuckte mit der Schulter. Ehe ich ihn etwas fragen konnte, wurde ich selbst zum Gespräch gebeten.
Die grauhaarige Vorsitzende der Kommission fragte mich, wie es mir beim Deutschen Fernsehfunk gefiele, was ich von meinem Studium der Regie erwarte und wie ich zu dem Slogan „Ein Regisseur in unserem Staat muss parteilich sein“ stünde. Als ich antworten wollte, schnitt man mir das Wort ab. „Es ist bereits alles bekannt, ich möchte mir das nicht anhören", warf der Parteisekretär ein und schaute in die Runde. Die Vorsitzende atmete schwer. Für ihn sei es unerklärlich, warum ich das Andenken von Marx und Lenin in den Schmutz ziehen wolle. Nach wenigen Minuten durfte ich gehen. Klaus wartete am Ausgang auf mich. „Ich weiß nicht, was da vor sich geht“, raunte er mir zu. Er flüsterte den ganzen Weg und drehte sich laufend um. Ich lief zum Adlergestell, um zu Peter zu gehen. Klaus sträubte sich anfangs, doch dann trabte er willig mit. „Peter wird es uns erklären, er weiß doch immer alles“, versuchte ich Klaus zu beruhigen. Wir klingelten am kleinen Haus am Ende der Lindenstraße. Frau Seipel, seine Wirtin, öffnete. Sie sah uns erschrocken an, dann stützte sie sich auf ihre Krücke und flüsterte: „Peter ist weg. Er musste innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen.“ Sie wies mit ihrer Krücke in Richtung Westen. Danach schenkte sie selbst gemachten Eierlikör ein und erzählte uns in ihrer Wohnung von ihrem verstorbenen Ehemann Gustav. Ein feiner Mann war er, dazu ein Künstler. In der Oper hat er gearbeitet, sagte sie und blickte auf ein Porträt, das auf einer alten braunen Kommode stand. Ich konnte kaum zuhören, der dicke Eierlikör verklebte meine Gehirnwindungen, doch ich dachte die ganze Zeit, irgendwo, irgendwann wirst du Peter wiedersehen. Dann wirst du ihn fragen, was war da los? Spät in der Nacht fuhr ich in meine Studentenbude und schlief unruhig bis in den späten Nachmittag hinein. In meinem Kopf explodierten Gespräche, Wortfetzen erreichten mich und hämmerten gegen die Schläfen.
Der Tag der Prüfung war gekommen. Die Aufgaben fielen mir leicht. Klaus saß neben mir. Er roch nach kaltem Rauch und schalem Bier. Er grinste breit unter seinem Wallrossbart: das machen wir doch mit links. Nach einer Woche wurden uns die Prüfungsergebnisse mitgeteilt. Drei Studenten waren durchgefallen, ich gehörte dazu. Klaus sah mich fassungslos an. „Du doch nicht“, stammelte er.