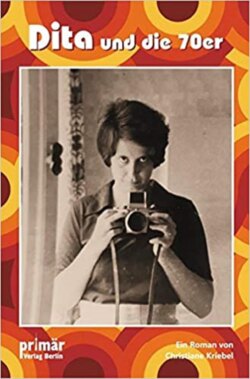Читать книгу Dita und die 70er - Christiane Kriebel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.Kapitel
ОглавлениеDas Angebot von Steil als Kameraassistentin zu arbeiten, lehnte ich ab. Aus Scham? Ich weiß es nicht mehr. Meine Aufenthaltsgenehmigung für Berlin wurde nicht verlängert. Damals brauchte jeder Bürger eine Genehmigung für die Hauptstadt, um dort arbeiten und wohnen zu können. Mitarbeiter des Fernsehfunks bekamen automatisch eine. Ich gehörte nicht mehr dazu, flog aus meiner Studentenbude, da sie dem Fernsehfunk gehörte. Den Sommer über schlief ich heimlich in meiner ehemaligen Studentenbude. Ich half der Kellnerin in der Eckkneipe. Sie fragte nach Klaus. Doch der ließ sich nicht sehen. Ende August kamen die Studentinnen frohgelaunt und erholt aus den Ferien. Den Mädchen tat ich leid. Sie teilten mit mir ihre Geheimnisse und ihr Brot. Eines Nachts kontrollierte der Verwalter die Wohnung, entdeckte mich und schmiss mich raus. Eine schlimme Nacht.
Ich schleppte meinen Koffer in die Eckkneipe, die Kellnerin nahm ihn mir ab, deponierte ihn im Keller und spendierte mir einen Kaffee. Nach Schankschluss verließ ich die Kneipe. Müde schleppte ich mich zur letzten S-Bahn und fuhr zur Friedrichstraße. Stieg aus, lief zur Spree und setzte mich ans Wasser. Irgendwann lief ich die Friedrichstraße Richtung Osten, bis ich zur Invalidenstraße kam. Vor einem Hotel, es hieß „Neva“, standen russisch sprechende Gäste. Ich blieb stehen, blickte um mich. Die russischen Männer begannen leise zu singen. In der Ferne entdeckte ich eine Kirche mit einem wunderschönen schlanken Turm, der vom hellen Mondschein angestrahlt wurde. Ich lief weiter, angezogen von diesem Bauwerk, das Geborgenheit versprach. Ein metallenes Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Zehn Schritte vor mir war eine hohe Mauer. Ich sah auf und blickte in die Mündung eines Maschinengewehres. Das Gewehr gehörte dem Posten, der seine Ehrenwache vor dem imperialistischen Schutzwall hielt. Kehrt Marsch, befahl mir eine innere Stimme. Auf meinem Rückzug in ungefährliche Straßenzüge sah ich an einem Hotel eine Tafel. Ein Sekretär und Hotelgehilfen wurden gesucht. In der Nähe befand sich ein kleiner Park. Ich setzte mich auf eine Bank. Der Mond strahlte auf ein Rondell, vergessenes Kinderspielzeug schwamm im Becken. Irgendwann, während die Zeit still zu stehen schien, schlief ich auf der Parkbank ein. Die ersten Sonnenstrahlen weckten mich, ich fror entsetzlich, stand auf und hüpfte auf der Stelle, um warm zu werden. Aus einer Fontäne begann Wasser zu sprühen. Ich hielt meinen Kopf darunter, bis ich hellwach war. Ein großer schwarzhaariger Mann tauchte auf, um seinen Hals hing ein Autoreifen. Er grüßte mich: „Olympiakader, wat?“ Ich nickte. „Gehste mit zu „Franken“ Kaffeetrinken?“ fragte er. Ich nickte. Wir tranken in der Kneipe einen starken Kaffee. „Bin Kalle“, stellte er sich vor, „arbeite in der Reifenbude, Chausseestraße, Hinterhof, wenn wat is, kommste vorbei“. Er stand auf und bezahlte beide Kaffee. Ich sah ihn erstaunt an. „Oder kommst hier in die Kneipe, ick sitze hier jeden Abend. „Muss jetzt malochen, bis dann“. „Danke“, sagte ich. Er gab mir seine große schwielige Hand und ging. Wenige Minuten später verließ ich die Kneipe. Wieder sah ich mich um, las die Straßenschilder, die Kneipe befand sich Ecke Novalisstraße. Muss ich mir merken, dachte ich und lief zur Invalidenstraße. Wo war denn dieses Hotel mit den Stellenangeboten? Ich überlegte und fand es nach wenigen Minuten. Ein großes fünfstöckiges Haus, gebaut um die Jahrhundertwende. Der blonde Empfangssekretär beorderte mich zum ersten Stock. Dort befand sich das Personalbüro. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich klopfte und eintrat. Die Kaderleiterin ordnete ihre Personalakten, bis sie in Reih und Glied standen. Dann blickte sie zu mir auf. Ich bündelte meine restliche Energie: „Ich möchte mich bei Ihnen als Empfangssekretärin bewerben“. Sie fragte mich kurz nach meinem Werdegang. „Abitur, Arbeit am Fließband ...“ Hier unterbrach sie mich. „Das sind gute Voraussetzungen. Arbeit am Fließband, Erzeugung von Pappe. Pappe wird in unserer Republik dringend gebraucht“. „Und beim Fernsehfunk hat es Ihnen nicht gefallen“. Sie blickte mich fragend an. „Prüfung verhauen“, sagte ich. „Nun, das macht nichts, auch hier können Sie etwas werden. Außerdem sind wir in der Lage, ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung für Berlin auszustellen“. Sie schob mir ein Papier zu, das ich unterschreiben sollte. In meinem Kopf hämmerte es: Unterschreib, du brauchst die Aufenthaltsgenehmigung für Berlin, du bist sonst eine illegale Person. Ich will hier nicht als Empfangssekretärin arbeiten, meckerte eine unterdrückte Stimme in meiner rechten Schädelhälfte. „Ingmar Bergmann, hilf mir“, flüsterte es in mein linkes Ohr. Erst jetzt fiel mir auf, in welchem Hotel ich gelandet war. Es gehörte dem FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund der DDR. Nun, das war mir egal. Nur das, was ich las, gefiel mir gar nicht. Du sollst nicht mit den Gästen aus dem kapitalistischen Ausland sprechen oder gar Freundschaft schließen. Es folgten weitere Verbote: Schriften jeglicher Art, Zeitschriften, Literatur, Propaganda müssen sofort der Hoteldirektion oder dem Parteisekretär übergeben werden. Die nächsten Punkte las ich nicht. Ich schob das Blatt zurück. „Unterschreiben Sie ruhig“, sagte die Kaderleiterin und lächelte mich freundlich an. „Es wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie gekocht“, meinte sie augenzwinkernd. Ich würde viele Menschen kennen lernen, Menschen aus aller Herren Länder. Ich, dass junge Mädchen aus dem kleinen Ort über der Saale, ich würde mit ihnen reden, Französisch oder Englisch. Für einen Moment vergaß ich, dass meine Sprachkenntnisse eher mangelhaft waren. Ich würde viele Geschichten hören, lustige, spannende oder gar poetische. Vielleicht würde ich sogar einen Gast kennen lernen, in den ich mich verlieben könnte. Die Kaderleiterin brachte mich zur Tür und verabschiedete mich. Als ich am Empfang vorbeiging, sah ich eine zierliche Sekretärin bei der Arbeit. Diese bildhübsche Person strich sich über ihre Pagenfrisur und lächelte mich an, während ihr ein Kellner Kaffee servierte. „Constanze, dein Käffchen, meine Süße“, sagte er, küsste sie auf die Stirn und öffnete sich selbst eine Flasche Bier.
Als ich meine Klamotten aus der Karlshorster Eckkneipe holen wollte, lief mir Klaus über den Weg. Einsamkeit schlich sich in mein Herz. Er umarmte mich, ich fror. Nach meiner Exmatrikulation mochte ich Klaus nicht sehen, ein Gefühl der Ohnmacht und der Wut beherrschten meine Gedanken. „War oft hier, hab nach dir gefragt“ eröffnete Klaus vorsichtig das Gespräch. Ich sah ihn an. Er kramte seinen Tabakbeutel aus seiner Tasche. Klaus trug eine neue Jeans und ein blaues Hemd. Seine Haare waren gewachsen und ordentlich gekämmt. Ich sah ihm in die Augen. Er strahlte. „Sei froh, dass du geflogen bist, die drehen total auf“, sagte er. „Wer nicht in der Partei ist, fliegt“. „Du übertreibst“, sagte ich und bewunderte weiter seine Jeans. Frau Seipel hat Peter in West-Berlin besucht“, erklärte Klaus, als er meine Blicke sah. „Tolle Levis“, sagte ich. „Hat er dir nichts ausrichten lassen?“, fragte ich ungehalten. Mein Herz begann zu jagen. Klaus gab mir einen Brief von Peter. „Flower Power“, sagte ich leise und sah Klaus an. Dann begann ich zu lesen. Peter überließ mir sein Zimmer bei Frau Seipel, er hatte für das nächste Quartal schon bezahlt. Ich suchte vergeblich ein persönliches Wort, eine Erklärung für all das, was geschehen war. „Ich muss was trinken“, sagte ich und bemühte mich nicht in Tränen auszubrechen. „Na, ab in unsere alte Kneipe.“ Klaus steuerte auf unsere Eckkneipe zu. Dort spielte er wie immer seine Rolle als armer Student, die Kellnerin spendierte Klaus ein Bier und mir eine Berliner Weise. „Vielleicht hab ich im Suff gequatscht“, sagte er. „Keine Ahnung.“ Klaus trank sein Bier in schnellen Zügen. „Vielleicht hat ihn sein Vater freigekauft. Der ist bei der ARD, hat dort einen guten Posten. Peter wollte immer rüber.“ Ich spürte Peters Lippen an meinem Ohr, hörte seine Worte: wegen dir würde ich im Osten bleiben.
Nirgends fand ich eine klare Antwort auf meine Fragen. „Na gut, es war meine Idee mit dem Film, aber wir haben doch nur darüber gesprochen. Klaus, sag doch was!“, bat ich. Klaus starrte vor sich hin. „Ach, Marx, Lenin, ach, Jesus, warum habt ihr mir das angetan?“, fragte ich still. Nach dem dritten Bier schrie er mich an „Du bist nicht schuld!“ Die Spannung löste sich. Wie hätten wir auch schuld sein können? Wir hatten nichts getan. Klaus lallte: „Peter ist an allem schuld. Er hat uns verraten.“ „Und Du …?“, fragte ich ihn. Die Berliner Weiße schmeckte nicht, und Klaus schien mir fremd. Unter seinem Kragen lugte das Parteiabzeichen vor. Mein Hippie Klaus war in die SED eingetreten.
Herbst 1970
Nun gehörte mir Peters Zimmer. Verstaubte Bücher standen auf einem wurmstichigen Regal. Bücher aus dem alten Berlin, wie mir Frau Seipel versicherte. Ein Buch, in Leder gebunden, gefiel mir besonders: W. Raabes „Chronik der Sperlingsgasse“. Ich blätterte in ihm und begann zu lesen. Am Wochenende lag ich im Bett, redete mit Frau Seipel in der engen Wohnküche, oder besser gesagt, ich hörte ihr zu und ihr Leben zog an meinen Ohren vorüber. Sie sprach liebevoll von ihrem viel zu früh gestorbenen Mann, der an der Staatsoper gearbeitet hatte. Am Abend hörten wir alte Schellackplatten von Caruso und die neuesten Aufnahmen ihrer Lieblingssängerin, der Callas. In der Nacht kreisten meine Gedanken um die Exmatrikulation. Am Montagmorgen lag ich wie eingegraben in meinem Federbett, konnte nicht aufstehen. Frau Seipel scheuchte mich auf. „Geh arbeiten“, schimpfte sie und drohte mit ihrer Krücke. „Du brauchst die Aufenthaltsgenehmigung. Ich muss sie den Behörden vorzeigen, sonst kannst du hier nicht wohnen“. Ich fuhr zum Gästehaus des FDGB und meldete mich bei der Kaderleiterin. Der Job als Empfangssekretärin war am Wochenende vergeben worden, obwohl sie ihn mir versprochen hatte. „Sie können bei uns auch ein Vierteljahr als Hotelgehilfe arbeiten“, schlug sie mir vor. „Was bleibt mir anderes übrig. Ich brauche die Aufenthaltsgenehmigung“, entgegnete ich trotzig. Ich fing noch am gleichen Tag an. Ich trug Koffer, sortierte Teller und Tassen, half alten Damen in deren Mäntel und musste mir den Tratsch der alten Garderobiere anhören. Sie musste einmal bessere Tage gesehen haben. An jedem Finger trug sie Ringe und um den Hals eine dicke goldene Kette. Manchmal kam der Empfangssekretär zu uns, dann standen sie nebeneinander und tuschelten. Oft schleppte ich die schweren Mäntel ohne Hilfe. Sie kassierte und bekam das Trinkgeld. Hatte meine Kollegin einen guten Tag, goss sie mir Westkaffee ein und erzählte von ihrer Liebe zu einem jungen Wehrmachtssoldaten. Dann veränderte sich ihr Gesicht. Ihre vom grauen Star gezeichneten Augen begannen zu glänzen, und Tränen rannen ihr über die welken Wangen. Ich nahm sie in den Arm. „Manche Wunden heilen nie“, schluchzte sie und schimpfte auf die Franzosen, die ihn erschossen hatten.
Eines Tages im Oktober, der Wind pfiff über die Invalidenstraße, fragte ich sie nach der Kirche, die wir vom Garderobenfenster aussehen konnten. „Kennen Sie die schöne Kirche mit dem schlanken Turm?“ „Das ist die St. Sebastian Kirche“, antwortete die Garderobiere, ohne aufzublicken. „Wie komme ich da hin?“, fragte ich interessiert. „Da gehst du die verlängerte Gartenstraße lang über die Bernauer Straße.“ Sie hielt kurz inne, überlegte, schüttelte ihren Kopf, so dass ihre silbergrau glänzenden Locken hin und her flogen. „Ach, Quark mit Soße“, sagte sie ärgerlich, „da kommst du nicht hin, die Kirche ist doch im Wedding, also im Westen.“ Sie atmete tief ein. „Als Kind bin ich dort zum Religionsunterricht gegangen. Die Kirche befindet sich auf einem freien Platz, hinter dem Gebäude stehen Bäume und Büsche. Wie gern bin ich mit den Jungs auf diese Bäume geklettert. Sie goss mir eine dritte Tasse Kaffee ein. Das war noch nie vorgekommen. „Manchmal waren wir auch in den Büschen. Wenn det Muttern gewusst hätte“, bemerkte sie mit einem Augenzwinkern. „Das bleibt aber unter uns Pastorentöchtern“, sagte sie streng.
Am Abend rief mich Frau Seipel in ihre gute Stube. „Was hockst du in deinem Zimmer und starrst auf die Straße?“, sagte sie. „Komm, wir machen es uns gemütlich, trinken ein schönes Fläschchen Wein und gucken in die Glotze.“ Gemeinsam sahen wir den französischen Film „Die schwarze Tulpe“ mit Alain Delon in der Hauptrolle. In der Nacht träumte ich von ihm. Am Morgen, als ich in der Empfangshalle des Hotels von wilden Gewerkschaftsbossen aus aller Welt umringt war, die ihre Koffer mit den Füßen in alle Richtungen stießen - manche trafen mich - wünschte ich mir exakt so einen Ritter herbei, der um sein Mädchen und für Gerechtigkeit kämpft. Dann kann er mir vielleicht auch beim Koffertragen helfen oder Aschenbecher säubern, dachte ich noch.nbUnd dann kam Er! Gemeinsam mit dem Direktor betrat er die Empfangshalle. Die Ähnlichkeit mit Alain Delon fiel mir sofort auf. Sonnengebräunte Haut, schulterlanges schwarzes Haar, mittelgroße, schlanke Statur. Der Direktor fragte etwas und der junge Mann schüttelte seinen Kopf. Weit und breit war kein einziger Gast zu sehen. Der junge Mann stierte zu uns rüber an die Garderobe. „Ach, der Urlauber ist wieder da“, sagte die Garderobiere. „Watt stehste da wie anjejossen …?“, rief sie ihm zu. Er kam langsam auf uns zu. Ich bemerkte, dass er seine Brust herausdrückte und beim Laufen sein linkes Bein leicht nachzog. Er trug eine schwarze Lederjacke, die ihm lose um seine schmalen Schultern hing. Unentwegt sah er mich mit seinen großen graugrünen Augen an. Schließlich beugte er sich über die Theke und stellte sich vor: „Ich bin Hans, fahr hier den Boss.“ Unsere Blicke begegneten sich erneut. Ich konnte seinem Blick nicht standhalten und musste wegsehen. Er reichte mir seine Hand, sein Händedruck war angenehm. Sekundenlang schloss er seine Augen. Mir fielen seine seidig langen schwarzen Wimpern auf. Als er die Augen wieder öffnete, leuchteten sie meergrün. „Du gehörst nicht an die Garderobe“, sagte er unvermittelt. „Quatscht dich einer dumm an, sag mir Bescheid“. „Spiel dich nicht so auf“, sagte die Garderobiere, stellte sich neben ihn und bot ihm eine Zigarette an. Ich beobachtete, wie er rauchte. Er tippte vor jedem Zug die Zigarette mit dem Zeigefinger zwei Mal an, dann erst führte er sie zu seinen Lippen. „Wenn du Zeit hast, kannst du mich ja heute Abend nachhause fahren“, rief sie ihm nach. Er nickte ihr zu und ging zum Treppenaufgang. Auf der dritten Stufe drehte er sich noch einmal um und lächelte, so dass ich seine makellosen weißen Zähne sah. „Der ist nichts für dich“, flüsterte mir die Garderobiere zu. „Und außerdem ist er vergeben. Seine Braut hat hier mal gearbeitet, hinterm Tresen, jetzt ist sie Bardame. Die Helge ist eine für Männer - schick, teure Kleider, aber sie ist 10 Jahre älter als er.“ Sie wienerte ihren Ring. „Er ist nicht mein Typ“, sagte ich. Die alte Garderobiere sah mich erleichtert an.
Hans war schon nach einer Woche mein Held. Als ich nach Dienstschluss die dunkle Invalidenstraße betrat, kam eine Gestalt, die an der Ecke lauerte, auf mich zu. Es war ein Hotelgast, der zu viel getrunken hatte. Er blieb vor mir stehen, umarmte mich und versuchte mich zu küssen. Als ich ihn abwehrte, griff er mich tätlich an. Plötzlich stand Hans neben mir, ich sah seine Faust an meinen Augen vorbeifliegen. Der betrunkene Mann stürzte und lallte etwas Unverständliches. Hans, mein edler Ritter. „Du zitterst ja“, bemerkte er und legte den Arm um mich. Er führte mich in die kleine Kellerkneipe neben dem Hotel. Wir setzen uns in eine Ecke und Hans bestellte Bier. Nach dem dritten Bier sah ich nur noch Alain Delon in ihm. Ich musste an „Die schwarze Tulpe“ denken. Der Titelheld beraubte als verkleideter Ritter seine reichen Freunde und schenkte das Geld den Armen. Er kämpfte für das Recht der Unterdrückten und Gedemütigten, dachte ich nach einem neuen Glas. Nach dem fünften Bier war Hans mein „Mein Held und Ritter“. Hans sah mich an. Dann fuhr er mich mit dem Dienstwagen des Direktors, einem großen, teuren Volvo nach Hause. Es nieselte. Die Gaslaternen zeichneten auf der regennassen Asphaltstraße helle Lichtinseln. Wir hielten in der stillen Nebenstraße, in der ich wohnte. Meine Hände zitterten vor Aufregung. Hans küsste mich, die Scheibenwischer rasten über die Frontscheibe. Er hatte vergessen, sie auszuschalten. Ich saß vollkommen durcheinander im warmen weichen Sitz des Autos. Gedankengewitter in meinem Hirn. Erst wurde ich durch einen betrunkenen Mann belästigt, jetzt streichelten mich die Hände eines anderen Mannes zärtlich. Mein Mund öffnete sich leicht, ich spürte seine festen warmen Lippen. Mein Herz schlug wie wild. Sein Verlangen wurde immer heftiger, doch irgendwann legte sich eine bleierne Müdigkeit über mich, so dass ich sein Begehren nicht erwidern konnte, ihn sanft von mir drückte. „War wohl ein bisschen zu viel für dich“, kommentierte er die Situation. Er gab mir einen Abschiedskuss und fuhr los. Hans trennte sich von seiner Freundin Helge. Sie nahm oft Freunde mit, um weiter zu trinken, während Hans zum Hotel fuhr, um zu arbeiten. „In der letzten Zeit haben sie sich sogar geschlagen“, vertraute mir die Garderobiere an. Es gab im Hotel nichts, was sie nicht wusste. Manchmal beobachtete sie mich heimlich. Ob sie etwas ahnte …?
Hans hasste Tratsch und vermied es, seinen Arm im Hotel um mich zu legen, doch er brachte Selbstgekochtes oder Geschmortes für mein Abendbrot mit. Einmal stellte er uns Kuchen auf die Garderobe. „Hab ein neues Rezept ausprobiert, kostet mal“, sagte er. Das Stück Kuchen schmeckte sehr gut. Mir dagegen fehlte jegliches Interesse am Backen oder Kochen. Meine Mutter backte jeden Sonnabend herrlichen Kuchen. Sie freute sich, wenn es uns Kindern schmeckte. Rühren durften wir, auch die Schüssel ausschlecken, aber alles andere machte sie viel lieber selber. Hans erzählte mir von seiner Mutter Lore, dass sie Blumen liebe und im Sommer heizen würde. Sie wäre klein und quirlig, sein Vater Gert dagegen groß, dick, aber trotzdem sehr beweglich. Nun rief Hans seine Eltern an, erzählte seiner Mutter: ich hab jetzt eine neue Freundin mit Abitur. Mit ihr kannst du über Literatur sprechen und mit Vater kann sie Walzer tanzen, sogar linksrum. Seine Mutter lud uns fürs Wochenende ein. Schon am nächsten Tag rief sie Hans an und fragte, was sie für uns kochen solle. Hans grinste mich an. Am Wochenende fuhren wir aufs Land. Seine Eltern besaßen ein zweistöckiges Haus mit Hof, Hund und Scheune in einem kleinen Dorf bei Berlin. Ich wurde von seinen Eltern freudig aufgenommen und Hans ausgiebig gelobt: gute Wahl, das Mädchen. Hans stand mit breiter Brust im Wohnzimmer und zeigte mir dann die vielen Pflanzen auf dem Fensterbrett. Nachdem mir das Qualitätssiegel aufgedrückt worden war, fühlte ich mich wie Exquisitware. Ein Fest wurde veranstaltet und ich tanzte mit Gert, dem Vater von Hans, Walzer. Nach und nach stellten sich die Freunde, die Nachbarn und die entfernten Nachbarn aus dem Dorf ein. Die Funktürme thronten über den niedrigen Dächern des Dorfes und sandten die neuesten Nachrichten aus: Hans hat eine Freundin, die kann Walzer linksrum tanzen. Hans wohnte in einem Nebengebäude des Hotels. Wenn er auf der Arbeit war, kamen die Zimmerfrauen und reinigten sein Zimmer. Sie hatten bei ihm nicht viel zu tun, er baute sein Bett, wie er es bei der Armee gelernt hatte. Sein Zimmer befand sich direkt unter dem Dach des sechsstöckigen Gebäudes. Schien die Sonne, sah ich die „Goldelse“ aufblitzen im Tiergarten hinter dem Brandenburger Tor. Unerreichbar für mich und für jeden, der nicht so prominent war, dass er nach West-Berlin reisen durfte.
Der Herbst zog ein, die Vögel versteckten sich im Weinlaub, das in allen Farben leuchtete. Weit über den mit Antennen beladenen Dächern der Stadt formierten sie sich zu einem großen offenen V. Sehnsuchtsvoll sah ich ihnen nach und fühlte mich eingeengt in der großen Stadt und von den vielen Menschen. Noch konnte Hans sein Motorrad benutzen, die Temperaturen verweilten bei 15 Grad. An einem freien Tag fuhren wir nach Potsdam, spazierten durch die so prächtig angelegten Gärten und tranken in einem Gartenlokal dünnen Kaffee. Hans erzählte von seinem Sommerurlaub am Schwarzen Meer. Ich konnte ihm nicht zuhören, neue, immer wiederkehrende Gedanken quälten mich. Mein Sommer war verflogen und meine Illusionen auch. Was sollte ich tun, fragte ich mich. Im Hotel bleiben, nur wegen der Aufenthaltsgenehmigung für Berlin? Ich sah, wie der Nebel sich über die Herbstblumen legte und wehmütig dachte ich an das farbenprächtige Laub im Garten meines Vaters. Hans legte seinen Arm um mich. Jetzt schmeckte sogar der quasi-Kaffee. Ich fühlte mich geborgen im großen herbstlichen Garten von Sanssouci. Von irgendwo klang eine Flöte. Hans hielt meine schmalen Finger in seiner kräftigen Hand. „Der Alte Fritz war ein bedeutender Feldherr“, platzte es unvermittelt aus ihm heraus. „Er hat auch Flötensonaten komponiert“, ergänzte ich. „Nee“, empörte sich Hans. „Das war ein anderer. Flöte passt doch nicht zu einem echten Preußen“. „Doch“, konterte ich, „und geschrieben hat er auch“. „Bei dir müssen wohl alle schreiben können.“ Hans grinste und zog mich fester an sich. Wieder spürte ich seine körperliche Anziehungskraft, nahm seine Hand, drückte sie leicht an meine Wange und umarmte ihn dann stürmisch.
Am nächsten Tag hatte mich der Alltag wieder. Irgendwie fühlte ich mich im Hotel nicht dazugehörig. Hans fuhr den Direktor zu einem dreiwöchigen Lehrgang nach Dresden. Er fehlte mir, und ich sehnte mich nach seiner Nähe. Die Arbeit fiel mir schwer. Die Koffer zogen an meinen Armen. Die Geschwätzigkeit der Garderobiere zehrte an meinen Nerven. Anders verhielt es sich mit den Gästen, sie kamen aus dem Libanon, aus Zypern, aus Afrika, aus den USA. Frauen aus Ghana drückten mich freundlich an sich. Manchmal legte mir ein Gast schüchtern Trinkgeld in meine Hand, ich umschloss es mit meinen Fingern, verbarg es vor den Blicken der Garderobiere und der Zimmerfrauen. Sie empfanden mich als Kuriosum des Sozialismus, gaben mir Ratschläge, doch kaum einer half mir beim Tragen. Die Zimmerfrauen bekamen Seide aus Indien oder kleine Pyramiden aus Ägypten, Nicht selten schlenderte ich durch die Hotelgänge und so manches Mal verirrte ich mich. Mir fehlte ein Ort, an dem ich zur Ruhe und Besinnung kommen konnte. Endlich hatte ich einen ungewöhnlich schönen Schlupfwinkel gefunden, um in den wenigen freien Minuten zu entspannen, mein Brot zu essen und Kaffee zu trinken, und nahm ihn für mich in Beschlag. Es war eine enge fensterlose Kammer, sie lag unter der Treppe, die zum ersten Stock führte. Das Hotelpersonal benutze sie als Abstellraum. Verstaubte Akten lagen neben Handfeger und Schaufel. Ich räumte diesen Raum auf, ließ vom Hauselektriker die Lichtleitung reparieren und bezog mein „Büro“. Hinter den entstaubten Akten versteckte ich meine Bücher, die ich von meinem Trinkgeld gekauft hatte. In diesem engen Bretterverschlag fühlte ich mich wohl.
Ende Oktober reiste ein junger Sudanese an. Der Empfangssekretär sah ihm unverhohlen interessiert in seine dunklen Augen. Der zierliche Sudanese schenkte ihm einen großen Bildband. Diesen Bildband schenkte der Empfangssekretär mir, dafür musste ich dem attraktiven Sudanesen am späten Abend einen Brief aufs Zimmer bringen. Mitten in der Nacht bat mich, der Empfangssekretär ihn zu vertreten, und verschwand im Zimmer des Sudanesen. Gegen Morgen kam er die Treppe heruntergeschlichen. Glücklich umarmte er mich. „Ich bin so verliebt“, schwärmte er. „Aber das bleibt unter uns.“ Sein Vertrauen ehrte mich und ich schwieg. Einer der Gäste, ein junger Schwede, hatte mich in der Spätschicht angesprochen. Dass er Nichtraucher war, gefiel mir und wir kamen ins Gespräch. Ich erzählte ihm von meinen Plänen und Absichten, er erzählte mir von seinem Studium in Ost-Berlin. Irgendwie kamen wir auf Godard zu sprechen. Meine Schwärmerei für Godard irritierte ihn. Er hatte Godards ersten Film „Außer Atem“ gesehen und schien nicht begeistert. „In der DDR gibt es doch so gute Regisseure und ihr macht tolle Filme“, bekundetet er lautstark seine Begeisterung. Ungläubig sah ich ihn an, seine blonden Haare hingen ihm ungekämmt über seine blauen Augen und beim Sprechen stieß er mit der Zungenspitze leicht gegen seine Schneidezähne. Wollte er mich für dumm verkaufen? fragte ich mich, doch gerade als ich gehen wollte, beugte er seinen Kopf zu mir und flüsterte: „Es stimmt, was ich sage, aber euer System muss sich öffnen, es ist alles zu dogmatisch. Er blickte mir in die Augen. „So schöne Mädchen haben die Deutschen“, sagte er, „aber die deutschen Mädchen müssen sich öffnen“. Er nestelte im dunklen Flur an meinem Blusenknopf. „Will mich nicht öffnen“, bekundete ich und klopfte auf seine Finger. „Musst du noch lernen“, erwiderte er mit einer Verbeugung und ging pfeifend davon.
Am nächsten Tag fuhr er nach West-Berlin und brachte mir ein Buch mit. Er drückte es mir in die Hand, als ich mit ein paar Glühbirnen auf dem Weg zum Hauselektriker war. Der Umschlag des Buches leuchtete in einem warmen Gelb, in roten Lettern stand auf dem Umschlag „Stimmen und Visionen“. Wessen Stimmen, wessen Visionen? fragte ich meinen Schweden, konnte aber seine Antwort nicht abwarten, da die Kaderleiterin aus ihrem Zimmer kam. Der junge Schwede grüßte sie freundlich. Sie blieb stehen und lächelte. Er umgarnte sie und tat, als schwärme er für reife Frauen. Ich versteckte das Buch hinter meinem Rücken und ging. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl in die 5. Etage, dort wo die Putzfrauen ihr Lager hatten, setzte mich auf einen Stapel Wäsche und schnupperte an dem Taschenbuch aus dem fernen Westteil der Stadt. Es roch ganz anders als unsere Bücher aus dem Hause „Volk und Welt“. Ich blätterte, las Namen wie Carlos Castaneda, Herbert Marcuse und Norman O. Brown. Namen, die ich nie gehört hatte. Wen sollte ich fragen? Im Hotel gab es keinen, zu dem ich Vertrauen hatte. Ich stand auf und sah sehnsuchtsvoll aus dem Fenster. Vor mir lagen der Nordbahnhof und der Grenzstreifen. Ich fuhr nach unten und versteckte das Buch in meinem Büro zwischen den Akten, um es in einer ruhigen Minute zu lesen.
Am nächsten Abend, es war ein nasskalter Novembertag, musste ich den Nachtportier vertreten, der grippegeschwächt im Bett lag. Als die letzten Gäste angereist und die Aschenbecher geleert waren, begab ich mich in meine Kemenate. Nun war es endlich so weit. Ich nahm das Buch aus meinem Versteck und las. Für mich öffnete sich eine neue Welt, Namen, die ich nie gehört hatte, Denkweisen und Ansichten über das Leben drangen in mein Bewusstsein. Je weiter ich las, umso verwirrter wurde ich und eine mächtige Wut kroch mir den Hals hinauf. Zum ersten Mal fühlte ich, dass die Luft in diesem engen Raum knapp wurde. Ich rannte raus, um vor der Eingangshalle Luft zu schnappen. Wenige Meter weiter wusste ich die Mauer. Scheinwerfer kreisten über dem totenstillen Grenzstreifen. Es sah gespenstisch aus. Der junge Schwede tauchte plötzlich auf, er kam aus der „Kleinen Melodie“, einer Nachtbar in der Friedrichstraße. In der Hand hielt er eine Flasche Schnaps. Wir gingen gemeinsam in die Halle zurück. Der rotblonde Schwede gab dem Empfangssekretär die Flasche zum Öffnen. Dieser öffnete sie, sah mich an und zischte: „Meine Süße, Du weißt doch, dass es verboten ist, sich mit den Gästen zu treffen“. Mir verschlug es die Sprache. Nachdenklich ging ich zurück in mein „Büro“ und las weiter. Gegen Morgen legte ich meinen Kopf müde auf eine der Akten und träumte von einem offenen sozialistischen System und dem jungen Schweden. Zum Schichtwechsel weckte mich der Empfangs- sekretär, er hielt sich an meinem wackligen Stuhl fest, da er kaum stehen konnte. „Dieser Schwede …“, lallte er und fiel um. Am Abend kam er nicht zum Dienst, von der hübschen Empfangssekretärin hörte ich, dass er krank sei.
Ende November wurde ich zur Kaderleiterin bestellt. Sie sah im kalten Herbstlicht ganz anders aus als sonst. Tiefe Falten durchzogen ihr Gesicht, ihre blauen Augen blickten streng. Ihre Stimme klang schrill: „Sie haben gegen mehrere Gebote verstoßen, Geschenke aus dem westlichen Ausland angenommen und selbige nicht gemeldet. Sie zeigte mir einen Bildband und fragte mich: „Kennen Sie den?“ So fangen eigentlich immer Witze an, dachte ich und zuckte gespannt die Schultern. Dann wurde aus einem Brief zitiert, den man im Zimmer des Sudanesen gefunden hatte. „Haben Sie den geschrieben?“ Ich verneinte. Der Empfangssekretär hat Sie aber mit diesem rosaroten Brief in der Hand gesehen. Ich schluckte. Er tat mir leid, der kleine Sudanese, der in sein Land zurückmusste, aber gern beim Empfangssekretär geblieben wäre. „Das ist nicht meine Schrift“, sagte ich leise. „Das kann ja jeder sagen“, konterte sie. Triumphierend holte die Kaderleiterin ein Buch mit einem gelben Umschlag aus ihrer Schublade. „Und was ist das?“, fragte sie. „Ein Buch“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Ein Buch über freie Liebe“, sagte sie, „das lässt ja tief blicken. Liest man das in Schweden?“ Langsam wurde ich unruhig und fragte mich, Was will die Alte von mir? In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Jetzt verstand ich, warum mein Buch verschwunden war. Trotzdem wollte ich mir keine Blöße geben und antwortete freundlich: „Kann sein, die Schweden sind ja ziemlich offen für alles. Einige Schweden studieren sogar in der DDR.“ „Ach, Sie kennen sich ja aus.“ Dann sah sie mich an und schwieg. Ich grübelte. Hatte der Empfangssekretär das Buch mitgenommen? Und wenn ja, was war denn los mit ihm? Warum log er? „Ihr Herbert Marcuse ist ein Schwein“, begann sie voller Empörung das Gespräch von neuem. „Wenn alle Menschen ihren Trieben freien Lauf ließen, wo kämen wir da hin?“ Ich sah zu ihrem ringlosen Finger, musterte ihre strenge Duttfrisur und den Seidenschal um ihren dünnen Hals. Sie starrte auf meinen Maximantel. „Und das soll schön sein und das gefällt wohl ihrem Marcuse?“ „Nun gehen Sie aber zu weit, sagte ich. Marcuse ist ein marxistischer Philosoph. Der interessiert sich nicht für Mäntel.“ „Und Sie wollen Regie studieren in unserem Staat?“, begann sie ihr Fragespiel von neuem. Sie übersah mein wiederholtes Nicken und blickte zu dem Bild des Genossen Walter Ulbricht. „Ein Regisseur muss parteilich sein, fuhr sie fort, muss zu unserem Staat, zum Arbeiter- und Bauernstaat stehen, und nicht von Schweden träumen.“ Nun sah ich zu dem Bild des Genossen Vorsitzenden. Mir schien, als würde er abschätzig zu mir herabblicken. „Marcuse wendet sich gegen die leistungsorientierte Kultur, und er weigert sich, seine ehemalige Schülerin Angela Davis im Stich zu lassen.“ „Ja und? Was heißt das schon.“ Sie sah mich durchdringend an. In ihren blauen Augen erschienen Eissplitter. Doch ich wollte dem Frühling, dem Sommer und jedem Menschen gegenüber aufgeschlossen sein und die Welt lieben, so wie es Marcuse proklamierte. „Sie kennen doch Angela Davis?“ fragte ich freundlich, denn jeder Mann und jede Frau in der DDR, einfach Jeder, vom Krippenkind bis zum Veteran der Kommunistischen Partei, kannte unsere Angela. „Von wem haben Sie dieses Buch?“ „Warum fragen Sie, Sie wissen doch schon alles“, sagte ich. Daraufhin schlug sie mir vor zu kündigen. Sie legte mir ein vorgefertigtes Schreiben vor die Nase, dass ich augenblicklich unterschrieb. Zum Abschied hielt sie mein Buch triumphierend in ihren knochigen Fingern umklammert. Ich ärgerte mich fürchterlich, dass sie mein Buch behalten hatte und stieg schimpfend die Treppen hinunter. Unten in der Empfangshalle lächelte mich der neue Hotelgehilfe an. „Allet Jute“, sagte er freundlich und schleppte die schweren Koffer am Empfangssekretär vorbei. Der kramte, als er mich sah, in seinen Akten. Die alte Garderobiere reichte mir zum Abschied die Hand. „Wir wissen, wer dich angeschissen hat.“ Sie wies mit ihrem Kopf zum Empfangssekretär. „Aber der hat`s auch nicht einfach mit seiner kranken Frau und den drei Kindern“, enthüllte sie sein Geheimnis. „Nun verstehe ich gar nichts mehr“, sagte ich, umarmte sie und ging lächelnd, obwohl mir zum Heulen zumute war, am bemitleidenswürdigen Empfangssekretär vorbei.
Als Hans von der Dienstreise zurückkam, erfuhr er im Hotel, dass ich dort nicht mehr arbeitete. Er besuchte mich bei Frau Seipel, die ihn argwöhnisch beäugte und ungern in mein Zimmer ließ. Er wollte mich aufheitern, zog den Ärmel seines rechten Armes hoch und ließ seine Armmuskeln anschwellen. „Das sind Muskeln“, protzte er, „die können Lasten schleppen. Fass mal an, die sind stahlhart“, forderte er mich auf. Ich mochte nicht aufgeheitert werden, dachte nur an meine Aufenthaltsgenehmigung. Als ob er meine Gedanken erraten hätte, sagte Hans: „Ich melde dich bei meinen Eltern als Untermieterin an. Das ist Kreis Oranienburg und gehört nicht mehr zu Berlin, da haste deine Ruhe und kannst arbeiten, wo du willst. Mein Retter - dachte ich. Aber so einfach ging es nicht, ich hätte das Zimmer bei Frau Seipel räumen müssen und das wollte ich nicht. Hans half mir bei meiner Suche nach einer neuen Arbeit. Wir fuhren durch Berlin, lasen Angebote, die an den Fenstern und Toren aushingen: Wir suchen Gabelstaplerfahrer, Ingenieure, Maurer, Sekretärinnen, Sachbearbeiterinnen, Bibliothekare. Aber keiner der Betriebe konnte mir eine Aufenthaltsgenehmigung für Berlin ausstellen, dafür waren sie für die Gesellschaft nicht wichtig genug. Weihnachten nahte. Frau Seipel reparierte ich die alten Plüschsessel, bezog sie neu, putzte die Wohnung und half ihr, wo ich nur konnte. Sie gab mir Geld dafür und schwärmte von ihrem neuen Bekannten, den sie auf dem Gemüsemarkt kennen gelernt hatte: „Da steht da son kleenet Männeken und kiekt mir an, wie ich so die Kohlköpfe ankieke.“ Wenn sie von ihm erzählte, leuchteten ihre sonst trüben Augen. Sie steckte ihren Dutt mit neuen Haarklammern fest, die er ihr geschenkt hatte und schimpfte auf ihre Krücke: Wenn ich die nur wegschmeißen könnte.
Am 6. Dezember zum Nikolausfest kam ihr neuer Bekannter zum ersten Mal zu ihr. Frau Seipel wollte ihn ohne Krücken an der Haustür begrüßen. Wir übten den ganzen Tag. Als er an der Haustür klingelte, schrie sie: ich bin müde, legte sich auf ihr neubezogenes Kanapee und schlief sofort ein. Ich musste ihn einlassen. Er stellte sich vor: ich bin Opa Grobius. Er putzte seine beschlagenen Brillengläser, nahm seine Ohrenschützer von seinen großen Ohren und strahlte mich aus klitzekleinen blauen Augen an. Frau Seipel schläft, flüsterte ich ihm zu und wies ihm den Weg zum Wohnzimmer. Während er auf Socken in Frau Seipels Zimmer schlich, ging ich mit den Blumen, die er mitgebracht hatte, in die schmale Küche. Ich stellte sie in eine große alte Blumenvase, kochte Kaffee, schnitt den Kuchen an und brachte ihn in Frau Seipels Wohnzimmer. Als ich das Zimmer betrat, kniete Opa Grobius neben ihr und bewachte ihren Schlaf. Als Frau Seipel den Kaffeeduft in ihre Nase bekam, wurde sie prompt wach und ließ sich von Grobius aufhelfen. Grobius stocherte in dem selbstgebackenen Kuchen und schmachtete Frau Seipel an. Ich kam mir überflüssig vor und verabschiedete mich. Kaum hatte ich die Tür geschlossen, fingen sie zu sprechen an, später hörte ich sie lachen. Was könnte ich heute noch machen, überlegte ich. Hans hat keine Zeit, er fährt die Gäste des Direktors durch Berlin. Ich studierte den Theaterplan und entschied mich für das Deutsche Theater. Benno Bessons Inszenierung des Politmärchens vom Drachen wurde am Abend gegeben. Mich begeisterten die Klassiker, nun war ich gespannt auf die Inszenierung des Stückes von Jewgeni Schwarz. Lange musste ich an der Kasse anstehen, bis ich eine Karte in meiner Hand hielt. Hervorragende Schauspieler wie Rolf Ludwig, Esche, Franke und Horst Drinda trieben mir Tränen der Freude in die Augen und ließen mich meine Situation völlig vergessen. Horst Sagerts schwelgerische Ausstattung faszinierte mich ungemein, bislang hatte mich die Bühnenausstattung wenig interessiert und nun so etwas.
Nach der Vorstellung stellte ich mich wieder an, dieses Mal, um in die Kantine des Deutschen Theaters zu kommen. Ich musste nicht lange warten, als Einzelperson kam ich schnell hinein. Als ich Horst Sagert in der Theaterkantine des DT sitzen und essen sah, wäre ich am liebsten zu ihm hingegangen und hätte ihn umarmt, aber er saß mit der wunderschönen Schauspielerin Gudrun Ritter zusammen. Ehrfürchtig setzte ich mich in eine Ecke und trank Unmengen von Fassbrause, bis mir der Bauch schmerzte.
Eines Nachmittags, kurz vor Weihnachten, kam Klaus zu mir. Aus seiner alten Ledertasche zauberte er Schokolade, Weintrauben und frisches Brot. Frau Seipel begrüßte uns kurz, sie hatte Besuch von ihrem Busenfreund Grobius. Wir gingen in die aufgeräumte Küche. Seitdem es Grobius in Frau Seipels Leben gab, strahlte nicht nur sie, sondern die ganze Wohnung. Wir schnitten zwei Scheiben Brot von dem frischen Bauernbrot ab, legten dick Schokolade darauf und dazu, als Krönung des Ganzen, Weintrauben. Unser Menü trugen wir stolz in mein Zimmer. Wir aßen genüsslich und lümmelten auf meinem Bett. Die alte Vertrautheit hatte sich wiedereingestellt. Klaus erzählte mir von seiner neuen Freundin, sie studierte Produktion beim Fernsehfunk. „Gut, dass es sie gibt, das Studium draußen in Babelsberg gefällt mir nicht“, sagte er und leckte sich den Zeigefinger ab. „Meine Freundin lenkt mich ab.“ Ich betrachtete seine weichen Gesichtszüge, das breite Kinn und das Grübchen mitten darauf. Klaus schimpfte über die Mitstudenten und die Dozenten. Aus allem hörte ich aber einen gewissen Stolz heraus, dass er es geschafft hatte. Er war Student im 2. Studienjahr.“ Klaus strich über seine neue Hose. „Ich habe etwas für dich.“ Er kramte aus seiner Ledertasche ein Geschenk, das er in hellgrünem, mit Nüssen geschmücktem Weihnachtspapier eingewickelt hatte. Das ist ein Geschenk, damit du immer an mich denkst“, sagte er leicht theatralisch. Meine Finger rissen ungeduldig an der roten Schleife. Ich ahnte, dass es ein Buch war. Erfreut las ich den Titel. Ulrich Plenzdorf - „Die neuen Leiden des jungen W.“ „Da staunste, was?“, sagte er, „hab ich unterm Ladentisch bekommen.“ Er strich zufrieden über seinen Walrossbart. „Na, du weißt doch …“, fuhr er fort, „alles reine Beziehungssache, kenne die Buchhändlerin.“ „Du Glücklicher“, konstatierte ich. Klaus grinste. „Das Buch soll eine echte Provokation für den DDR-Kleinbürger sein. Sollte erst nicht erscheinen, weil sich dieser Edgar das Leben nimmt, in der alten Fassung war es jedenfalls so.“ „Verrat doch nicht alles“, sagte ich. Dann umarmte ich ihn. Bei aller Freude - meine Gedanken weilten bei Peter. „Warum grüßt er mich nie?“ Klaus zuckte ratlos die Schultern. „Weiß er, dass du heute bei mir bist?“, fragte ich weiter. „Nee, woher denn? Wir schreiben uns nicht, wir telefonieren nicht, wird doch alles überwacht. Die Fresspakete schickt er an die Adresse meiner Freundin. Das Mädchen kommt aus Griechenland, alles klar?“ Langsam wurde ich wütend. Klaus merkte es und bot mir als Trost noch ein Stück Schokolade an. Ich schob es in den Mund und wollte es genießen, doch die Schokolade klebte auf meiner Zunge und schmeckte mir nicht mehr. In der Nacht las ich die „Neuen Leiden des jungen W“. Vorm Fenster rieselte der erste Schnee, bedeckte die Linde vorm Haus, die alten Laternen beleuchteten die kleine Straße, hüllten sie in ein warmes Licht und ließen die Schneeflocken wie weiße Segler erscheinen. Frau Seipel klopfte Mitternacht mit ihrer Krücke gegen meine Tür: „Schlafenszeit!“ „Nein, noch nicht, ist so spannend, muss weiterlesen.“ Sie lachte. Mein Held hieß von diesem Moment an Edgar Wibeau, ein 17jähriger Junge aus der Provinz, der aus seiner kleinbürgerlichen Umwelt ausbricht und, genau wie ich, in Berlin landet. Beim Lesen von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ entdeckt er immer wieder Ähnlichkeiten mit seinem Leben. Edgar haust in einer verlassenen Laube neben einem Kindergarten. Er verliebt sich in Charlie, eine Kindergärtnerin, die aber genau wie Werthers Angebetete schon vergeben ist. Edgars Sprache reizte mich zum Lachen, sie war in unserem Jargon, im Jargon der DDR-Jugend, gehalten, er sprach z. B. von Werther als „Old Werther“. Nachdem der junge Rebell Edgar von der Kunsthochschule abgelehnt wird, sich selber als verkanntes Genie sieht, fängt er als Anstreicher an. Um seinen Arbeitskollegen etwas zu beweisen, entwickelt er ein nebelloses Farbspritzgerät. Beim ersten Versuch, die Maschine in Betrieb zu nehmen, wird Edgar von einem Stromschlag getötet. Die ganze Nacht litt ich mit Edgar, verstand sein Auflehnen gegen gesellschaftliche und familiäre Zwänge. „Der Edgar in meinem Roman ist umgekommen, weil er an der Kunstschule nicht angekommen ist“, gestand ich morgens der Vermieterin. „Um Jottes willen“, sagte meine alte, müde Frau Seipel, „denn bewirbst du dich da nicht“.
Am Donnerstag vor dem Weihnachtsfest bummelte Hans seine Überstunden ab. Wir schlenderten die Karl-Marx-Allee entlang. „Hier hat sich Stalin verewigt“, meckerte Hans und betrachtete die Hochhäuser, die rechts und links strammstanden wie die Soldaten. „Hier wohnen nur Bonzen“, sagte Hans missmutig, „unsereins wohnt in einem engen miefigen Gästezimmer und wird mittags rausgeschmissen“. „Nach dem Krieg war hier alles zerstört, was müssen die Trümmerfrauen hier für Steine geschleppt haben“, versuchte ich, die Stimmung zu retten, und dachte an einen Dokumentarfilm, den ich vor kurzem gesehen hatte. „Die hieß früher Stalinallee, weißt du das?“, fragte mich Hans. „Klaro“, sagte ich, „wir haben das in der 2. Klasse in der Fibel gelesen“. Hans sah mich von der Seite ungnädig an. Mir fiel der kurze Text, den wir als Kinder in unserer Dorfschule gelesen hatten, wieder ein. Er hieß: „Die schönste Straße Berlins“. In Berlin war ich damals noch nie gewesen, ich kannte nur mein Dorf, es hieß Altenberg. Ich kannte die Bewohner des Unterdorfs und die Bewohner des Oberdorfs, sie waren miteinander zerstritten. Ich kannte jeden Stein auf der Dorfstraße, die Kirche, den Wald mit den hohen Buchen, die Felder, die Ziegelei. Aber dieses Mädchen wohnte in der schönsten Straße Berlins, sie hieß Vera und auch sie ging, wie ich damals, in die zweite Klasse. Ich erinnerte mich wieder an die ruhige, sanfte Stimme der Lehrerin, als sie uns den Text vorlas. “Wenn Vera am Morgen erwachte, glaubt sie zu träumen. Aber Vera träumt nicht. Wirklich, sie wohnt in der schönsten Straße Berlins.“ Hier sah uns die Lehrerin aus ihren braunen Augen vielsagend an. Dann las sie weiter. „Auf dem Weg zur Schule bewundert Vera jeden Tag aufs Neue die herrliche Stalinallee. Die hohen, prächtigen Häuser sind mit gelben Kacheln verkleidet. Unten ziehen sich in langer Reihe die breiten Schaufenster der neuen Läden hin. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt." Als unsere Lehrerin diesen Satz vorlas, wurde ich wütend. In unserem Dorfkonsum gab es nicht einmal Schulhefte. Wir Kinder mussten bis ins nächste Dorf laufen, um Bleistifte, Radiergummi oder frisches Brot zu kaufen. Ich lief weiter in Gedanken versunken, bis mich Hans antippte. „Aber dass mein Vater hier am 17. Juni 1953 beinahe verhaftet wurde, als er mit den anderen Bauarbeitern gestreikt hat, das weißte nicht.“ Die Geschichte des 17. Juni wurde in der DDR verschwiegen. „Mutter hat ihm eins mit dem Löffel auf den Kopf gegeben, als sie davon erfuhr. Du alter Esel, hat sie geschimpft, setzt unsere ganze Zukunft aufs Spiel. Auf den Staat schimpfen ja, aber in Knast gehen, nee“. Hans` Augen verdüsterten sich. „Manchmal hatte mein Alter ne Meise“, sagte er und bog in Richtung Mokka-Milch Eis-Bar ab. „Ich finde das eher mutig“, sagte ich und sah ihn an. Doch Hans schwieg. „Überall musste anstehen“, schimpfte er, als er die wartende Schlange vor der beliebten Eis-Bar sah. Der Wind hatte die dichte Wolkendecke aufgerissen. „Wie schön das aussieht“, stellte ich fest, als wir am Kino International ankamen. „Das ist mein absolutes Lieblingskino“, verkündete ich in einem Ton, als wäre ich die stolze Besitzerin. „Wieso?“ Hans schaute mich erstaunt an, „verstehe ich nicht“. „Wenn ich die Treppen nach oben gehe, überkommt mich eine Hochstimmung und ich könnte singen und tanzen“. „Im Kino? Auf dem glatten Parkett?“ Hans begann an meinem Verstand zu zweifeln. „Ja das Parkett ist es, es riecht so gut. Und wenn ich dann im Foyer bin, dann gucke ich aus dem riesigen Fenster auf die Allee, sehe die Autos vorüberfahren und beobachte die Menschen, die ins Café Moskau gehen“. „Das machst du, wenn du ins Kino gehst?“ Hans sah mich amüsiert von der Seite an. „Und wenn du nach rechts blickst und Glück hast, kannst du die Spitze vom Fernsehturm sehen“, ergänzte ich voller Begeisterung. „Ich sehe mir im Kino Filme an“, sagte Hans. „Und weiter nichts. Was wird denn heute gespielt?“ Er sah in die Schaukästen. „Ach, ein DEFA Film“. Hans verachtete alles, was aus dem Osten kam. Ich dachte an die Worte des Schweden: Ihr habt gute Regisseure und gute Filme. Das konnte ich Hans nicht sagen. Er trommelte an die Glasvitrine und fragte laut und provozierend: „Oder willst du dir den Schrott ansehen?“ Ich antwortete: „Sie spielen heute Nachmittag den Märchenfilm „Dornröschen“, mit Vera Oelschlegel als 13. Fee. Plötzlich schien Hans wie verändert. „Die Vera ist doch die Braut von unserem obersten Boss“, sagte er. Den Film muss ich sehen. Aber erst gehen wir essen“. Wir versuchten die breite Karl-Marx-Allee zu überwinden, hatten Mühe über den Damm zu kommen. Eine Trabi-Lawine überrollte uns fast. Hans griff mich bei der Hand und lavierte mich durch die fahrenden Autos. „Ist hier irgendwo ein Nest?“, spottete er. Endlich standen wir vorm Café „Moskau“, einem neuen zweigeschossigen Gebäude an der Ecke Schillingstraße. Ich hatte von Klaus gehört, dass 160 Angestellte in diesem Haus arbeiten würden. Allein an der Tür standen schon fünf Personen, die einem den Zutritt verwehrten. Hans zog nach kurzer Zeit ein mürrisches Gesicht. Er trat ungeduldig von einem Bein auf das andere und überlegte, dann wandte er sich an den ersten Türsteher. „Kann ich mal den Restaurantleiter, Herrn Mischelwitz, sprechen?“ Der Angesprochene grinste: „Sag doch gleich, dass du bestellt hast. Er begleitete uns bis zur Garderobe. Hans drückte ihm Geld in die Hand. „Immer wieder gerne“, raunte der freundliche Mann. An der Garderobe standen die nächsten acht Angestellten und nahmen unsere Mäntel entgegen. Wieder gab ihnen Hans Trinkgeld. Ich sah mich indessen im Foyer um. Ah, da ist die Marmortreppe, die führt nach unten zur Natascha Bar, dachte ich. Klaus hatte mir die Einrichtung des Gebäudes genau beschrieben. Wir standen im Foyer im Erdgeschoss. Hier mussten die Galerie und der Russische Salon sein, und draußen im Wintergarten befand sich die Stein Bar. Auf dem Dach soll ein originalgetreues Abbild vom Sputnik sein. Das hat die Botschaft der UdSSR, unser Brudervolk, uns zur Einweihung geschenkt. Der Gastronomische Leiter, gefolgt von einer Begleiterin, erblickte Hans, als der sich vor einem großen Spiegel sein Haar kämmte. Er eilte auf Hans zu und gab ihm die linke Hand, was mich wunderte. Er winkte uns ins Restaurant und platzierte uns ans Fenster. „Da staunste wat, Hans, dass du deinen alten Lehrmeister hier findest.“ Während die beiden miteinander sprachen, entdeckte ich, dass der Gastronomische Leiter nur einen Arm hatte. Die junge Frau, die die ganze Zeit neben ihm gestanden hatte, holte auf einen kurzen Wink ihres Vorgesetzten einen Kellner herbei, der uns dienstbeflissen die Speisekarte vorlegte. „Wo wart ihr denn bei dem Wetter?“, fragte der Leiter. „Wir waren auf der Weberwiese“, entgegnete Hans. „Hab meiner Freundin das neue Berlin gezeigt“. „Mischelwitz“ stellte sich der alte Mann vor. „Hocherfreut“. „Weberwiese, ach, da hab ich als Kind gewohnt. Dort standen noch olle Mietskasernen, mein lieber Hans, und es roch den ganzen Tag nach Kohlsuppe. Wisst ihr denn, wie die Weberwiese früher hieß?“ Er hob seine Hand und schaute uns fragend an. Ich verneinte und bewegte unter dem Tisch vorsichtig meine Zehen, denn ich fror immer noch, obwohl es im Restaurant gemütlich warm war. „Ja“, sagte Hans. „Lausewiese“ - hast du mir oft erzählt“. „Haste jut aufgepasst“, lobte sein ehemaliger Lehrmeister. Hans lächelte erfreut. Herr Mischelwitz ging und begrüßte an einem anderen Tisch eine Gruppe Inder. Lange studierte ich die Speisekarte. Einige der angebotenen Gerichte kannte ich nicht. „Kannst du mir etwas empfehlen?“, fragte ich Hans. Er beriet mich fachmännisch, und ich staunte, wie gut er sich auskannte. Doch ich blieb beim Steak au four, denn das kannte ich. Nachdem Hans bestellt hatte, fragte ich: Wo war der Mischelwitz dein Lehrmeister? „Wollte mal Koch werden, bin krank geworden. Dann war Schluss“. Mir knurrte der Magen. Der Kellner kam und brachte die Getränke. Nach einer halben Stunde bekam Hans sein Riesenschnitzel. Ich wartete ungeduldig. Nach einer Stunde fragte ich beim Kellner nach. „Kommt gleich“, flötete der Kellner und lief zur Küche. Wieder vergingen Minuten. Mein Steak wurde endlich von einem Lehrling gebracht. Hungrig steckte ich den ersten Bissen in meinen Mund. Ich erstarrte, denn es war kalt. Auch Kartoffeln und das Erbsengemüse. Ich schüttelte mich. „Wat is?“ fragte Hans erstaunt. „Das Essen ist kalt“. Hans rief den Kellner. Nach wenigen Minuten kam er wieder und reichte mir freundlich meinen Teller. Ich griff nach dem Teller und verbrannte mir die Hand. Langsam wurde ich wütend. Der Kellner hatte sich durch eine Stoffserviette geschützt. Wieder begann ich zu essen, wieder erstarrte ich. Das Essen war immer noch kalt. „Das hat die Küche nur auf den heißen Herd gestellt“, bemerkte Hans. „Das esse ich nicht“, sagte ich ungehalten. „Mach doch hier nicht solch einen Aufstand, was soll der Mischelwitz von mir denken“, schimpfte Hans genervt. Ich winkte dem Kellner. Mit einem mürrischen Gesicht kam er. In diesem Moment steuerte Herr Mischelwitz auf uns zu. Der Kellner griff nach dem Teller, verbrannte sich, fluchte leise, eilte mit meinem Teller Richtung Küche und kam binnen weniger Minuten mit einem saftigen Steak zurück. „Na, schmeckt`s?“, fragte freundlich Herr Mischelwitz. Als dieser die leichte Verstimmung zwischen mir und Hans bemerkte, brachte er echten russischen Wodka. Der Abend wurde noch sehr lustig und irgendwann nachts landeten wir in der Natascha Bar.