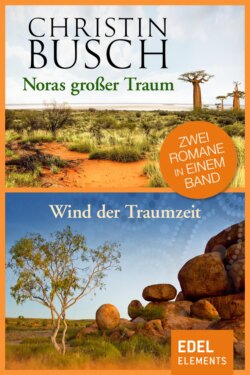Читать книгу Noras großer Traum / Wind der Traumzeit - Christin Busch - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеGreg Wilson hatte sich so viel Zeit genommen, wie er nur irgend erübrigen konnte, um den beiden deutschen Journalisten die Funkzentrale zu erklären. Er nahm seine Arbeit hier sehr ernst, und wie alle Australier war er stolz auf den Royal Flying Doctor Service. Er sah seine Erläuterungen bezüglich der Funkzentrale als seinen ureigenen Beitrag in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Gespannt nahmen Nora und Martin nun auch an der Funksprechstunde teil, in der sich die Farmer melden konnten, wenn es in der Familie oder bei den Arbeitern ein medizinisches Problem gab. Für die heutige Sprechstunde war Dr. Jason Lewis aus der Klinik in die Funkzentrale gekommen. Interessiert hörten sie zu, wie der Royal Flying Doctor Service die offensichtlich harmloseren Fälle über Funk verarztete beziehungsweise sich Symptome beschreiben ließ und daraufhin Behandlungsmöglichkeiten erläuterte. Echte Notfälle gab es in diesen Funksprechstunden selten; meist handelte es sich um leichtere Krankheitsbilder. Die Farmer wurden dann auch immer nach einem Blick auf die geplanten Kliniktouren der nächsten Zeit aufgefordert, sich bei der nächsten Tour in ihrer Nähe dem diensthabenden Arzt vorzustellen.
Als Jason gerade dabei war, seine Funksprechstunde zu beenden, betrat Tom mit seinem Arztkoffer in der Hand die Zentrale. Alle Ärzte des Teams hielten sich hier an eine der wichtigsten Regeln, die besagte, dass der Funker immer wissen musste, wo die Mediziner gerade zu erreichen waren. Er stellte seinen Koffer zwischen die Füße, nickte Nora und Martin freundlich zu und wartete darauf, dass Jason und Greg die Sprechstunde beendeten. Dann wandte er sich an den Funker.
»Greg, ich wollte mich nur abmelden. Ich mache mich auf den Weg zur Sanderson-Farm. Ich muss mir die Füße von Mrs. Sanderson noch einmal anschauen und die Verbände wechseln.« Er sah zu Nora und Martin und fügte erklärend hinzu: »Die alte Dame lebt ganz allein da draußen und hat sich vor kurzem einen Teekessel mit heißem Wasser auf die Füße fallen lassen. Ich mache mir Sorgen um sie, denn sie hat sich energisch geweigert, ins Krankenhaus zu gehen.«
Greg nickte ihm zu. »In Ordnung, Tom. Dann weiß ich, wo Sie zu finden sind.«
Tom beugte sich vor, um seinen Koffer wieder aufzunehmen, dann sah er plötzlich von Nora zu Martin.
»Wie schaut es denn aus? Haben Sie hier schon alles Wichtige erfahren?«
Bevor die beiden antworten konnten, grinste Greg und sagte: »O ja! Unsere Gäste haben bereits meine ausführliche Luxusführung durch unsere Funkzentrale über sich ergehen lassen müssen.«
Die beiden schüttelten protestierend den Kopf, und Martin versicherte, wie interessant das alles für sie gewesen war.
Tom überlegte kurz, bevor er fortfuhr: »Also wenn Sie hier keine Fragen mehr haben, könnten Sie mich begleiten, wenn Sie Lust dazu haben.«
Nora und Martin wechselten nur einen Blick und waren sich sofort einig.
Nachdem sie sich bei Greg bedankt und von ihm und Jason verabschiedet hatten, stiegen sie in Toms Wagen, um ihm bei seinem Hausbesuch über die Schulter zu sehen. Obwohl die Fahrt etwa zwei Stunden dauerte, erschien sie Nora nicht eine Minute langweilig. Nach und nach ließen sie die letzten Ausläufer des Ortes hinter sich und fuhren etliche Kilometer an Weidezäunen entlang. Die zunächst asphaltierte Straße war in eine der im Outback üblichen unbefestigten Fahrbahnen übergegangen. Und da es länger nicht geregnet hatte, zogen sie eine rote Staubwolke hinter sich her.
Tom, der anscheinend alles über die Gegend wusste, deutete hierhin und dorthin und erklärte ihnen die landschaftstypischen Gegebenheiten, wie sich zum Beispiel bestimmte Landstriche bei starken Regenfällen veränderten, dass einige Abschnitte der Straße nicht mehr passierbar waren, wenn der Fluss über die Ufer trat, oder er wies sie im Vorbeifahren auf die Piste hin, die das Postflugzeug zwei- bis dreimal in der Woche benutzte. Auch machte er sie auf ein bestimmtes Straßenschild aufmerksam, das ein Flugzeug und die Buchstaben RFDS zeigte. Dieses Schild wies die zum Teil schnurgerade Straße, die sie befuhren, in Notfällen als Start- und Landebahn des Flying Doctor Service aus.
Nora musste wieder einmal schmunzeln, als sie daran dachte, wie man in Deutschland im dichten Verkehr mit seinem Auto rechts an die Seite fuhr, um ein Fahrzeug der Feuerwehr oder Polizei vorbeizulassen, das sich mit der Sirene angekündigt hatte. Wie anders war die Welt hier; man fuhr beiseite, um ein Flugzeug auf der Fahrbahn landen zu lassen. Interessiert sahen sie und Martin in die Richtung, in die Tom nun deutete, um ihnen ein paar wilde Kamele am Straßenrand zu zeigen.
Nach einer Weile fragte Nora Tom: »Können Sie uns noch etwas über Mrs. Sanderson erzählen? Wie kommt es, dass sie dort ganz allein lebt?«
Um Toms Mundwinkel zuckte ein Lächeln. »Nun, sie ist ein wenig eigensinnig. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich schlichtweg geweigert, in den Ort zu ziehen.«
Bevor er weitersprechen konnte, hatte Nora eingeworfen: »Hat sie denn keine Kinder, die sich um sie kümmern können?«
Tom seufzte. »Doch, sie hat zwei Söhne. Einer lebt in Brisbane, der andere ist in Sydney verheiratet. Beide haben aber mit dem Farmleben nichts am Hut. Sie hat es tatsächlich eine Weile mit ein paar Hilfskräften und einem besonders guten Nachbarn versucht, der ihr auch hier und da unter die Arme gegriffen hat, aber sie musste dann doch einsehen, dass es nicht zu schaffen war. Also hat sie fast das ganze Vieh verkauft, die Weideflächen an Nachbarn verpachtet und lebt jetzt trotzig allein auf der Farm. Es war natürlich eine herbe Enttäuschung für sie – und auch noch für ihren Mann damals –, dass keiner der Söhne sich für die Farm interessierte, aber die Zeiten haben sich geändert. Die jungen Leute treffen heute eigene Entscheidungen, und so müssen sich nun viele Eltern und Großeltern damit abfinden, dass es die Jugend in die Städte zieht.« Tom deutete auf einen kleinen staubigen Seitenweg in einiger Entfernung. »So, da vorne müssen wir abbiegen, und dann sind wir bald da. Ich bin schon gespannt, wie sie Ihnen gefallen wird.«
Nora und Martin hatten ihre Entscheidung, Tom zu begleiten, nicht bereuen müssen. Die weißhaarige alte Dame mit ihren blitzenden Augen war ein Ausbund an Lebhaftigkeit und schwarzem Humor. Das, was man im Allgemeinen als ein Original bezeichnete. Außerdem bot der unerwartete Besuch durch die deutschen Journalisten ihr offensichtlich eine echte Abwechslung, und sie lief in ihrer Erzählkunst zur Höchstform auf. Martin hatte zunächst verblüfft ausgesehen, als sie ihm die Erlaubnis erteilt hatte, sich auf der Farm umschauen und Fotos machen zu dürfen, wenn er vorher ihre Hühner füttern würde. Auch Tom war einverstanden gewesen, sich bei der anstehenden Untersuchung und dem Verbandwechsel fotografieren zu lassen, während Nora sich Mrs. Sandersons Lebensgeschichte anhörte und sich wie immer Notizen machte.
Auch noch im Wagen auf der Heimfahrt nach Cameron Downs war sie mit den Gedanken bei den Erzählungen der alten Dame, als plötzlich das Funkgerät knackte und Tom den Lautstärkeknopf regelte, um einen Funkruf besser mithören zu können, den Greg Wilson aus der Zentrale gerade an die Maschine der Flying Doctors richtete.
»Sierra Lima Tango für Alpha Foxtrott Delta. Phil, kannst du mich hören?« Es knackte erneut im Funkgerät, und der Pilot meldete sich.
»Hier Alpha Foxtrott Delta für Sierra Lima Tango. Greg, wir hören dich laut und deutlich. Was gibt es? Wir sind schon auf dem Heimweg; voraussichtliche Landung in Cameron Downs in etwa eineinhalb Stunden.«
»Phil, das mit der Landung kannst du vergessen. Wir haben einen Notruf. Es gab einen Unfall auf der Mildoona Road, etwa zehn Meilen hinter Johnsons Windrad bei Cameron Creek.«
»Sprich weiter, Greg, Bill hört jetzt mit.«
»Nun, der Fahrer des Roadtrains, der zufällig vorbeikam und den Unfall gemeldet hat, sagte, es gebe eine verletzte Frau, die bereits einen Kopfverband habe, aber bewusstlos in der Nähe eines demolierten Jeeps am Straßenrand hege. Ansonsten sei niemand an der Unfallstelle.«
»Danke, Greg, wir fliegen hin und kümmern uns um sie. Wir brauchen aber mindestens noch eine Stunde bis dorthin. Alpha Foxtrott Delta. Ende.«
Gebannt hatten Nora und Martin auf das Funkgerät gestarrt und den Wortwechsel zwischen der Zentrale und dem Piloten verfolgt.
Ohne zu zögern griff Tom nun wieder zum Funkgerät.
»Mobile 2 ruft Sierra Lima Tango.«
Es knackte, und Greg meldete sich.
»Hier Sierra Lima Tango. Ich höre Sie, Tom. Gibt es Probleme mit Mrs. Sanderson?«
»Nein, nein, Greg. Wir sind dort seit etwa zwanzig Minuten fertig. Ich habe den Notruf mitbekommen. Wir können in einer halben Stunde dort sein. Geben Sie bitte Bill Bescheid? Danke. Mobile 2. Ende.«
»Alles klar, Tom, ich funke Phil an und gebe es weiter. Sierra Lima Tango. Ende.«
Nachdem Tom das Funkgerät eingehängt hatte, wandte er sich an Nora und Martin, die alles schweigend verfolgt hatten.
»Es tut mir Leid, wenn ich Sie erschreckt habe, aber so etwas gehört zu unserem Alltag. Manchmal verläuft er ruhig und beschaulich, dann wieder muss alles schnell gehen so wie jetzt. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass Sie nun zwangsläufig dabei sein müssen.«
Martin schüttelte den Kopf, während Nora ein nachdenkliches Gesicht machte. Sie schien Tom gar nicht zugehört zu haben, denn unvermittelt fragte sie: »Wieso ist diese Frau dort allein, hat aber einen Kopfverband? Hat wohl jemand den Unfall verursacht, dann ein schlechtes Gewissen gehabt, sie verbunden und ist dann einfach weggefahren? Also Fahrerflucht?«
Tom schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht. Ich bin schon einige Jahre hier im Einsatz. Meiner Meinung nach sind das Städter auf einem Trip durchs Outback. Ich vermute, sie hatten einen Unfall. Die Frau wurde verbunden, und der oder die anderen haben sich aufgemacht, um Hilfe zu holen.«
Martin beugte sich nach vorne, um besser an der Unterhaltung teilnehmen zu können. »Hilfe holen? Wie denn? Zu Fuß?«
Tom lächelte nun etwas bitter. »Wahrscheinlich ist das so. Leider sind diese Menschen meistens überhaupt nicht informiert. Sie sagen selten jemandem Bescheid, wohin sie aufbrechen und wann sie wo ankommen wollen. Sie kennen nicht die oberste Regel, falls es zu Unfällen oder Pannen im Outback kommt: Beim Wagen bleiben! Denn ein Auto wird viel schneller entdeckt als eine einzelne Person. Sie wollen das große Abenteuer, dabei unterschätzen sie die Entfernungen hier draußen maßlos und ebenso die Gefahren nach einem solchen Unfall zum Beispiel.«
Nora hatte interessiert zugehört. »Hoffentlich können Sie helfen, Tom.«
Er nickte, und schweigend fuhren sie weiter.
Als sie sich der Unfallstelle näherten, sahen sie zunächst nur den riesigen Roadtrain, der vor dem verunglückten Jeep am Straßenrand stand. Erst als Tom den winkenden Fahrer neben der Verletzten erblickte, hielt er an, nahm seinen Arztkoffer und sprang aus dem Wagen.
»Ich bin Tom Morrison vom Flying Doctor Service. Man hat mich über Funk informiert. Ist sie schon zu sich gekommen?«
»Nein, Doc. Ich bin jetzt eine knappe Stunde hier. Seitdem liegt sie so da.« Während er sich hinkniete und seinen Koffer öffnete, sah er der Verletzten aufmerksam ins Gesicht. Sie war Anfang dreißig und, wie er feststellte, nicht ansprechbar. Martin und Nora waren langsam herangekommen und boten ihre Hilfe an. Nora hatte sich die Frage gestellt, warum die Frau wohl neben dem Auto lag. Nun erkannte sie, dass die Hitze im Wagen unerträglich gewesen wäre. Irgendjemand hatte aus Ästen und einer Picknickdecke einen Sonnenschutz für sie konstruiert und sie darunter zurückgelassen. Tom nahm nun schnell und sicher die Untersuchung vor, überprüfte Puls und Blutdruck und legte eine Infusion an, deren Beutel er Nora halten ließ.
Der Fahrer schien offensichtlich erleichtert zu sein, dass etwas geschah.
»Wie sieht es denn aus, Doc? Kommt sie durch?«
Tom beobachtete das Gesicht der verletzten Frau.
»Ich hoffe es. Das hängt aber davon ab, wie schwerwiegend die Kopfverletzung ist und wie lange sie hier schon gelegen hat. Sicher ist schon mal, dass sie völlig ausgetrocknet ist. Deshalb auch die Infusion. Ich habe ihr außerdem etwas für den Kreislauf gegeben. Jetzt sehe ich mir den Kopf einmal genauer an.«
Er entfernte den Druckverband und stellte erleichtert fest, dass es sich nur um eine Platzwunde handelte. Während er die Wunde desinfizierte und ein Klammerpflaster anlegte, wurde die Frau unruhig und bewegte den Kopf hin und her. Als sie die Augen aufschlug und ihr Blick die umstehenden Leute erfasste, erschrak sie und wollte sich aufrichten. Tom drückte sie sanft zurück.
»Nein, nein, bleiben Sie schön liegen. Es muss einen Unfall gegeben haben. Sie haben eine ziemlich große Platzwunde am Kopf und sicher eine Gehirnerschütterung. Ich bin übrigens Tom Morrison und Arzt.« Er lächelte sie freundlich an.
»Können Sie mir sagen, wie Sie heißen?«
Die Frau sah sich irritiert um. Man merkte ihr an, dass sie sich auf den Versuch konzentrierte, ihre Lage hier zu verstehen. Ihre Hand tastete zur Stirn, dann fuhr sie sich über die Augen.
»Ich ... ich bin Gina Davis.« Sie schaute sich erneut um. »Wo ist mein Mann? Und die Kinder? Sind sie denn nicht hier?«
Tom nahm die aufkommende Unruhe in ihrer Stimme wahr und legte eine Hand auf ihren Arm.
»Bitte, Gina, bleiben Sie ruhig. Wenn Sie sich jetzt aufregen, schadet Ihnen das nur. Wir vermuten, dass Ihre Familie Hilfe holen wollte, denn Sie wurden hier allein gefunden – mit einem Kopfverband.«
Die Frau geriet nun vollends aus der Fassung und wollte aufstehen.
»Mein Gott, die Kinder! Ich muss sie suchen! Wer weiß, wo sie sind!«
Es gelang Tom kaum, sie zu beruhigen, und so angelte er mit einer Hand in seinem Koffer nach einer Spritze. Nora hatte besorgt zugesehen. Nun drückte sie Martin den Infusionsbeutel in die Hand und hockte sich neben die junge Frau. Sie konnte ihre Verzweiflung nachempfinden, schließlich hatte sie selbst einen Sohn und eine Tochter, die ihr genauso viel bedeuteten wie dieser Frau ihre verschwundenen Kinder.
Entschlossen griff sie nach ihrer Hand.
»Hallo, Gina. Ich bin Nora. Bitte bleiben Sie liegen. Ich verspreche Ihnen, dass wir Ihre Familie gleich suchen werden, okay?«
Gina schien Vertrauen zu fassen und nickte zögernd. Tom hatte inzwischen eine Beruhigungsspritze aufgezogen und desinfizierte die Stelle, an der sie gesetzt werden sollte.
Nora drückte Ginas Hand und sah ihr in die Augen.
»Gina, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie uns Ihren Mann und die Kinder beschreiben würden. Wollen Sie das tun?«
Die verletzte Frau schluckte und sah voller Sorge zu Nora und Tom auf.
»Mein Sohn ist vier. Er hat kurzes blondes Haar und blaue Augen. Er heißt Dennis.« Sie machte eine Pause und holte Luft.
»Meine Tochter ist sechs. Sie hat langes dunkelblondes Haar und braune Augen. Sie ist etwa einsfünfundzwanzig groß und hat ein gelbes T-Shirt an. Ihr Name ist Joanna.« Tränen traten ihr in die Augen, doch es gelang ihr, weiterzusprechen. »Mein Mann Jim ist fünfunddreißig Jahre alt und einsfünfundachtzig groß. Er hat dunkles lockiges Haar und trägt helle Jeans und ein weißes T-Shirt.« Sie wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augenwinkeln und sah hoffnungsvoll von einem zum anderen. »Werden Sie sie finden?«
Bevor sie eine Antwort erhielt, vernahmen alle das Motorengeräusch. Tom blickte zum Himmel. »Ah, sehen Sie, da kommt schon unser Flugzeug. Jetzt sind Sie bald in der Klinik.«
Entsetzen spiegelte sich auf Ginas Gesicht.
»Nein, nein! Ich gehe hier nicht weg! Nicht ohne meine Familie, ich lasse meine Kinder hier nicht allein zurück!« Sie machte erneut Anstalten aufzustehen.
Tom beugte sich über sie. »Gina, bitte! Seien Sie vernünftig. Sie können mit ihrer Verletzung gar nicht nach Ihnen suchen. Ich verspreche Ihnen, dass wir das übernehmen. Die örtliche Polizei ist auch benachrichtigt, und ich bin sicher, unser Sergeant wird hier gleich mit einer Suchmannschaft anrücken.«
Die Beruhigungsspritze schien die junge Frau nun endlich müde werden zu lassen. Sie griff noch einmal nach Noras Hand.
»Sie haben versprochen, nach ihnen zu suchen, nicht?«
Nora nickte. »Ja, das werden wir.«
Phil landete die Maschine auf der Straße. Noch ehe die Triebwerke verstummten, sprangen Bill und Lisa aus dem Flugzeug und eilten zu Tom, der ihnen kurz schilderte, was er bis zu ihrem Eintreffen vorgenommen hatte. Die Patientin machte inzwischen einen benommenen Eindruck und wurde auf der Trage, die Phil und Martin bereits geholt hatten, zum Flugzeug gebracht. Minuten später hob die Maschine, eine rote Staubwolke hinter sich aufwirbelnd, bereits wieder ab und nahm Kurs auf Cameron Downs. Nachdem der Fahrer des Roadtrains Tom einen Zettel mit seinen Personalien gegeben und sich entschuldigt hatte, bei der Suche leider nicht helfen zu können, zog auch er mit seinem riesigen Gefährt in einer weiteren Staubwolke davon.
Unschlüssig sah Martin von Nora zu Tom. »Und jetzt?«
Nora reckte entschlossen das Kinn.
»Ich suche jetzt nach diesen Kindern. Das habe ich schließlich versprochen.«
Tom hielt sie am Arm fest. »Moment mal, Sie marschieren nicht einfach los. Dann können wir Sie auch noch suchen. Wir dürfen uns nicht weit von hier wegbewegen, damit wir Sergeant Williams und seiner Suchmannschaft die Familie beschreiben können, wenn er mit seinen Leuten hier gleich ankommt.« Er schaute ernst von einem zum anderen.
»Außerdem würden wir womöglich Spuren verwischen, wenn wir jetzt einfach losliefen. Also lassen Sie uns erst einmal danach suchen. Vielleicht entdecken wir Hinweise darauf, in welche Richtung sie gegangen sind.«
Nora nickte nun.
»Mein Gott, ich kann es einfach nicht fassen, dass ein erwachsener Mann zwei kleine Kinder in den Busch mitschleppt, um Hilfe zu holen. Was denken sich diese Leute bloß? Dass um die nächste Ecke eine Shell-Tankstelle auf sie wartet?« Kopfschüttelnd wandte sich Tom dem Straßenrand zu, und Martin und Nora schauten genauso wie er auf den Boden, um im Staub mögliche Fußspuren der Vermissten zu finden. Es schien zunächst aussichtslos, da das Flugzeug und der Roadtrain den Seitenstreifen, den sie absuchten, völlig mit einer frischen Schicht Staub zugedeckt hatten. Als sie sich aber etwas weiter zwischen den Spinifexgräsern, den kleinen Büschen und dünnen Bäumen voranbewegten, entdeckten sie noch einige Fußspuren. Als die Suchmannschaft eintraf, gaben sie die Personenbeschreibungen weiter und konnten auch schon die Richtung zeigen, in die sich die Familie offenbar aufgemacht hatte. Der Sergeant teilte seine Leute in kleine Gruppen ein und wies ihnen Abschnitte des Suchgebiets zu. Da Nora und Martin die Gegend nicht kannten, aber unbedingt helfen wollten, sollten sie bei Tom bleiben, der schon öfter an Aktionen dieser Art teilgenommen hatte. Voller Hoffnung machte Nora sich mit auf die Suche. Tom hatte sich zuvor davon überzeugt, dass sie geeignetes Schuhwerk trugen, und ihnen erklärt, dass sie mit festen Schritten gehen sollten, da durch die Erschütterungen Schlangen und giftige Spinnen vertrieben würden. Nora hatte bei diesem Gedanken geschluckt, schließlich aber einfach an die verzweifelte Gina gedacht. Sie liefen und suchten Stunde um Stunde. Zum ersten Mal wurde Nora klar, dass die grenzenlose Weite, die sie an diesem Land so bewunderte, auch Schattenseiten barg, die weit über das Problem der Einsamkeit hinausgehen konnten. Müde lehnte sie sich an einen dünnen Baum und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche, die jede Gruppe mit auf den Weg bekommen hatte. Nachdem sie sie wieder zugeschraubt hatte, wischte sie sich mit dem Handrücken über die Stirn. Die Temperatur war inzwischen angenehmer geworden, denn die Abendkühle hatte eingesetzt. Besorgt dachte Nora daran, dass in der Dämmerung die Suche sicher auf den nächsten Tag verschoben werden müsste. Tom und Martin drehten sich nach ihr um, und sie stolperte hinter ihnen her, als plötzlich Schüsse ertönten.
Aufgeregt wandte Tom sich der Richtung zu, aus der sie kamen. »Sie haben jemanden gefunden! Schnell, da entlang!«
Im Laufschritt legten sie den Weg quer durch den Busch zurück. Sergeant Williams kam ihnen entgegengerannt.
»Schnell, Doc! Der Junge ist von einer Schlange gebissen worden.«
Tom lief los und rief dem Beamten über die Schulter zu: »Hank, ich brauche meinen Koffer!«
»Der ist schon dort, Tom.«
Als sie an der kleinen Lichtung eintrafen, sahen sie den Mann auf den Knien liegen. Er war erschöpft und völlig außer Atem. Offensichtlich hatte er seinen Sohn über einen längeren Zeitraum getragen, denn in seinen Armen lag leblos ein kleiner blonder Junge. Noras Blick erfasste sofort das Mädchen, das mit großen, ängstlichen Augen seinen Vater beobachtete. Sie ging zu ihr, legte einen Arm um sie und führte sie ein paar Schritte beiseite. Während Nora sich dazu zwang, ruhig zu bleiben, tauchten vor ihrem inneren Auge sämtliche Berichte über Australiens Giftschlangen auf, die sie je gelesen hatte. Sie glaubte sich daran erinnern zu können, dass dieses Land – neben allerlei anderem gefährlichen Getier – allein hundertzwanzig Arten unterschiedlicher Schlangen beherbergte, von denen etwa die Hälfte giftig war. Das Gift des Taipans wirkte so schnell, dass das Opfer kaum noch Zeit hatte, feststellen zu können, dass es gebissen worden war. Energisch verdrängte Nora nun diese Gedanken und versuchte die Kleine abzulenken und damit zu beruhigen, dass sie ihr davon erzählte, wie ihre Mutter mit einem Flugzeug ins Krankenhaus gebracht worden sei und dass es ihr sicher schon besser gehe.
Das Mädchen hatte aufmerksam zugehört und sah ernst zu ihr auf.
»Und Dennis? Wird er im Krankenhaus auch wieder gesund?« Nora schluckte und drückte sie an sich.
»Das müssen wir abwarten. Der Arzt ist aber schon bei ihm.«
Voller Angst konnte sie jetzt beobachten, wie Tom dem haltlos weinenden Mann seinen Sohn abnahm und ihn vorsichtig auf den Boden legte. Auch aus der Entfernung sah sie die Anspannung in Toms Gesicht, der blitzschnell handelte und offensichtlich alles tat, was man nur tun konnte. Aber es war zu spät. Als er sich aufrichtete und ernst den Kopf schüttelte, schloss Nora die Augen. Alles in ihrem Inneren weigerte sich, das zu glauben, was sie eben gesehen hatten. Der Mann war nun völlig zusammengebrochen und kauerte neben seinem Sohn. Unter den Umstehenden der Suchmannschaft herrschte betroffenes Schweigen. Zwei der Männer waren neben den Vater getreten, dem Tom inzwischen eine Spritze verabreichte. Sie halfen ihm auf und führten ihn zur Straße. Zwei weitere legten den toten Jungen auf eine Trage, deckten ihn zu und machten sich ebenfalls auf den Weg zu den Wagen.
Das Mädchen hatte sich aus Noras Arm gewunden und beobachtete die Szene. Tränen standen in ihren braunen Augen, als sie zu Nora aufsah.
»Ist Dennis tot?«
Nora war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Nicht im Entferntesten hatte sie mit einer solchen Tragödie gerechnet. Für dieses Mädchen hier riss sie sich jetzt aber zusammen. Noch nie hatte sie sich in einer vergleichbaren Situation befunden. Sie wollte dem Kind keinen weiteren Schaden zufügen, also überlegte sie kurz. Als Mutter war sie ihren Kindern gegenüber immer ehrlich gewesen, und so beschloss sie, auch jetzt bei der Wahrheit zu bleiben.
Sie ging in die Hocke, griff nach den Händen der Kleinen und zog sie zu sich heran. Ernst sah sie ihr in die Augen und nickte dann.
»Ja, Joanna.«
Als sie das Kind erneut an sich drückte, konnte sie sehen, wie Tom, der allein zurückgeblieben war, mit der flachen Hand gegen einen Baum schlug, sich dann mit beiden Händen über die Schläfen fuhr und anschließend in die Wildnis starrte. Martin kam unsicher auf sie zu. Auch er sah mitgenommen aus.
Dennoch ging er in die Hocke und sah die Kleine an.
»Hallo, ich bin Martin. Du heißt Joanna, nicht?« Als das Mädchen nickte, sagte er: »Komm, du fährst bei uns im Auto mit. Dann kannst du schnell bei deiner Mama sein. Die wartet sicher schon auf dich.«
Joanna griff nach Noras Hand und schweigend gingen sie zur Straße, wo Sergeant Williams die Suchmannschaften auflöste und die Ausrüstung zusammenpackte. Nora setzte das Mädchen auf die Motorhaube eines Geländewagens und reichte ihm die Wasserflasche.
»Hier, Joanna. Bitte trink so viel du kannst. Du brauchst jetzt viel Flüssigkeit, sonst wirst du auch noch krank.«
Martin kramte in der Tasche seiner Kamera.
»Sieh mal. Auch wenn du keinen Hunger hast, diese Traubenzuckerwürfel schmecken dir bestimmt und werden dir gut tun.«
Als Tom auf die Straße trat, wechselte der Sergeant ein paar Worte mit ihm. Tom nickte und kam dann auf den Wagen zu. Auch er sprach mit dem Mädchen und untersuchte es kurz, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Nora setzte sich mit dem Kind nach hinten, während Martin vorn neben Tom Platz nahm. Sie hatte erneut einen Arm um das Mädchen gelegt und strich ihm mechanisch immer wieder sanft über den Kopf. Nach einer Weile schien die körperliche Erschöpfung der Kleinen über ihren Kummer zu siegen, und sie schlief an Nora gelehnt ein.
Voller Entsetzen dachte Nora daran, was Joannas Mutter nun noch bevorstand. Wie verkraftete man den Tod eines Kindes?
Nora schauderte innerlich. In ihrer ausgeprägten Vorstellungskraft erkannte sie, dass das Leben dieser Eltern von jetzt an für immer zweigeteilt sein würde – in die wahrscheinlich unbekümmerte Zeit vor dem Tod ihres Sohnes und in die Zeit danach. Sie biss die Zähne zusammen. Ihr Blick fiel auf den Rückspiegel, in dem sie einen Teil von Toms versteinertem Gesicht sehen konnte, und sie schaute wieder nach draußen. Die Fahrt kam ihr endlos vor.
Toms Hände hielten das Steuer, und er versuchte sich ausschließlich auf die Straße vor sich zu konzentrieren. Er war froh, dass Martin und Nora ebenfalls Schweigen vorzogen. Worüber hätte man jetzt auch sprechen sollen? Seine langen schlanken Finger schlossen sich so fest um das Lenkrad, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Niemals, wahrscheinlich solange er lebte, würde er sich daran gewöhnen können, den Kampf um ein Menschenleben zu verlieren.
Als sie am Krankenhaus eintrafen, kam ihnen Lisa bereits entgegen, um Joanna zu ihren Eltern zu bringen. Das Mädchen sah verstört von Nora zu Lisa und wieder zu Nora. Diese ging in die Hocke, griff nach einer Hand des Kindes und sah ihm offen ins Gesicht.
»Joanna, geh ruhig mit Lisa. Deine Eltern freuen sich bestimmt sehr, wenn sie dich sehen. Ich besuche dich morgen, okay?«
Die Kleine nickte und ging mit Lisa, die einen Arm um ihre Schultern gelegt hatte. Nora sah ihr nach, und plötzlich schossen ihr Tränen in die Augen. Sie presste eine Hand vor den Mund und versuchte krampfhaft, keinen Ton von sich zu geben. Tom hatte seinen Koffer aus dem Wagen gehoben und schlug gerade die Tür zu, als sein Blick auf Nora fiel. Doch Martin, der schnell um das Auto herumgegangen war, stand schon vor ihr, öffnete mit einer hilflosen Geste beide Arme und sah sie betroffen an.
»Komm, Nora.«
Leise weinend lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter und versuchte sich wieder zu fassen. Tom biss die Zähne zusammen und nickte den beiden ernst zu.
»Sie ruhen sich jetzt besser aus. Wir sehen uns dann morgen.« Er ging langsam zum Eingang. Er wusste, dass er so schnell keine Ruhe finden würde; also machte er sich auf den Weg in sein Arbeitszimmer, um noch den Bericht zu schreiben und den Totenschein auszustellen.
In seinem Büro ließ er den Koffer achtlos neben dem Schreibtisch fallen und trat ans Fenster. Die Dunkelheit hatte bereits eingesetzt, und er betrachtete die Lampen, die den Eingangsbereich der Klinik erhellten. Er spürte immer noch dieses Gefühl ohnmächtiger Wut in sich, das sich in ihm breit gemacht hatte, als er den Tod des Jungen hatte feststellen müssen.
Er schloss die Augen und versuchte ruhiger zu atmen. Doch dann drehte er sich um, ging zum Schreibtisch und fegte mit einer schnellen Bewegung alle Papiere und Unterlagen, die sich darauf befanden, zu Boden und trat heftig gegen den Stuhl, der gleich darauf gegen die Wand krachte. Als Lisa mit einer Tasse Kaffee in der Tür erschien, stand er bereits wieder am Fenster und starrte schweigend hinaus. Wortlos stellte sie den Kaffee auf den Schreibtisch und sammelte die Papiere auf, um sie in einem Stapel auf den Tisch zurückzulegen. Leise ging sie zu Tom und öffnete auf ähnliche Weise ihre Arme, wie es Martin zuvor bei Nora getan hatte. Sie kannte Tom schon so lange. Sie wusste, dass er, obwohl er nicht gerne viele Worte machte, bei jedem Patienten, den er verlor, Qualen litt, ganz besonders, wenn es sich um ein Kind handelte. Auch wenn sie nie darüber gesprochen hatten, vermutete sie, dass der Grund dafür vor allem in seiner Zeit in Afrika lag. Außerdem erinnerte sie sich daran, wie sehr ihn vor Jahren der Tod seines zu früh geborenen Kindes getroffen hatte.
Er ließ sich nun kurz in den Arm nehmen und sah sie dann mit einem Ausdruck von Wut und Verzweiflung an.
»Ich werde mich nie daran gewöhnen, Lisa.«
Sie strich ihm ruhig über die Schulter.
»Ich weiß, Tom. Darum bist du auch ein so guter Arzt.«
Als er mit einem höhnischen Nicken nur nach draußen sah, legte sie eine Hand auf seinen Arm.
»Tom, ihr habt Stunden damit verbracht, die Familie zu finden. Und ihr hattet Erfolg. Die Eltern und das Mädchen sind gerettet worden. Niemand kann etwas dafür, dass der Junge von einer Schlange gebissen wurde. Am wenigsten ist es deine Schuld. Tom, du bist immer so hart mit dir selbst. Du hilfst doch, wo du kannst. Aber du bist Arzt und nicht Gott.« Sie ging langsam zur Tür, an der sie sich noch einmal umdrehte. »Komm schon, trink jetzt deinen Kaffee, der wird dir gut tun.«
Er nickte ihr traurig zu. »Danke, Lisa.«
Er zog sich den Stuhl aus der Ecke hervor und setzte sich an seinen Schreibtisch, um die bürokratischen Formalitäten hinter sich zu bringen.
Lisa, die heute für den Nachtdienst eingeteilt war, hatte noch einmal nach der vom Unglück betroffenen Familie gesehen, die jedoch unter dem Einfluss von Medikamenten mittlerweile ruhig schlief. Sie seufzte leise, als sie wieder auf den Gang hinaustrat. Auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung als Krankenschwester war sie sich sicher, dass in den nächsten Tagen noch massive Schwierigkeiten auf sie zukommen würden. Der Vater des Jungen war ohnehin schon nervlich und körperlich am Ende eingeliefert worden, und die Mutter war, nachdem sie vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte, nach einem Nervenzusammenbruch ebenfalls nicht mehr ansprechbar gewesen. Die größten Sorgen machte sich Lisa aber im Moment um das kleine Mädchen, das nun weder in der Mutter noch im Vater einen Halt finden konnte, obwohl es sicher auch sehr unter dem Verlust des Bruders litt. Lisa beschloss, sich nach ihrer spätabendlichen Patientenrunde einen Tee zu machen. Auf dem Weg zum Schwesternzimmer sah sie, dass in Toms Büro immer noch Licht brannte. Besorgt blieb sie einen Augenblick stehen, bevor sie leicht den Kopf schüttelte und das Schwesternzimmer betrat. Es ist wohl am besten, ihn in Ruhe zu lassen, dachte sie.
Kurze Zeit später hatte sie eine dampfende Tasse Tee vor sich stehen und rührte nachdenklich die Milch darin um, während ihre Gedanken – ohne dass sie es eigentlich beabsichtigte – zu Tom abschweiften. Es machte sie immer wieder aufs Neue betroffen, mitansehen zu müssen, wie sehr er litt und sich schuldig fühlte, wenn er einen Patienten verlor. Sie dachte an die Abschiedsfeier, bevor er den Service verlassen hatte, um nach Äthiopien zu gehen. Nach dem Scheitern seiner Ehe schien er froh zu sein, die gewohnte Umgebung verlassen zu können. Auch hatte er noch Selbstbewusstsein und Hoffnung ausgestrahlt, in Afrika etwas bewegen und verbessern zu können. »Dort werde ich wirklich gebraucht, Lisa«, hatte er versucht ihr seine Beweggründe zu erklären. Nach wenigen kurzen Telefonaten war der Kontakt zu ihm abgebrochen. Immer wieder hatten Bill und sie sich bemüht, ihn zu erreichen, doch schien er dort auch mehrere Male den Standort gewechselt zu haben, so dass es ihnen nicht gelungen war, ihn in den Wirren des Bürgerkriegs in einem der Flüchtlingslager ausfindig zu machen.
Nach über zwei Jahren hatten sie – direkt über die Hauptverwaltung des Hilfsdienstes – erfahren, dass ihr Freund nach Australien zurückgekehrt war. Zunächst grenzenlos enttäuscht, dass er sich nicht bei ihnen meldete, war ihre Enttäuschung später in große Sorge übergegangen, da er offensichtlich zu niemandem Kontakt aufnahm. Es musste wohl fast ein Jahr vergangen sein, als sie plötzlich einen Anruf von seiner Schwester aus Darwin erhielten, bei der er kurze Zeit zuvor überraschend aufgetaucht war. Ihren unbekümmert selbstbewussten großen Bruder von früher schien es jedoch nicht mehr zu geben. Aus Sorge wegen seines schlechten körperlichen und seelischen Zustands, aber auch, weil er jegliche Hilfe zurückwies, hatte sie sich entschlossen, seine alten Freunde von früher einzuschalten. Bill und Lisa waren kurze Zeit später nach Darwin geflogen. Lisa schauderte in der Erinnerung an ihre erste Begegnung mit dem Freund in Darwin. Bill und sie waren förmlich zusammengezuckt, als sie Tom mit seinem Neffen im Garten entdeckt hatten. Völlig abgemagert in zerschlissenen Jeans und einem Hemd, das viel zu groß schien, und aus dem seine Schulterblätter spitz hervorstanden, baute er mit dem etwa achtjährigen Sohn seiner Schwester an einer Hundehütte. Als er sich aufrichtete, konnten sie unter seinem Dreitagebart eingefallene Wangen und unnatürlich große, ernste Augen erkennen, aus denen die altvertraute ironische Fröhlichkeit gänzlich verschwunden zu sein schien. Ein wenig fassungslos hatten sie gemeinsam mit Toms Schwester Caroline am Fenster des Wohnzimmers gestanden und einen ersten Blick auf ihren alten Freund werfen können. Caroline schien ihr Erschrecken zu bemerken, denn sie lächelte sie auf seltsam ernste Weise an.
»Sehen Sie, so wie Sie habe ich sicherlich auch ausgeschaut, als er hier auftauchte. Das Schlimme ist, dass er niemanden an sich heranlässt. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm helfen könnte. Ich weiß nicht einmal, ob er nicht krank ist.« Traurig wanderten ihre Augen von ihren Gästen wieder zum Fenster. »Wir haben uns früher so gut verstanden. Ich habe immer alles mit ihm besprechen können, besser als mit meinen Eltern. Wir haben uns so nahe gestanden ... und jetzt spricht er kaum drei Sätze am Tag mit mir. Der Einzige, den er an sich heranlässt, ist Josh.« Sie deutete mit einem Kopfnicken resigniert nach draußen. »Das sehen Sie ja.«
Lisa nahm gedankenverloren einen Schluck Tee, während sie daran dachte, wie Bill und sie damals einen schnellen Blick gewechselt hatten.
Ihr Mann hatte wieder aus dem Fenster geschaut und Caroline gefragt: »Hat er erzählt, wo er das letzte Jahr verbracht hat?«
Caroline hatte ihn verständnislos angesehen.
»Aber Sie wissen doch, dass er in Afrika war.«
Bill war es offensichtlich schwer gefallen, weiterzusprechen, und so hatte Lisa versucht Toms Schwester zu erklären, dass sie in Erfahrung gebracht hatten, dass er bereits vor etwa einem Jahr den Hilfsdienst in Äthiopien verlassen hatte.
Carolines Erschütterung war ihrem Gesicht zweifelsohne abzulesen gewesen.
»Ich ... ich verstehe das nicht. Warum ist er dann nicht gleich zu uns gekommen? Oder zu Ihnen? Hat er denn zu niemandem mehr Vertrauen?«
Ratlos hatten die drei sich auf dem Sofa niedergelassen, als der kleine Josh durch die Terrassentür hereingestürmt kam und laut verkündete, dass sie Durst hätten. Wie angewurzelt war er stehen geblieben und hatte die unerwarteten Gäste gemustert. Seine Mutter zog ihn zu sich heran und erklärte ihm, dass Freunde von seinem Onkel zu Besuch gekommen seien. Strahlend hatte er sich losgerissen. »Oh, das sage ich sofort Onkel Tom!«
Bevor sie sich noch ein wenig mehr auf die Situation hatten einstellen können, war Josh mit Tom, den er an einer Hand hinter sich herzerrte, wieder im Wohnzimmer erschienen. Überraschung hatte sich auf Toms Gesicht abgezeichnet. Lächelnd und trotzdem merkwürdig ernst war er auf sie zugekommen, hatte Bill die Hand geschüttelt und Lisa kurz umarmt. Caroline zog Josh in die Küche, um ihm etwas zu trinken zu geben. Tom war ans Fenster getreten und hatte hinausgesehen.
»Sicher hat euch meine Schwester angerufen, nicht?«
Bill und sie hatten einen unbehaglichen Blick ausgetauscht, bevor Bill aufgestanden war, um sich neben den Freund zu stellen.
»Tom, sie hat sich Sorgen gemacht. Und wir haben schon etliche Male versucht, dich zu erreichen. Warum hast du dich nie mehr gemeldet? Ich dachte, wir sind Freunde.«
Tom war eine Weile still geblieben und hatte mit gesenktem Kopf die Pflanzen auf der Fensterbank angestarrt. Als er schließlich den Kopf hob und seine Kollegen mit großen, ernsten Augen ansah, konnte Bill darin eine Mischung aus Verzweiflung und Bitterkeit erkennen, auch wenn Tom sich jetzt um ein Lächeln bemühte.
»Ich konnte mich nicht bei euch melden, Bill. Das hat aber nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Es ging einfach nicht, und ich kann und will auch nicht erklären, warum. Aber ich brauchte diese Zeit für mich.«
Lisa hatte sich neben ihren Mann gestellt. »War es so schlimm in Afrika? Bist du deshalb so enttäuscht, weil du meinst, du hättest dort mehr erreichen müssen?«
Unmerklich war Tom zusammengezuckt. Seine Augen waren starr auf einen Punkt in der Ferne gerichtet, schienen aber nichts wahrzunehmen. Schließlich wandte er sich zu den beiden um und sah sie seltsam distanziert an. »Ich kann niemandem erklären, wie es dort ist, der nicht selbst da gewesen ist.« Er machte eine Pause und rieb sich die Schläfe. »Ich will auch nicht darüber sprechen. Also spart euch eure Therapieversuche für einen geeigneteren Kandidaten.« Er hatte die Zähne zusammengebissen und drehte mit beiden Händen einen Übertopf auf der Fensterbank herum. Lisa war neben ihn getreten und hatte eine Hand auf seine Hände gelegt.
»Bitte, Tom, schick uns nicht so weg. Wenn du uns nicht wichtig wärst, hätten wir kaum seit Jahren versucht, dich wiederzufinden. Wir wären auch nicht sofort hierher aufgebrochen. Wir machen uns Sorgen um dich, und wir wollen dir helfen.«
Tom hatte inzwischen nach ihrer Hand gegriffen. »Es tut mir Leid!« Er lächelte gequält. »Ich bin wohl nicht sehr höflich gewesen? Aber ich muss damit allein fertig werden.«
»Warum, Tom? Warum willst du alles allein durchstehen? Das tut mir einfach weh. Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht«
Er hob ihre Hand kurz an seine Lippen, bevor er sich erneut zu einem Lächeln zwang. »Glaubt mir, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich bin euch dankbar, dass ihr mir helfen wollt. Aber im Moment bin ich die einzige Person, die mir helfen kann. Auch wenn ihr das jetzt nicht versteht, bitte ich euch, mit mir Geduld zu haben. Ich habe euch nie vergessen, und in einiger Zeit hätte ich mich auch bei euch gemeldet.« Mit einem altvertrauten ironischen Grinsen sah er nun an sich hinunter. »Und selbstverständlich hätte ich mich ein wenig hübscher angezogen, wenn ich von eurem Besuch gewusst hätte.« Nach einer kleinen Pause hatte er hinzugefügt: »Außerdem muss ich mir noch ein wenig Mühe geben, wieder in meine Klamotten hineinzuwachsen, nicht?«
Lisa hätte beinahe die Fassung verloren. Sie hatten ihr Entsetzen über seine schlechte Verfassung also nicht verbergen können. Sie hatte ihn einfach an sich gedrückt und gemurmelt: »Ja, bitte tu das!«
Bill war erneut auf seinen Freund zugegangen.
»Du weißt aber, Tom, dass du jederzeit bei uns willkommen bist, nicht? Es wäre schön, wenn du eines Tages nach Cameron Downs zurückkehren würdest.«
»Ich denke darüber nach, Bill. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das kann.«
Gleich darauf war Josh aus der Küche hereingestürmt und hatte sich an seinen Onkel geschmiegt. »Machen wir draußen weiter, Onkel Tom?«
Seine Finger hatten einen Augenblick mit den dunklen Locken seines Neffen gespielt. »Aber ja. Lauf schon mal vor, ja?«
Caroline war ebenfalls wieder ins Wohnzimmer gekommen und hatte ihren Bruder etwas unsicher angesehen.
»Bist du mir böse, dass ich deine Freunde angerufen habe?«
Als er den Kopf schüttelte und einen Arm um sie legte, schien sie erleichtert zu sein. Sie hatte die beiden Gäste auffordernd angeblickt.
»Sie machen uns doch die Freude und bleiben zum Essen, nicht wahr?«
Lisa sah sich nachdenklich im Schwesternzimmer um, in dem es um diese Zeit sehr still war. Schließlich griff sie nach ihrer Teetasse, um den letzten Schluck Tee zu trinken, und stellte anschließend die leere Tasse in den Geschirrspüler. Merkwürdig, wie lebendig einem bestimmte Dinge in Erinnerung blieben, während man andere völlig vergaß.
Nach dieser Begegnung mit Tom waren noch mehrere Monate vergangen, bevor er dann endlich in Cameron Downs aufgetaucht war. Er hatte zwar deutlich besser ausgesehen, schien im Ganzen aber sehr viel ernster als früher. Auch zu diesem Zeitpunkt war er sich noch nicht im Klaren darüber gewesen, ob er wieder für den Royal Flying Doctor Service tätig sein wollte. Er hatte sich entschlossen, zunächst eine Weile in der Umgebung zuzubringen, half früheren Freunden auf einer Farm aus und lebte auch einige Zeit bei seinen Aborigines-Künstlerfreunden in der Siedlung. Schließlich war er bei einem Notfall als Arzt eingesprungen und hatte anscheinend doch entdeckt, dass er auch hier gebraucht wurde. Als er seinen neuen Vertrag beim RFDS unterschrieb, waren sie und Bill sehr froh darüber gewesen. Nie wieder hatte er über seine Zeit in Afrika gesprochen, und sie waren übereingekommen, ihn damit in Ruhe zu lassen und seinen Wunsch zu respektieren, damit allein fertig werden zu wollen.
Lisa streckte sich und legte den Kopf in den Nacken, bevor sie sich auf den Weg zum Empfang machte, um dort die Unterlagen für die Übergabe zum Schichtwechsel vorzubereiten. Als sie auf den Gang trat, sah sie in Toms Büro immer noch Licht. Leise öffnete sie die Tür, um nun doch nach ihm zu schauen. Er hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt, die Arme vor der Brust verschränkt und war fest eingeschlafen. Sein Kopf war auf die linke Schulter gesunken, und sein Gesicht hatte selbst jetzt, im Schlaf, noch einen unzufrieden besorgten Ausdruck. Vor sich auf dem Schreibtisch lagen sein Bericht und der Totenschein des Jungen. Lisa ging schnell in einen Nebenraum und kam mit einer Decke zurück, die sie vorsichtig über Tom ausbreitete. Er bewegte kurz den Kopf, schlief aber weiter. Sie knipste die kleine Halogenlampe an, die auf dem Schreibtisch stand, und löschte die große Deckenbeleuchtung, bevor sie das Zimmer verließ und langsam zum Empfang ging.