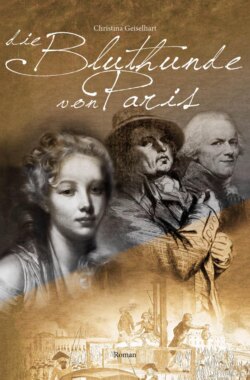Читать книгу Die Bluthunde von Paris - Christina Geiselhart - Страница 10
6. Kapitel
ОглавлениеIn ruhelosen Nächten erschien die Tote ihrer Schwester Philippine. Alberta konnte keine Antwort geben auf all die Fragen, die das schöne Mädchen mit dem Klumpfuß plagten. „Du kanntest den Weiher, liebe Schwester. Du weißt, wo das Moor beginnt. Warum wagtest du dich zu weit vor? Du warst seltsam und liebtest die Einsamkeit, aber liebtest du auch den Tod? Ich weiß wie sehr du die flüsternde Stille im Schilf den feixenden Lauten unserer Wohnung bevorzugtest. Gerne wärst du ein Teil der Natur geworden, denn sie war dir näher als unsere Familie. So wie mir Vraem näher ist als diese fremdartigen Wesen, die das Böse in sich tragen. Und sag mir, liebe Schwester, warum lächelst du im Tod? War er sanft? War er liebevoll? In welcher Gestalt kam er zu dir? Antworte mir! Ich suche dringend nach einer Antwort, denn ich fühle wie mein Herz in dieser Umgebung erfriert.“
Tagsüber floh Philippine auf dem Rücken ihres Pferdes, jagte an den Ufern der Seine entlang, galoppierte in den Wald, preschte die schmalen Pfade hinauf und hinunter, bis sie sich erschöpft an seinen Hals schmiegte, die Zügel lockerte und ihm die Führung überließ. Zum zweiten Mal, seit sie durch die Wälder ritt, steuerte das Tier auf ein verlassenes Landhaus zu und blieb dort stehen. Es lag tief im Waldesinnern, weit entfernt vom Dorfflecken Saint-Ouen, inmitten eines verwahrlosten Gartens, einsam und still, vom üppigen Laub der Eichen überschattet. Nach drei Seiten hin war es durch hohe Hecken von Blicken geschützt, öffnete sich wiederum nach Westen, wo das riesige Eisengatter aus seiner Verankerung heraus gefallen war. Verwundert sah das Mädchen um sich. In diesem Winkel der Erde konnte man den Klang der Stille hören. Den wispernden, unheimlichen Klang einer anderen Zeit. Nie zuvor war sie auf den Gedanken gekommen, hier halt zu machen. Sie fürchtete sich, Räubern oder gefährlichen Waldwesen zu begegenen.
Jetzt, nach Albertas Tod, spürte sie diese Angst nicht mehr. Bevor sie abstieg, fragte sie, ob jemand hier sei und lauschte dem Echo ihrer Stimme nach. Nichts rührte sich. Sie glitt vom Pferd, nahm Vraem die Zügel ab und griff nach ihrer Krücke. Sich umsehend betrat sie den schmalen Pfad, der zum Haus führte. Vraem folgte ihr. Vor einem prächtigen Brunnen aus unbehauenem Stein blieb Philippine neugierig stehen. Unwillkürlich betätigte sie seine hübsch verzierte Pumpe. Nach einigen kräftigen Schüben sprudelte Wasser aus dem Hahn. Vor Staunen stieß sie einen hellen Schrei aus. Der Schrei erschreckte Vraem, die einen Satz machte und aus dem Garten hinausgaloppierte.
„Lauf nicht zu weit!“, rief ihr das Mädchen unbesorgt nach und wandte sich nun dem Haus zu. Die Stufen hinauf zum Portal waren uneben und verwittert, das Portal selbst hing nur noch an einem Scharnier. Vorsichtig drückte Philippine die Tür nach hinten und gelangte in ein mit Schotter verschüttetes Entrée, das sich zu einem großen Raum hin öffnete. Dort musste einst der Salon gewesen sein, denn er legte Zeugnis ab von vergangener Eleganz.
Ein verschlissenes Sofa lehnte an der Wand, rechts neben dem Fenster, von dem ein zerrissener Samtvorhang herabhing, stand ein Louis XIV-Schreibtisch, dem eines seiner eleganten Beine fehlte, links davon strebte eine Bibliothek – oder was von ihr geblieben war – hinauf bis unter die Zimmerdecke aus Stuck. Regale waren durchgebrochen, andere zerschlagen oder mit dunklen Flecken beschmutzt. Auf einigen befanden sich noch Bücher, die den Staub von Jahrhunderten angesammelt zu haben schienen.
An den Wänden wimmelte es von pelzigem grünweißem Schimmel, es roch nach Moder und feuchtem Holz. Je weiter Philippine vordrang, umso mehr gewann sie die Gewissheit, das heimliche Liebesnest eines Herzogs oder einer Gräfin entdeckt zu haben, Liebende, die das Manoir aus mysteriösen Gründen hatten aufgeben müssen. Das breite Bett im angrenzenden Raum war unbeschädigt, aber die Seidenlaken zerrissen, die Kissen zerfleddert und die Matratze schien von Messerstichen durchlöchert. Es sah aus, als wäre das Haus barbarischer Wut zum Opfer gefallen. Alle Wertgegenstände hatte man entwendet, die Leuchter, die noch herumlagen, hatte man verbogen, die Samtvorhänge zerfetzt, das Spiegelglas über dem Kamin willentlich zertrümmert. Am herrlichen Kamin aus schwarzem Marmor hingegen hatte sich niemand vergangen. In die Leiste seines Simses waren rosafarbene Rosetten eingelegt, denen nur Wind und Wetter ihren Stempel aufgedrückt hatten. Verwundert betrachtete Philippine die kostbare Verkleidung des Rauchfangs. Seine Schönheit wirkte verloren inmitten des verwüsteten Raumes. Erstaunt strich sie über seine glatte Oberfläche. Staub, Holz- und Glassplitter blieben an ihren Händen hängen.
Der Ort atmete Geheimnis und Gefahr, aber für Philippine wurde er in den traurigen Wochen, nachdem man Alberta gefunden hatte, zu einem Zufluchtsort. Die Schindeln waren noch intakt und hielten den Regen ab, die Grundmauern hingegen wiesen Löcher auf, als hätte das Gemäuer einst unter Beschuss gestanden.
Jeden Tag, den sie kam, legte sie Hand an, schob Geröll zur Seite, kehrte den Staub hinaus und überlegte, wie sie den scheibenlosen Fenstern ein wohnlicheres Gesicht geben könnte. Die Arbeit war mühevoll, ihr Fuß, der mittlerweile in einem engen Holzschuh steckte, schmerzte, doch sie ließ sich von ihrer Schwerfälligkeit nicht entmutigen. Froh darüber, ihrem Geburtshaus entfliehen zu können, dieser dunklen Höhle, dieser unterirdischen Kammer der Sünde und des Verbrechens, erleichtert und dankbar, nicht mehr den Geruch nach Blut, Schweiß, Cidre und Samen einatmen zu müssen, wollte sie alle Mühsal der Welt auf sich nehmen, wenn nur dieser Ort für kurze Zeit zu dem ihren würde.
Seit langem schien er verlassen, warum sollte sich ausgerechnet jetzt, da sie ihn gefunden hatte, jemand seiner erinnern? Er war abgeschieden, keine Straße führte zu ihm, nur verschlungene Pfade und der Weg hinterm Haus, auf dem man zu einer kleinen Lichtung gelangte, die zwischen den mächtigen Stämmen der Eichen hindurchschimmerte. Hier in diesem verwunschenen Manoir, war trotz des Staubes, den zerschossenen Mauern, dem Unkraut, das durch den aufgeweichten Holzboden drängte, alles rein. Und der Ort würde rein bleiben, solange ihre Mutter nichts davon wusste. Ihre Mutter hatte eine schwarze Seele, deshalb nahm sie sich vor der Frau in Acht. Trotz aller Mühe und Liebe, die Lea in den letzten zwölf Jahren auf Philippine verwendet hatte, hatte sie nicht wirklich das Herz des Mädchens erreichen können. Geräuschlos hatte sich zwischen den beiden eine Mauer errichtet. Das Leben, je weiter es voranschritt, trennte die beiden. In Lea wohnte das Verderben und wer sich nicht vor ihr schützte, wurde vom Verderben mitgerissen.
Eines Tages - zwei Monate waren seit Albertas Tod vergangen - kam Philippine erst gegen Abend zum Landhaus. Schon aus der Entfernung sah sie Licht durch die Bäume schimmern. Verwundert hielt sie an, stieg vom Pferd, band die Zügel fester um den Hals des Tieres und schlich zum Haus. Auf leisen Sohlen - was mit der Krücke und dem derben Schuh schwierig zu bewerkstelligen war - näherte sie sich einem der Fenster. Sie entdeckte Holz im Kamin, eine Schreibrolle in einer Nische des Vorsprungs, große, hohe Kerzen. Das Haus gehört jemand, durchfuhr es sie. Aber natürlich gehört es jemand, echote es in ihrem Kopf. Das hast du von Anfang an gewusst, nur wolltest du es nicht wahrhaben. Ja, das verlassene Gemäuer im Wald war zu ihrem Haus geworden, zu ihrem Zuhause und fast war es Heimat. Der Gedanke, es aufgeben zu müssen, schnürte ihr die Kehle zu.
Falls der Eigentümer sie hier erwischte, würde er sie davonjagen oder schlimmer noch: Vielleicht würde er sie dafür bestrafen, seinen Besitz eigenmächtig betreten zu haben. Traurig blickte sie durch das Fenster, über dessen Kopfseiten sie schon Haken gehämmert hatte, um daran Stoffe zu befestigen. Vraem graste wie üblich auf der Lichtung jenseits der Eichen. Sie überlegte, ob sie die Stute rufen sollte, aber das Gefühl, vielleicht nie wieder zurückkommen zu dürfen, hielt sie ab, und einen stillen Moment lang spürte sie mit allen Sinnen ihrem einzigen Traum nach: Dem von Wärme, Geborgenheit. Dem von Heimat, von Zugehörigkeit. Dem von Liebe. Schritte rissen sie aus ihrer Gefühlswelt. Vor Angst gelähmt duckte sie sich, wartete, versuchte die Geräusche, die sie nun hörte, zu deuten. Jemand näherte sich dem Kamin, Holz wurde nachgelegt. Dürres, leicht entflammbares Holz, denn plötzlich knisterte es laut.
Philippine erkannte die Möglichkeit, unbemerkt in den Raum zu blicken und tat es. Der Abend hatte sich herabgesenkt, so dass die Dunkelheit ihr Schutz bot, während dagegen die Person im Innern des Hauses im flackernden Licht stand. Der Mensch vor dem Kamin hatte Kleinholz in den Rauchfang geworfen und die Glut geschürt. Die auflodernden Flammen erhellten sein Gesicht, und je tiefer sie sich in das Holz fraßen und den hohlen Schacht beleuchteten, umso deutlicher zeichnete sich seine Gestalt ab. Erstaunt und ängstlich zugleich betrachtete das Mädchen den Fremden. Ein junger Mann beugte sich über das Feuer und rieb seine Hände. Noch nie hatte Philippine solche Hände gesehen. Weiß, feingliedrig, schön geformt. So sehen die Hände eines vornehmen Menschen aus, dachte sie mit klopfendem Herzen.
Da der junge Mensch in die Glut blickte, zeichnete sich sein Profil ab und Philippine dachte weiter: „So sieht das Profil eines vornehmen Mannes aus. Feine Nase, schön geschwungener Mund, ein wohlgeformtes Kinn, dunkles Haar, das in Locken auf die Schultern fällt. Träume ich?“ Philippine wagte kaum zu atmen und duckte sich rasch hinter den Fenstervorsprung, weil der Fremde sich aufrichtete und nach den Kerzen griff. Er befestigte sie in einem Kerzenleuchter, dessen Form und Eleganz unter der gelbfleckigen Schwärzung Silber erahnen ließ. Die Dochte entflammten und beleuchteten seine großen Augen. Er legte seinen Rock ab, rückte das verschlissene Sofa an die Feuerstelle und holte die Schriftrollen vom Sims. Mittlerweile hüllte der Abend das Gemäuer in seine dunkle Kutte. Kalt war es nicht, nur etwas frisch. Es roch nach Herbst und Regen. Vielleicht lockte all dies die treue Vraem zurück zum Haus. Gemächlich trabte die Stute zu Philippine, wieherte leise und stupste sie mit den Nüstern. Unwillkürlich entfuhr dem Mädchen ein Schrei und sogleich schnellte der junge Mann hoch, während er sich gleichzeitig in einen dunklen Winkel des Zimmers duckte. Vraem war nicht zu übersehen und das kauernde Mädchen neben ihr ebenso wenig. In den Augen des Fremden spiegelten sich Wut und Erleichterung, als er sich dem Fenster näherte.
„Wer bist du? Was hast du hier zu suchen?“, fragte er zornig, wobei er am ganzen Leibe zitterte. Philippine, die ebenso zitterte, aber nicht verstand, warum ein junger, edler Herr wie er in diesen verstörten Zustand kommen konnte, erklärte mit scheuer Stimme, was sie herführte und warum sie sich am Fenster verstecke. Sie fürchtete den jungen Mann nicht, dennoch hütete sie sich, von ihrem Elternhaus zu erzählen. Würde er sie nicht sofort hassen, erführe er, dass sie die Tochter des Verhörvollstreckers war?
Und schon fühlte sie sich klein, unbedeutend, ja ganz und gar hässlich unter seinem herrischen Blick, der Verachtung und Arroganz ausdrückte. Seine Nase stand hoch, seine Lippen waren trotzig aufgeworfen.
Gleichzeitig zitterte er. Und Philippine fragte sich erneut, warum er zitterte. Ja, sie stellte sich viele Fragen, während sie da am Fenster stand, den Körper an ihr Pferd gelehnt. Wer war der junge Mann? Was trieb einen vornehmen Herrn mit Glutaugen und glänzendem Haar in ein verlassenes Landhaus? Trieb ihn ein Verbrechen dort hin? War er ein Mörder? Vielleicht Albertas Mörder? Steif vor Angst verfolgte Philippine jede Geste des Fremden. Wohl hatte er ein schönes sanftes Gesicht, aber so ein Gesicht konnte sich der Teufel auch zulegen.
Sie beschloss zu gehen, wenn es auch bedeutete, niemals wieder kommen zu dürfen. Auf ihre Anordnung hin, beugte Vraem die Vorderbeine und ermöglichte es Philippine aufzusteigen. Mit ihrem langen Rock verdeckte das Mädchen geschickt den klobigen Schuh. Obwohl der Fremde dem Aufstieg aufmerksam zugesehen hatte, schien er ihre Behinderung nicht wahrgenommen zu haben. Als Philippine auf dem Pferderrücken saß, sagte er streng:
„Ich kenne dich nicht! Nenn mir deinen Namen!“
Sie zögerte und machte Anstalten davon zu reiten. Flink sprang der junge Mann aus dem Fenster und griff nach den Zügeln.
„Deinen Namen! Warum fürchtest du dich davor, ihn mir zu sagen?“
„Weil ...,“ sie stockte. Der Blick des Jünglings ließ sie nicht los. Aus ihm sprach nicht mehr Verachtung. Philippine las darin Zorn und Angst. Vor irgendetwas hat er Angst, dachte sie. Davor, dass man seinen Mord aufdeckt?
„Du willst ihn mir also nicht nennen? Gut, dann antworte mir auf eine andere Frage: Willst du in dieses Haus weiterhin zurückkehren?“
Heftig nickte das Mädchen.
„Würdest du dafür alles tun?“
Wieder nickte es. Diesmal zögernd.
„Dann verrate niemanden, dass du mich getroffen hast. Versprichst du es!“
„Ich verspreche es! Es gibt niemanden, dem ich es verraten könnte. Es gibt niemanden, dem ich vertraue. Außer Vraem. Die Stute ist mein treuer Begleiter, meine Freundin, mein Beistand. Nur schade, dass sie nicht sprechen kann!“ Philippine hatte Tränen in den Augen. Erstaunt ließ der junge Mann die Zügel los.
„Dann geh! Aber komm morgen wieder. Und bring etwas zu Essen mit.“
„Das werde ich bestimmt tun!“ Zaghaft lächelnd streichelte sie die Mähne des Tieres.
„Ich kenne dich nicht, du verschweigst deinen Namen, hast keinen Rang und doch glaube ich dir. Missbrauche mein Vertrauen nicht.“ Er gab dem Pferd einen Klaps auf die Kruppe.
*
In dieser Nacht konnte Philippine nicht schlafen. Mit offenen Augen starrte sie an die Decke der Schlafkammer, die sie mit Frieda teilte und zuvor auch mit Alberta geteilt hatte. Wieder und wieder erschien ihr der junge Mann, leuchtete hell sein Gesicht unter den dunklen Locken und funkelten die Augen. Er schaute zärtlich. Er lächelte. Nur entsprangen Zärtlichkeit und Lächeln allein ihrer Phantasie. Die Wirklichkeit war anders. Sie schenkte ihr nichts. Schon gar nicht das Lächeln eines vornehmen Herrn. Und wäre es nicht recht kühn von ihr, Freundlichkeit erwarten zu wollen von Menschen, die einer ganz anderen Welt angehörten als sie? Wer war sie denn? Ein Nichts! Sie musste dankbar sein, dass er ihr erlaubt hatte, ins Landhaus zurückzukehren.
Allmählich kam die Müdigkeit. Auf der Schwelle zwischen Wachen und Schlaf sah sie Alberta. Mit ausgestreckten Armen wie eine Schlafwandlerin ging sie durch den Wald bis zum Weiher. An seinen Ufern sank sie ein. Zuerst die Füße, dann die Beine, der Bauch. Immer tiefer sank sie bis nur noch ihr Gesicht aus dem Schlamm ragte. In dem Augenblick tauchte der junge schöne Mann auf. Er streckte seine Hand aus, um Alberta herauszuhelfen, aber eine andere Hand schlug die seine weg und Alberta versank im Morast.
„Nein!“, schrie Philippine und schreckte hoch. Um sie herum war es dunkel und still. Frieda atmete gleichmäßig, Aus dem Nebenraum drang das Schnarchen ihres Vaters. Reglos blieb Philippine im Bett sitzen und lauschte. Ein sanfter Wind wehte ums Haus. Hin und wieder kratzten die Äste des Ginsterbusches an der Holzfassade des Hauses.
Vraem wieherte leise. Sonst regte sich nichts. Philippine legte sich wieder hin. Sie schlüpfte tief unter die Decke und flüsterte: „Nein! Er ist kein Mörder. Aber wovor hat der junge Herr Angst?“
*
Noch nie war ihr der Unterricht beim Pfarrer von Saint-Ouen so öde erschienen. Immer wieder tauchte der junge Mann vor ihrem geistigen Auge auf und Pfarrer Roumanet musste sie aus ihren Träumereien rütteln.
„Was ist mit dir, mein Kind? Selten habe ich dich so unkonzentriert erlebt. Langweile ich dich? Soll ich aufhören?“
Heftig schüttelte Philippine den Kopf. Oh, nein, sie wollte lernen, viel lernen. Jetzt umso mehr, denn seit gestern Abend gab es ein konkretes Ziel. Hatte sie bisher nur deshalb so fleißig gelernt, um sich von ihrem Elternhaus zu unterscheiden, so tat sie es jetzt, um jemanden zu beeindrucken. Wusste sie bis vor einigen Stunden nicht, ob sie die Kunst des Schreibens und Lesens jemals weiterbringen würde, war sie doch nur die arme Tochter eines Folterers und zudem eine Frau – und gelehrte Frauen hatten ein schweres Los – so wusste sie jetzt wofür der Unterricht gut war. Er gab ihr die Möglichkeit, eine andere, eine hellere Welt zu betreten als es die ihre war. Und sollte sie auch niemals weiterkommen als bis zur Schwelle dieser Welt, so hätte sie doch einmal durch ein kleines Fenster in sie hinein geblickt. Und diesen kurzen, vielleicht nur flüchtigen Blick würde ihr der junge Mann niemals gewähren, wäre sie ein hirnloses, kicherndes Geschöpf.
„Hast du deine Zunge verloren? Ich habe dich gebeten diesen Absatz zu lesen und du starrst mich fragend an.“ Pfarrer Roumanet knallte seinen Zollstock gegen die Holzbank, an der die beiden arbeiteten und deutete mit seinen krummen Fingern auf eine Stelle im Buch. Philippine schreckte aus ihren Gedanken. Sie entschuldigte sich viele Male, erzählte von der schlaflosen Nacht, der Sorge um Vaters Gesundheit und vom Kummer über die Mutter und die Schwester. Roumanets Augen unter den buschigen Brauen blitzten schockiert. Sein Gesicht wirkte sehr bekümmert mit einem Mal.
„Oh, ja! Nimm dir kein Beispiel an diesen Menschen. Das Handwerk deines Vaters ist verabscheuenswürdig, aber er ist ein armer Tropf und hat Chancen auf einen Platz im Himmelreich. Die beiden anderen jedoch sind verdorben. Sie sind gottlos, Werkzeuge des Teufels. Hüte dich vor ihnen! Geh deinen eigenen Weg. Lerne! Höre, was ich sage!“ Jeden seiner Sätze unterstrich er mit einem Klopfen gegen die Holzbank, was Philippine gänzlich ernüchterte. Energisch verscheuchte sie ihr Traumgebilde und konzentrierte sich die verbleibenden Stunden auf ihre Aufgaben. Sie hatte noch eine Schriftrolle zu kopieren und ein Gedicht aufzusagen.
Heute ging es um den direkten Vorgänger des derzeitigen Königs. Es war der Bourbonenkönig Ludwig XV. Anfangs nannte man ihn „le roi bien aimé“, den geliebten König, aber schon in den ersten Jahre seiner Regierungzeit und dem Wechsel einiger Finanzminister zeigte sich, dass der geliebte König nicht fähig war, die horrenden Schulden seines Vorgängers Ludwig XIV zu verringern und die Lebensqualität seines Volkers zu verbessern. Im Gegenteil. Harte Winter, Missernten, der zermürbende siebenjährige Krieg und schlechte Politik verschlimmerten die Zustände im Land. Aus „le roi bien aimé“ wurde „le roi mal aimé“, dessen Eroberungszüge sich auf die Jagd nach Maitressen beschränkte. Aus Roumanets Geschichtsinterpretation hörte Philippine oft Entrüstung und eine leichte Neigung zur Rebellion heraus.
Gegen Ende der Lehrstunden verließ der Pfarrer dann das Thema Königshaus und Absolutismus und rundete den Unterricht mit einer Episode aus dem Leben eines wirklichen Helden der Französischen Geschichte ab. Darauf freute sich das Mädchen besonders. Begierig hing es an den Lippen des Mannes. Der Fremde im Wald rückte für eine Weile in den Hintergrund.
„Im siebenjährigen Krieg kämpft Ritter d’Assas gegen die Preußen. In einer Nacht des Jahres 1760 streicht er mit einer Einheit des Regimentes d’Auvergne lautlos an den Ufern des Rheins entlang, geschützt von Büschen und Sträuchern. Mutig leitet er in sicherem Abstand seine Mannen, da wird er plötzlich von preußischen Soldaten eingekreist, sie drücken ihre Bajonette an sämtliche Stelle seines Körpers und zischen: Wenn du ein Wort sagst, bist du ein toter Mann. D’Assas zögert nicht. Er dreht sich um und ruft seinem im Dunkeln verborgenen Trupp zu: Auvergne: schießt! Wir sind vom Feind umzingelt.
Ritter d’Assas stirbt von unzähligen Bajonetten durchbohrt, aber sein Regiment ist gerettet. Ist das nicht ein furchtloser, verehrenswürdiger Mann, liebes Kind? Solche Männer brauchen wir heute. Wagemutige Männer und nicht solche, die sich hinter Rockschößen verbergen oder Hirsche jagen wie unser König.“ Seine Brauen formten gezackte, schwarze Dreiecke unter denen seine Augen fiebrig glühten. Philippine bekam eine Gänsehaut. Gott sei Dank war der Unterricht zu Ende. Sie durfte aufstehen. Als sie zur Tür ging, rief er:
„Ach, und dass ich es nicht vergesse! Du sollstest deinen Fuß begutachten lassen. Unser Doktor befolgt sehr gewissenhaft seine Entwicklung. Wie ich dir schon sagte, ist er ein gelehriger Schüler von Nicolas Andry de Boisregard.“ Er wandte sich seiner Bibliothek zu und holte ein schweres, in Leder gebundenes Buch heraus: „L’art de prevenir ou de corriger dans les enfants les difformités du corps - die Kunst, Malformationen des Körpers bei Kindern vorzubeugen oder zu korrigieren“, las er vor. „Ganz im Sinne unserer aufklärerischen Zeit. So wenig wie das Oben und Unten unserer Gesellschaft eine von Gott gewollte Ordnung ist, so wenig ist der Mensch der Natur wehrlos ausgeliefert. Man kann sie beeinflussen und verändern durch gezielte Behandlung, behauptet Boisregard!“
„Vielen Dank, Pfarrer Rounanet. Sie haben es mir schon gesagt.“
„Gut, dann denke daran, morgen Zeit für den Facharzt in Paris einzuplanen. Und danach werde ich dir vom unerbittlichen Kardinal Richelieu erzählen.“
Das Mädchen nickte freundlich und wandte sich zum Gehen.
Kaum hatte es den hinteren Teil der Kirche verlassen, saß es auch schon auf seinem Pferd. Jetzt wollte Philippine noch etwas Eier und Käse erwerben – Kartoffeln und Brot hatte sie schon am Morgen gehortet, um es bis zum Abend im Stall zu verstecken. Auf diese zweite Begegnung mit dem jungen Herrn freute sie sich. Gleichzeitig klopfte ihr Herz bis zum Hals vor Furcht, er könnte sie davonschicken.
*
Bepackt mit Nahrungsmitteln und einem Tongefäß, in das sie Cidre aus dem väterlichen Cidrefass gefüllt hatte, ritt sie in den frühen Abendstunden zum Landhaus. Hinter den Bäumen ging gerade die Sonne unter und ihr letztes Licht filterte gebrochen durch die Wipfel. Silbern schimmerten die Stämme, und die von Wurzeln, Grasnarben und Moos durchwachsene Erde glänzte golden. Einige Meter vor dem Haus brachte Philippine ihr Pferd zum Stehen und rief mit gedämpfter Stimme:
„Ich bin es. Ist jemand zuhause?“
Niemand antwortete. Sämtliche Fenster waren verhangen oder zugestellt. Sekundenlang fürchtete Philippine der junge Herr sei verschwunden. Dann blitzte der Gedanke in ihr auf, dass es den jungen Mann gar nicht gab und sie alles geträumt hatte. Zögernd wiederholte sie ihre Frage. Wieder keine Antwort. Noch immer auf dem Rücken ihres Pferdes näherte sie sich dem Haus. Zur Eingangstür führten Stufen. Unmöglich konnte sie auf dem Rücken des Pferdes ins Haus dringen, absteigen jedoch wollte sie nicht. Falls sich der junge Mann verbarg, würde er ihre Missbildung sehen und jegliche Hoffnung, in seiner Nähe bleiben zu können, wäre verloren. Ruhig dirigierte sie ihr Pferd ums Haus herum, bis sie bei dem Fenster angelangten, durch das sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Sie beugte sich ein wenig vor, um unter dem zerschlissenen Vorhang hineinblicken zu können.
„Sind Sie noch da?“, flüsterte sie. „Bitte sagen Sie etwas!“
„Bist du allein?“, entgegnete eine atemlose Stimme. Philippines Herz machte einen Satz.
„Natürlich bin ich es.“
„Schwöre es beim Leben deiner Mutter!“
„Ich schwöre es beim Leben meines Pferdes.“
Ein amüsiertes Lachen antwortete ihr. Und plötzlich tauchte ein dunkler Schopf hinter dem Sofa hervor.
„Das ist so ganz ein kindisches Geplapper. Was gilt schon der Schwur auf das Leben eines Pferdes?“ Nachdem er argwöhnisch um sich geblickt hatte, traute er sich ganz hervor und näherte sich mit dem Ausruf: „Er gilt nichts!“
„Sie täuschen sich, mein Herr! Ihr Zutrauen ist der beste Beweis. Sie wagten sich aus ihrem Versteck.“
Ein Blitz des Erstaunens flog über das Gesicht des Jünglings.
„Oho, du bist nicht dumm! Rasch, geh zum Eingang. Ich sterbe vor Hunger.“
Philippine drückte Vraem vorsichtig in die Flanken und schon in wenigen Sekunden stand sie vor dem Eingang, wo sie der Herr ungeduldig erwartete.
„Was ist los? Warum steigst du nicht ab und schaffst den Proviant ins Haus?“
Stockend bat das Mädchen, er möge den Vorrat selbst holen, worauf der freudige Ausdruck im Gesicht des Mannes erstarb. Für wen sie sich halte, schäumte er. Ob sie zum gemeinen Pöbel gehöre, der Hilfe mit Hoffart entgelten lassen wolle? Dann könne sie gehen. Trotz großen Hungers verzichte er auf jeglichen Beistand tückischer Helfer. Sagte es wild und schlug entschlossen die Tür zu.
Ratlos verharrte Philippine auf ihrem Pferd. Sie seufzte, hob den Blick zum Himmel und schüttelte schließlich den Kopf.
„Er hat ja Recht. Was erwarte ich von einem Menschen seines Standes? Dass er zu mir aufschaut? Mich vom Pferd hebt wie eine Prinzessin? Ach!“ Sie zuckte resignierend die Schultern. „Hör auf zu träumen, kleine Philippine!“ Ihr linker, gesunder Fuß tippte gegen Vraems linkes Vorderbein worauf das Pferd in die Knie ging, um seinem Reiter den Abstieg zu erleichtern.
Ohne Krücke, beladen mit den beiden Jutesäcken, tat sich Philippine schwer. Mühsam schleppte sie sich einige Meter, doch da riss er die Tür so unwirsch auf, dass man fürchtete, sie falle aus ihren Angeln und der junge Mann stürzte heraus.
„Warum sagst du nichts?“ Vorwurfsvoll wies er auf ihren Fuß. „Ich bin doch kein Sklavenhalter!“ Er entwendete ihr die Säcke und schulterte sie. Dann reichte er seinen Arm. „Stütze dich darauf.“
Das Mädchen ließ sich nicht zweimal bitten. Absichtlich verschwieg sie, dass sie stets ihre Krücke mit sich führte. Sie steckte in einem Halfter, dessen Gurt sich um den Pferdeleib schlang.
Als sie im Innern angekommen waren, lud er die Säcke ab und forderte Philippine auf, sich in einen der Sessel zu setzen. Trotz der verhangenen Scheiben war der Salon gemütlich und aufgeräumt. Ein behagliches Feuer brannte im Kamin. Philippine zögerte und setzte sich nicht gleich.
„Nie zuvor wäre mir die Idee gekommen, einem Kind des Volkes meinen Arm zu reichen! Ha!“ Er lachte über sich selbst. Es war ein verkrampftes Lachen. „Und da ich galant bin, habe ich dir gleich einen Sessel angeboten. Du kannst dich glücklich schätzen. So großherzig bin ich nicht oft.“ Sein Blick fiel auf ihren Fuß. „War es ein Unfall?“
Das Mädchen schüttelte den Kopf und sagte es ihm.
„Oh, das tut mir leid! Andererseits bist du an nichts anderes gewöhnt, wohingegen der arme Hund, den der königliche Folterer zum hinkenden Krüppel macht, sich an bessere Zeiten erinnern kann.“
Bei seinen Worten war Philippine kalkweiß geworden. Sie wirkte so niedergeschmettert mit einem Mal, dass der junge Herr sie eilig zum Sessel schob und sie hineindrückte.
„Werde um Himmels Willen nicht in meiner Gegenwart ohnmächtig. Ich habe genug Verdruss.
Es würde das Fass zum Überlaufen bringen, rückte mir einer der streunenden Räuber auf den Leib, in der Annahme ich hätte seiner Tochter etwas angetan.“ Hastig sprang er zum Fenster und rückte den zerschlissenen Stoff zurecht, der einst als Vorhang diente und den er zur Seite geschoben hatte, um Philippines Ankunft zu beobachten. „Hin und wieder tauchen diese zerlumpten Gestalten hier auf. Das gefällt mir nicht.“
„Mein Vater ist kein Räuber. Im Übrigen brauchen Sie sich nicht vor Räubern zu fürchten, Herr! Sie halten sich hier nicht auf, weil sie nichts zu essen finden und nie ein Reisender durchkommt.“
„Aber ich habe welche gesehen!“, rief er aufgebracht. „Sie zogen auf dem schmalen Weg entlang, den du zu Pferde kommst. Wenn sie hier einbrechen, bin ich ihnen ausgeliefert.“ Zitternd wies er auf den Pfad unweit des Hauses. Aus großen Augen sah das Mädchen den jungen Mann an. Betroffen verfolgte sie seine Gesten, die wilden Schritte, mit denen er von Fenster zu Fenster eilte und überprüfte, ob man von außen hereinsehen konnte. Nervös wandte er sich um und blickte Philippine flammend an: „Bin ich hier sicher? In diesem Wald, in dem es vielleicht von Räubern wimmelt, in diesem Haus? Und du? Wer bist du? Bist du vielleicht ein Spion?“ Mittlerweile war es dunkel geworden. Im Schein der lodernden Flammen des Kaminfeuers hatte das Gesicht des Mannes etwas Gespenstisches. Wie Kohlen glühten seine dunklen Augen. Fasziniert starrte das Mädchen ihn an. Er trat näher, beugte sich ein wenig zu ihm herunter.
„Antworte!“
„Ich ...!“
„Antworte! Keine langen Überlegungen!“
Drohend stand er vor dem Mädchen, das eingeschüchtert den Kopf einzog.
„Ich weiß nicht, was ein Spion ist!“, begann es langsam. „Aber ich schwöre Ihnen beim Leben meines Pferdes, mit keinem Menschen von Ihnen gesprochen zu haben, und es niemals zu tun, solange Sie es wünschen, mein Herr!“ Sie schlug die Augen nieder. Dadurch konnte sie nicht sehen, dass es nun er war, der sie erstaunt ansah. Allerdings spürte sie, wie er sich entspannte. Spürte seinen Atem, der ruhiger wurde und sie wie ein zartes Streicheln auf der Stirn streifte.
„Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin nervös, müde und ...!“
„Hungrig!“, ergänzte Philippine. „Lassen Sie mich die Nahrungsmittel auspacken!“ Sie wollte aufstehen, doch der junge Herr hinderte sie daran.
„Warte! Ich bringe sie her. Wir werden hier gemeinsam essen. So bin ich sicher, dass du mich nicht vergiften willst.“ Zwinkernd schob er einen zweiten Stuhl und den Tisch heran. Und kaum hatte Philippine um sich geschaut, war er wieder da, packte Speck, Butter, Eier und Brot aus. Nebenbei sagte er hektisch:
„Dein Pferd ist weg. Ich habe es nicht gesehen als ich durch den Vorhang spähte.“
„Vraem hat die Angewohnheit, auf der Lichtung zu grasen, während ich im Haus bin.“ Das Mädchen holte ein Messer aus der Schnalle an ihrem Gürtel und schnitt den Speck.
„Gib mir das Messer! Ich werde das Brot schneiden. Den dicken Laib kriegst du halbe Person nicht klein. Erzähle mehr von dir und deinem interessanten Pferd.“
„Nun, solange das Gras noch saftig ist und voller Kleeblätter und Löwenzahn, frisst Vraem recht vergnügt und vergisst die Welt um sich herum. Sie würde niemals fortgaloppieren.“
„Hmm!“, machte der junge Mann. „Und was ist mit dir? Würdest du am liebsten fortlaufen? Ich meine, vor deinem Elternhaus davonlaufen.“ Hungrig schob er sich Speck und Brot auf einmal in den Mund. Hastig schälte er das Ei und biss genussvoll hinein. Das Mädchen gewann den Eindruck, er habe seit Wochen nichts gegessen. Gebannt sah sie zu, wie er Speck und Eier vertilgte, das Brot regelrecht hinunterwürgte. Ganz in seinen Anblick vertieft vergaß sie völlig, selbst zu essen. Obwohl er eher wie ein Tier alles verschlang und nichts von der guten Kinderstube aufwies, die er als Kind aus adeligem Haus sicherlich hatte, fand das Mädchen ihn schön. Alles an ihm gefiel ihr. Die schmalen Hände, die hohe blasse Stirn, in die dunkle Locken fielen, die wachen Augen und dieser Mund, hinter dem alles Essbare verschwand. Sie hätte ihn den ganzen Abend, die ganze Nacht, ja ein ganzes Leben nur ansehen mögen. Ihr aufgerissener Blick irritierte den jungen Herrn.
„Starr mich bitte nicht so an! Iss und erzähle von dir, damit ich nicht ganz im Dunkeln tappe.“
Schüchtern griff Philippine zu. Sie nahm ein kleines Stückchen Speck, biss vom Brot, schälte ein Ei.
„Von mir gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin ein gewöhnliches Landmädchen.“
„Nun, so gewöhnlich bist du nicht. Du hast ein schönes Pferd, bringst üppig zu essen. Ich nehme an, dein Vater ist kein Hungerleider.“
Seufzend wischte er sich die Hände an der Hose ab und nahm vom Cidre. Er trank ihn aus dem Tongefäß.
Gläser gab es natürlich nicht. Ein zufriedenes Lächeln trat auf seine Lippen. Er lehnte sich im Stuhl zurück und sah das Mädchen eine Weile an, ohne etwas zu sagen. Unter dem durchdringenden Blick seiner dunklen Augen erschauderte Philippine. Es war nicht Furcht, eher furchtsame Erwartung eines unbekannten Ereignisses. Unerklärlicherweise fühlte sie sich zu diesem Fremden hingezogen. Nichts außer seiner Schönheit sprach dafür, ihm zu vertrauen. Er war auf der Flucht, er hatte Angst und es schwebte der Verdacht des Mordes über ihm. Im Bann ihrer Überlegungen war Philippine die Veränderung in seinem Blick entgangen. Sie bemerkte es erst, als er sagte:
„Was auch immer dein Vater für ein Handwerk betreiben mag, es hilft ihm, seine Familie gut zu ernähren. Später wirst du einen rechtschaffenen Mann heiraten und sollten sich die vermaledeiten Zustände unseres Landes verbessern, wird es dir recht gut gehen.“
„Werde ich mit diesem Fuß jemals einen Mann finden?“ Sie zeigte auf die Missbildung. Verblüfft warf der Jüngling die Arme hoch.
„Lieber Himmel, ein Mann schaut nicht auf deinen Fuß. Er schaut in dein Gesicht und das ist schön. Dein Haar ist herrlich. Noch bist du ein Kind, aber wenn du erst einmal zur Frau gereift bist ...“ Schelmisch zwinkerte er ihr zu. Dann schnellte er plötzlich hoch und rief:
„Es ist Zeit für dich heimzukehren. Der Abend ist sehr dunkel heute. Es wäre mir nicht recht, stoße dir etwas zu, denn ich erwarte dich morgen zurück. Verberge gut dein Haar und dein Gesicht.“ Er half ihr aus dem Sessel.
An der Tür zwirbelte Philippine ihr Haar zu einem Dutt und wickelte ein Tuch um Kopf, Kinn und Mund. Auf ihren leisen Pfiff hin tauchte Vraem aus der Dämmerung.
„Ein wirklich schönes Tier!“, bemerkte der Edelmann anerkennend.
„Und der beste Wächter. Würde jemand ums Haus streunen, wären wir sofort gewarnt.“
„Dann solltest du mir die Stute lassen, Landmädchen.“
„Das würde ich, wäre es möglich. Doch Vraem wird nicht bei Ihnen bleiben.“
„Schönes und treues Tier. Bis morgen!“ Er begleitete sie nicht bis zu ihrem Pferd, sondern blieb im Dunkeln hinter der Tür stehen bis sie aufgestiegen und fortgeritten war.
Fast täglich ritt Philippine zum Landhaus. Da die Tage kälter wurden und die Nacht früher hereinbrach, schleppte sie Decken und groben, warmen Vorhangstoff für die Fenster herbei. Auf seine Bitte hin brachte sie auch Kleidung. Denn am Brunnen im Garten wusch er sich nicht nur, er spülte auch seine Leibwäsche dort aus und hing sie am Kamin zum Trocknen auf. Als er nach einer Woche ausstaffiert war, fragte er nach Werkzeugen, um die kaputten Scheiben durch Holzlatten oder Bretter zu ersetzen. Gerätschaften und Holz transportierte Philippine in einem Leiterwagen herbei, vor den sie Vraem spannte.
„Es ist mir unerklärlich wie du das alles mit deinem Bein zustande kriegst.“
„Was man gerne macht, ist ganz leicht!“, antwortete sie lächelnd.
„Nun gut! Wie aber erklärst du deiner Familie oder den Nachbarn diesen Aufwand? Werden sie nicht misstrauisch? Stellen sie nicht Fragen, wohin du damit willst?“ Er wies auf die Bretter.
„Was ich mag möchte ich schützen. Also fallen mir Erklärungen ein, die keine Zweifel zulassen.“ Sie lachte strahlend. Vielleicht war es dieses Lachen, vielleicht auch der Glanz in ihren Augen, das den jungen Mann bewog, sie zu bitten, künftig schon am Nachmittag zu kommen, um mehr Zeit mit einander verbringen zu können.
„Bist du auch ein Kind niederen Ranges, so schätze ich deine Gegenwart. Deine Gedanken sind reif, dein Herz ist kein Kinderherz mehr, und dein Verstand verblüfft. In den letzten Wochen habe ich dich beobachtet und studiert. Und ich habe beschlossen, dir meine Geschichte zu erzählen. Allerdings musst du mir ein weiteres Mal auf das Leben deines Pferdes schwören, niemandem davon zu berichten.“
„Immer und immer wieder schwöre ich Ihnen leichten Herzens, lieber Herr. Bis heute habe ich niemandem verraten, dass ich in diesem Landhaus Zuflucht gefunden habe. Nun werde ich es erst recht nicht tun. Es soll auf immer unser Geheimnis bleiben. Möge auch Gott niemandem verraten, dass wir hier sind.“
„Ob Gott uns gnädig ist, mag ich bezweifeln. Aber dir will ich glauben. Trotz deiner Jugend bist du unerhört klug!“ Wie zu Anfang forderte er sie auf, ins Innere zu treten und im Sessel Platz zu nehmen. Während sie es tat, schürte er die Glut und gab einige Holzscheite hinzu. Schließlich setzte er sich ihr gegenüber. Es war ein sonniger Spätnachmittag, der Abend ließ auf sich warten, doch aufgrund der abgedunkelten Fenster war der Raum schummrig. Das Feuer im Kamin wiederum erzeugte ein gemütliches Licht und die aufzuckenden Flammen gaben den Gesichtern der beiden jungen Menschen einen faszinierenden Schmelz. Philippine saß still und wartete ergeben. Sie hätte sogar die Augen niedergeschlagen, aber sie konnte seinem Anblick nicht widerstehen. Der Edelmann beugte sich ein wenig vor und sah dem Mädchen intensiv in die Augen.
„Du heißt Philippine, und ich nenne dich auch so. Ich heiße Maxence. Du darfst mich so nennen. Vergesse aber niemals die Anrede Monsieur. Nenne mich Monsieur Maxence, hast du verstanden? Bei allem Vertrauen, das ich dir entgegenbringe, bleibt doch stets der Rangunterschied. Du musst ihn respektieren. Verstehe mich nicht falsch: Ich bin ein Mann des Fortschritts, du wirst es anhand meiner Geschichte erfahren. Ich hasse den Absolutismus, verabscheue die Arroganz des Hofes, unter der das Land leidet. Gleichzeitig glaube ich an den Unterschied des Blutes. Ich bin von edlem Geblüt und du von gemeinem Blut.“
Erst jetzt senkte Philippine die Lider. Sie wusste, dass sie im Vergleich zu ihm ein Nichts war, aber konnten nicht Empfindungen, große Gefühle das alles wettmachen?
„Sieh mich an!“
Das Mädchen gehorchte.
„Du willst also meine Geschichte hören?“
Es nickte heftig.
„Schwöre mir zum dritten Mal, beim Leben deiner Mutter, deines Vaters, deiner Geschwister und deines Pferdes, niemandem zu verraten, was du nun von mir hörst.“
Zärtlich ruhten die großen Augen des Mädchens auf dem Gesicht des Edelmanns. Leise und fast etwas enttäuscht wiederholte es, was es schon mehrmals beteuert hatte.
An der Art, wie es zu ihm sprach und auch an ihrem zärtlichen Blick, musste der Mann erkennen, dass dem Mädchen viel an seiner Person lag. Dementsprechend war die Aussage zu deuten, mit der er zu erzählen begann:
„Wenn du mich verrätst, erwartet mich der sichere Tod.“
Philippine zuckte zusammen. Deutlich hob sich das kräftige Grün ihrer Augen von der blassen Haut ab.
„Vorläufig bin ich hier sicher. Niemand aus meinem Bekanntenkreis wird sich an dieses alte Landhaus erinnern. Es gehörte einem älteren Freund meines Vaters, der sich hier mit seiner jungen Maitresse traf. Bevor er starb, vermachte er es der Maitresse, die jedoch nach seinem Tod wahnsinnig wurde und auf ihrem Schloss vor sich hinvegetiert. Solange sie lebt, kümmert sich niemand um das Liebesnest und niemand verspürt Lust, in diesen einsamen Ort Geld zu investieren, um ihn wohnlich zu machen. Wir brauchen nichts zu befürchten, wenn du schweigsam bist.“
„Ich schwöre es!“, flüsterte Philippine aufs Höchste gespannt.
„Kennst du Frankreichs Geschichte?“
Das Mädchen nickte zaghaft und erwähnte einige Episoden, die sie bei Pfarrer Roumanet gelernt hatte. Allerdings traue sie seiner Interpretation nicht ganz. Sie sei voller Wut und Hass auf das Königshaus. Dabei müsse man den König ehren. Maxence lachte spöttisch.
„Nein! Diesen König darf man nicht ehren. Er ist so schwach wie sein Vorgänger und so vergnügungssüchtig wie einst der Sonnenkönig.“
„Aber der Sonnenkönig war ein starker Mann. Er hat Versailles gebaut.“
„Und unzählige Kriege geführt. Willst du solche Könige ehren? Der Bau von Versailles hat Unsummen verschlungen und das Volk ausgehungert. Alles Salz ging an den Hof, die Menschen auf dem Land mussten darauf verzichten und wurden bucklig.“
„Es braucht großen Mut, die Könige anzuzweifeln. Sie sind wie Gott. Wir können nicht gegen sie ankämpfen. Wir dürfen es auch nicht, wenn uns unser Leben lieb ist. Sonst müssen wir so schrecklich leiden wie Damien, der unseren Ludwig XV ermorden wollte.“
„Unfug! Unsinn! Dummheit!“, rief Monsieur Maxence und seine Wangen röteten sich. „Der König ist nicht wie Gott. Merke es dir ein für allemal! Unser jetziger König ist ein gutmütiger Mensch mit einem einfachen Verstand. Nicht dafür geschaffen, einem Reich mit all seinen Schwierigkeiten vorzustehen. Er und seine kindische, nichtsnutzige Königin müssen verschwinden.“ Ein wilder Ausdruck verhärtete Maxence’ Gesicht. Wieder zuckte Philippine erschrocken zusammen. Ihre Lippen formten das Wort König und sie wurde blass.
„Nettes, ahnungsloses Mädchen, das du bist, wach auf! Du und deinesgleichen werdet klein und dumm gehalten, damit ihr es ja nicht wagt, euch aufzubäumen. Siehst du denn nicht wie verschwenderisch sie in ihren Schlössern leben? Gold, Silber, schöne Kleider, gutes Essen in Hülle und Fülle, während ihr euer Brot einteilen müsst, wenn ihr überhaupt welches habt.“
„Das ist in der Natur der Dinge, weil wir einfach sind und der König göttlich.“
„Göttlich! Ha!“
Aufgebracht schoss er hoch. Sein Zeigefinger schnellte durch die Luft und leidenschaftlich fuhr er fort: „Was ist in der Natur der Dinge? Dass der Mensch sich nur durch Bildung vom anderen unterscheidet und nicht durch das Blut!“
„Aber Sie sagten zuvor, ich sei von gemeinem und Sie von edlem Blut!“, wagte Philippine hoffnungsvoll einzuwerfen.
„Das war anders gemeint, altkluges Mädchen! Und vermeide es, mich frech zu unterbrechen.“
Streng sah er sie an. „Edles Geblüt bezieht sich auf die edle, jahrhundertealte Erziehung, die meine Familie genossen hat. Deshalb ist unser Blut edel. Deshalb hat sich unser Verstand verfeinert und deshalb sehen wir auch feiner aus als das niedere Volk. Das gilt ebenso für den König. Auch wenn er im Gegensatz zu meinesgleichen ein lahmer, nichtsnutziger Esel ist. Ich habe die großen Denker unseres Jahrhunderts studiert. Louis studiert außer den erlesenen Speisen auf seiner Tafel nur Hirsche. Vor deinem Gott jedoch sind wir alle gleich, und vor dem Gesetz müssen wir alle gleich behandelt werden. Hast du das verstanden?“
Unsicher nickte Philippine.
„Und bevor ich dir meine persönliche Geschichte erzähle – die übrigens sehr kurz ist – werde ich dir die lange Geschichte aller Könige Frankreichs lehren und du wirst erkennen, dass diese Menschen keine Stellvertreter Gottes sind. Eher sind sie Stellvertreter des Teufels, man denke an einige unter ihnen wie François I., der seinem Volk hohe Steuern abpresste, um seine Favoriten und Maitressen mit Schätzen zu überschütten. In seinem Reich blühten Wucher, Korruption und Hass auf Andersdenkende. Dann gab es Henri II, der jeden Calvinisten aufhängen ließ. Was hältst du von Henri de Guise und Catharina de Medici, diesen heimtückischen Kreaturen? Getrieben von der Gier nach Macht, zerfressen vom Hass auf alle, die ihre Pläne durchkreuzten, schlachteten sie in einer Nacht allein in Paris 3000 Hugenotten ab. Und die Glocken der Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois läuteten das Massaker ein. Stell dir das Grauen bildhaft vor: Frauen und Kindern schlitzt man die Kehle auf, Tote füllen die Straßen, schwimmen in der Seine. Admiral Coligny, Anführer der Hugenotten, wird von Säbelstichen durchbohrt, aus dem Fenster geworfen, sein Körper niedergetrampelt, bevor man ihm den Kopf abschneidet und dem Königshaus schickt.“
Totenblass richtete sich nun Philippine auf. Sie bedeckte ihre Ohren mit den Händen.
„Bitte, Monsieur Maxence! Sagen Sie nicht so schreckliche Dinge. Sie machen mir richtig Angst.“
„Das soll es auch! Aber nach der Angst muss Wut, Zorn und geballte Kraft in dir wachsen, um diese Ungeheuer ein für alle Mal vom Thron zu stürzen. Deshalb erzähle ich dir die Schandtaten aller Potentaten. Deshalb, und damit du meine Geschichte besser verstehen kannst.“
Allmählich begriff Philippine, wovor der edle Herr auf der Flucht war. Ein eiskalter Schauder rieselte ihr vom Nacken aus den Rücken hinunter. Trotz der Bitte und ihrer großen Bestürzung fuhr Maxence wild gestikulierend in seiner Rede fort:
„Ja, durch Bildung unterscheiden sich die Menschen. Aus diesem Grunde muss jeder Mensch das Recht auf Bildung haben. Erst dann beginnt die Auslese, wer es zu Höherem bringt und wer nicht. Seit Jahrhunderten aber bestimmt das adlige Blut den Rang. Zwangsläufig wird das Volk von Kretins oder Bestien regiert, denn nicht immer ist adliges Blut auch edel.“
„Aber Monsieur Maxence. Ist der gemeine Mensch nicht schlimmer? Oft ist er wie ein Tier. Ich habe Angst vor ihm und wünsche mir am Hof leben zu dürfen. Unter schönen, gepflegten, ja auch gebildeten Menschen.“
„Der Hof wird täglich unwichtiger, lass es dir gesagt sein! Unter ihm bewegt sich der Boden. In ihm pulsiert wild das Blut des einfachen Mannes. Das Klopfen und Hämmern in den Adern der Erde wird so stark werden, dass der Thron zusammenbricht. Und ich ... ja ich, werde dazu beitragen, dieses morsche, korrupte Reich niederzubrennen. Und auf seiner Asche wird etwas Neues entstehen. Eine neue Form der Regierung, eine Gesetzgebung, die jeden Menschen gleich behandelt, eine Regelung, die Bedürftige beschützt. Die Republik! A bas la monarchie!“ Seine Faust sauste wie ein Säbel durch die Luft als wolle er sie durchschneiden. Dann plötzlich wurde es still. Durch die Schlitze der Stofffetzen an den Fenstern blitzte bläulich rosa ein letzter Tagesrest. Maxence bemerkte es beunruhigt, schöpfte neuen Atem und öffnete den Mund zum Sprechen. Bevor er jedoch ein weiteres Wort herausbrachte, fragte Philippine in die Stille hinein:
„Was ist eine Republik?“
Über ihre Frage erstaunt, blieb er einige Sekunden mit offenem Munde stehen und starrte sie an. Dann streifte sein Blick den Schlitz im Vorhang. Es war fast dunkel.
„Das erkläre ich dir morgen. Ich will dir alles beibringen, was dir hilft, unsere Welt, unsere Gesellschaft zu verstehen! Aber nun musst du rasch zurück reiten. In wenigen Minuten ist es Nacht.“