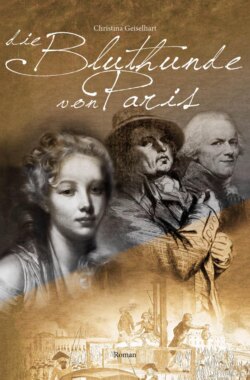Читать книгу Die Bluthunde von Paris - Christina Geiselhart - Страница 8
4. Kapitel
ОглавлениеVier Jahre später. 1786
An einem Abend im März brach Karl Sanson, der Verhörvollstrecker, beim Abendessen am Tisch zusammen. Sein Kopf schlug auf den Tonteller, aus dem die Suppe spritzte, schwer fielen die Arme rechts und links am Körper herab und ein fürchterliches Ächzen erschütterte seine Brust. Bestürzt schnellte Lea von ihrem Stuhl hoch und beugte sich über ihn. „Was ist mit dir, Karl?“, schrie sie gellend. Karl rührte sich nicht und Panik ergriff Lea. Scharf befahl sie Frieda, ihr zu helfen, den Ohnmächtigen zum Bett zu schleppen und bat Philippine in milderem Ton, einen Arzt zu holen.
Das Mädchen rannte in den Schuppen und verlangte von ihrem Pferd das, was ihm Albano beigebracht hatte und was das Mädchen mittlerweile beherrschte: Es schlug sanft gegen seine Vorderhufe, damit es in die Knie ging und Philippine aufsteigen konnte. In Windeseile jagte sie in den Ortskern von Saint-Ouen, wo der Arzt wohnte. Er war ein guter Freund des Verhörvollstreckers, weil dieser ihm zahlreiche Kunden zukommen ließ, deshalb trödelte er auch nicht, sondern sattelte seinen alten Klepper und ritt sogleich mit dem Mädchen zurück. Während Philippine in den Stall ging und sich um Vraem kümmerte, trat der Arzt ins Haus. Karl hatte sich mittlerweile etwas erholt. Ruhig ließ er des Doktors Untersuchungen über sich ergehen.
„Es muss wohl eine Herzattacke gewesen sein!“, diagnostizierte der Mediziner. „Es klopft unregelmäßig und die Atmung ist hektisch.“
„Wie bekommt man so eine Attacke?“
„Er arbeitet zu viel. Ist angestrengt, leidet unter seiner Tätigkeit. Vielleicht gehen ihm die wimmernden Opfer zu sehr zu Herzen.“
Bleich und mit zitternden Händen streichelte Lea den Kopf ihres Mannes. „Kann es auch von etwas anderem kommen?“, bei diesen Worten bugsierte sie den Arzt aus der Schlafkammer.
„Man kann ein Herz auch durch üble Nahrung lahm legen. Hast du ihm etwa ein wenig Säure in die Suppe gekippt, damit du mehr Freiheiten genießen kannst?“ Kaum waren sie allein, klopfte er der jungen Frau dreist auf den Hintern. Wütend stieß sie seine Hand weg. Ungern erinnerte sie sich daran, dass sie es auch mit ihm schon mehrmals getrieben hatte. Einmal im Schuppen wo nun Vraem stand. Ein andermal an den Ufern der Seine und ein drittes Mal bei ihm zu Hause, während seine Frau in der Apotheke Rezepte mischte. Das Feuer in ihrem Hintern war nicht zu löschen und je öfter sie es trieb, um so mehr gelüstete sie danach. Seitdem sie nach einer verpfuschten Abtreibung durch eine Engelmacherin unfruchtbar geworden war, betrachtete sie ihren Schoß nur noch als Lustquelle.
„Nimm’s mir nicht übel, Lea! Ich würde dich niemals verdächtigen, deinen Alten abmurksen zu wollen. Er taugt zwar im Bett nicht, aber er bringt Geld. Denn Geld lässt sich nicht so leicht beschaffen, auch nicht mit solch einem saftigen Hintern wie dem deinen!“
Blitzschnell fasste er unter ihren Rock. Angewidert stieß ihm Lea ihr Knie in die Hoden. Er schrie gepeinigt auf.
„Du Luder!“ Er ohrfeigte sie. „Sei froh, dass ich deinen Alten nicht von deinem Lotterleben erzähle. Er würde geradewegs ins Grab sinken, vor Scham, mit solch einer Hure verheiratet zu sein.“
„Ich bin keine Hure!“ Sie spuckte ihm ins Gesicht. „Merk dir ein für allemal, dass dir mein Körper nicht mehr zur Verfügung steht. Ich bin sehr wählerisch geworden.“
Bedächtig wischte sich der Arzt den Speichel von der Wange, dann verzog er seinen Mund zu einem breiten Grinsen, aus dem im nächsten Moment ein höhnisches Wiehern dröhnte.
„Wählerisch! So weit ich informiert bin, hat sich halb Saint-Ouen an deinem Hintern gütlich getan. Das ist nicht sehr wählerisch.“
„Meistens waren es junge, ansehnliche Männer und nicht solch grobschlächtige Kerle wie du.“
„Ach, geh zum Teufel, dummes Weibsstück!“ Er wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um. „Gib deinem Mann, dem armen Kerl, keinen Alkohol, lass ihn Milch und Suppe trinken, aber misch kein Hexenkraut darunter und koche das Trinkwasser gut ab. Schick mir morgen Philippine. Ich werde eine Medizin brauen lassen, die ihn wieder auf die Beine bringt.“
Schnell duckte sich Philippine hinter das hohe Fass, das neben dem Eingang stand, damit der Arzt sie nicht sehen sollte. Sie war vom Geschrei der beiden angelockt worden und hatte, in der Annahme, es ginge um den Zustand ihres Vaters, ins Haus gehen wollen. Im letzten Moment hielt sie inne und wurde dabei unfreiwillig Zeugin der derben Unterhaltung. Nicht zum ersten Mal erlebte und hörte sie Dinge, die die dunklen Seiten ihrer Mutter ans Licht zerrten. Bis heute hatte sie nichts davon geglaubt. Lästermäuler sind es, die meine Mutter schlecht machen wollen. Böse Zungen, die ihr die Schönheit neideten. Weit und breit gibt es keine Frau, die mit dreiunddreißig Jahren und nach sechs Geburten noch so blüht. So dachte Philippine bisher. Heute jedoch fiel der Zweifel auf fruchtbaren Boden. Er fing an zu keimen.
Philippine wartete eine Weile, bevor sie ins Haus trat. Der Raum war leer. Jedenfalls sah es zunächst so aus. Doch da entdeckte sie Frieda. Verborgen kauerte sie in einem Winkel des Zimmers und zitterte.
„Was ist mit dir, Schwester? Warum zitterst du am ganzen Leib?“
„Ich habe Angst!“, stotterte die Ältere. Ihre Zähne schlugen gegeneinander, ihre Lippen zuckten und aus aufgerissenen Augen starrte sie die jüngere Schwester an.
„Ist es wegen Vater? Hast du Angst um sein Leben?“
Mit versteinertem Gesicht nickte Frieda. Beruhigend streichelte Philippine über Friedas Haar und sagte:
„Die Medizin wird ihm helfen. Bald ist er wieder gesund.“
Da schüttelte Frieda den Kopf. Unaufhörlich schüttelte sie ihn, immer heftiger und wilder als machte er sich selbstständig, als wollte er sich von ihrem Körper lösen. Dabei stieß sie zerrissene Sätze aus.
„Wir müssen uns ... in Acht nehmen! Vater ... Alberta ...!“
„Alberta? Was ist mit Alberta?“
„Spazieren! Spazieren!“ Frieda wiegte den Kopf hin und her wie eine Schwachsinnige. Besorgt kniete sich Philippine neben sie, rüttelte sie und fragte, wo sie Alberta gesehen habe.
„Im Wald, im Wald. Das Moor ...!“
Philippine standen die Haare zu Berge.
„Sie ist bis zum Moor gegangen?“
„Nein, nein ... nur bis zum Weiher!“
„Oh, der ist an manchen Stellen tückisch. War sie allein?“
Frieda schüttelte den Kopf. Dann wurde sie mit einem Mal kreidebleich. Schritte waren zu hören. Zitternd duckte sie sich tiefer in den Winkel, während die Jüngere rasch zur Tür humpelte und so tat, als sei sie eben eingetreten.
„Wie geht es Vater?“, rief sie der entgegenkommenden Mutter zu.
„Er ist bei Besinnung!“, antwortete Lea nervös. „Kümmere dich um ihn. Ich laufe kurz auf den Markt und hole Fleisch, damit er wieder zu Kräften kommt.“
„Fleisch!“, wiederholte Philippine leise für sich. „Woher nimmt sie nur immer das Geld dafür?“ Fragend sah sie ihr nach. Indessen war Frieda aus ihrem Winkel gekrochen.
„Ich weiß es, aber ich darf es dir nicht sagen.“
Heftig drehte sich Philippine zu Frieda um. Aus panisch geweiteten Augen sah die Ältere auf die Jüngere. Um die verängstigte Schwester nicht noch mehr zu verschrecken, sagte sie ruhig:
„Wenn es dir solche Angst macht, es mir zu verraten, dann behalte es eben für dich. Aber sage mir dann, mit wem Alberta zum Weiher gegangen?“
„Niemals!“, schrie Frieda. „Niemals!“, wiederholte sie angstgelähmt. „Frage mich nie mehr danach, wenn dir mein Leben lieb ist!“, stieß sie heftig hervor und stürzte davon.
*
Auf dem Weg zum Markt kam Lea am Pfarrhaus vorbei. Sie hatte es vor gut einem Jahr zum ersten Mal betreten. Unwillkürlich blieb sie stehen und starrte auf die schiefe Haustür. Damals wollte sie wissen, ob Pfarrer Roumanet etwas für sie tun könne. Es sei lebenswichtig.
„Alles was dem Leben dient, soll auch mein Dienst sein!“, hatte der schmalbrüstige Gottesmann geantwortet.
„Dann lehrt meiner Tochter Lesen und Schreiben und sorgt dafür, dass ihr verkrüppelter Fuß seine natürliche Form zurückbekommt. Dein Gott hat meinem Kind ein schönes Gesicht, aber einen hässlichen Fuß in die Wiege gelegt. Das nehme ich nicht hin. Ich will Mittel und Wege kennen, diese grässliche Entstellung aus der Welt zu schaffen und wenn ich dabei den Teufel herausfordern muss.“ Wie es ihre Gewohnheit war, hatte Lea die Hände in die Hüften gestemmt und dabei ihre Brüste zur Geltung gebracht. Pfarrer Roumanet hatte zunächst verwirrt reagiert und war zurückgewichen. Bald jedoch hatte er sich gefangen und gesagt:
„Schick mir deine Tochter zum Unterricht. Was ihre Entstellung angeht werde ich mich kundig machen.“
Eilig hatte er sich daraufhin entfernt und Lea war unzufrieden gegangen. Seit dieser Zeit lernte Philippine bei ihm Lesen und Schreiben. Für ihren Fuß jedoch hatte er bis heute nichts getan.
„Ich sollte ihm in seinen knochigen Hintern treten, damit er merkt mit wem er es zu tun hat.“ Sie spuckte aus und ging weiter in Richtung Markt.
„Nicht jetzt, du verschwitzter stinkender Gottesmann. Aber bald! Sehr bald werde ich kommen und dich gesalzen an dein Versprechen erinnern. So leicht wird man Lea nicht los!“
Lea kaufte einen Kalbskopf, Lebertran, Mehl und Eier. Den Einkauf verstaute sie in ihrem Korb, den sie sich auf den Rücken schnallte. Dann strebte sie durch das Gewirr der Händler und Marktschreier auf eine enge Gasse zu. Vor einem schiefen unwirtlichen Gebäude mit schmutziger Fassade hielt sie an. Sie stieß die Haustür zurück und stieg eine abgewetzte Treppe hinauf. Das Geräusch ihrer Schritte verscheuchte eine fette Ratte, die zwischen Leas Füßen ins Freie witschte.
Merlen – seit zwei Wochen ihr Liebhaber und Komplize – wohnte direkt unterm Dach in einer miserablen Mansarde. Wie Lea träumte er von einer rosigen Zukunft. Da er faul war, weder lesen und schreiben konnte, noch sonst eine Arbeit zufriedenstellend verrichtete, hatte er sich auf das älteste Gewerbe der Welt spezialisiert. Anfangs hatte er sich Provinzmädchen gehalten, die anschafften. Das eingenomme Geld frischte seinen Verdienst als Knecht eines Hufschmieds ein wenig auf, reichte allerdings nicht aus, die Arbeit beim Hufschmied aufzugeben. Erst mit Lea fing das Geschäft an zu blühen. Lea wusste worauf es ankam. Lea hatte das Gespür für Feinheiten und sie lehrte ihn den Unterschied von Quantität und Qualität zu bedenken. „Zwei gute, wollüstige Weiber bringen dir mehr ein, als vier, die nur die Beine spreizen!“, hatte sie erklärt und Merlen glaubte ihr. Wieso hätte er an ihren Worten zweifeln sollen, war sie doch selbst der beste Beweis dieser Aussage?
„Bevor wir vom Geschäft reden, wollen wir es miteinander treiben. Hätte ich dich, nachdem Albano uns verlassen hatte, nicht ausfindig gemacht, würde ich eingehen. Ich brauche den täglichen Ritt wie die Blume das Wasser, mein Hengst. Denke schon seit Stunden an nichst anderes.“ Während sie redete, knöpfte sie ihre Bluse auf und streifte sie ab. Sie gab Merlen, der bei ihrem Eintreten von seinem Bett aufgesprungen war, einen kräftigen Schubs, so dass er zurück in die Laken fiel. Im Handrumdrehen hatte sie seine Hose geöffnet und ihren Rock geschürzt.
Eine halbe Stunde später lagen sie ermattet und schweißgebadet auf dem Rücken.
„Ich sage es dir noch einmal: Meine dumme, feiste Tochter wird unsere Kassen füllen. Ich schwöre es! Aber dazu brauch ich dich, mein Junge. Du musst ihren Hintern arbeitsfähig machen. Noch ist er nichts weiter als ein breiter Hintern, den sie nutzlos durch die Gegend schiebt.“ Lea lachte hämisch.
„Einfach wird das nicht sein. Ich habe deine Frieda einmal gesehen und nichts Aufreizendes an ihr gefunden. Sie ist eher abstoßend!“
„Du wagst es?“ Lea richtete sich ein wenig auf und drohte ihm mit der Faust. Merlen packte das Handgelenk der Frau, sah sie entschuldigend an und flüsterte:
„Wer ein Weib wie dich gekannt hat, wird wählerisch!“ Er zwinkerte. Leas Arm sank aufs Bett zurück. „Dennoch muss ich dich warnen. Das Mädchen hat ein dämliches Gesicht und dieses grässliche Muttermal auf der Wange. Wie willst du mit dieser Kreatur deine Kassen füllen? An ihr werden nur Hungerleider Geschmack finden. Arme Schweine, die nichts Besseres bekommen können. Das ist nicht unser Ziel.“ Verwegen blickte er sie an. Durch Lea ging ein Ruck. Sie stand auf, stellte sich in ihrer ganzen Nacktheit vor ihm auf und stemmte die Hände in die Hüften.
„Ich habe dich für klüger gehalten. Aber du scheinst ein Schwachkopf zu sein, nicht halb so klug wie das Eisen, das du schmiedest.“ Verächtlich spuckte sie vor ihm aus. „Was geht dich ihr dämliches Gesicht an? Was geht euch Mannsbilder überhaupt das Gesicht an, wenn ihr nichts weiter wollt als einen guten Ritt. Glotzt du einem Pferd ins Gesicht? Einer Kuh in die Augen oder einer Ziege auf ihre geschwungenen Lippen? Frieda hat prächtige Schenkel, feste Brüste und einen jungfräulichen, hungrigen Schoß, der darauf wartet, gemästet zu werden. Und zwar von dir, du Gimpel, weil du – so dumm du auch sonst sein magst – auf dem Gebiet deine Sache gut machst. Jeder andere würde sich auf mein Angebot stürzen, aber ich will dich. Statt ihren Schoß zu Schanden zu reiten wirst du ihn gierig machen! Genau das brauchen wir. Stimme du ihren Körper ein, während ich ihr Hirn einstimme und höre auf zu Jammern. Ich habe Frieda erklärt, dies sei ein Gewerbe wie jedes andere. Leider stellt sie sich verdammt moralisch an. Glaubt an Liebe, glaubt an einen sanften Mann, der sie befruchtet und sie dann mit auf sein Schloss nimmt. Ha, dass ich nicht lache. Alles Firlefanz! Die Menschen sind verdorben. Sie kennen nur ihren eigenen Nutzen und trampeln über dich hinweg, wenn du ihnen im Weg bist. Du musst es ihnen gleich tun, sonst überlebst du nicht. Ich weiß, wovon ich rede.“
Sie richtete sich auf und sah ihn böse an. Eingeschüchtert durch ihren Blick und den strengen Ausdruck ihres Gesichtes gab er nach.
„Gut! Ich tue was du verlangst. Aber ich bestehe auf deine Anwesenheit. Ich bestehe darauf, deinen nackten Körper anstarren zu dürfen. So wie jetzt. Das bringt mich auf Touren.“
„Oh, das klingt aufregend. Sehr aufregend.“
*
Am Abend saßen sie vereint beim Essen um den Tisch. Lea, Philippine, Frieda und Karl. Es ging ihm besser, aber das Essen wollte ihm noch nicht so recht schmecken. Nachdem er eine Weile lustlos und mit gesenktem Kopf vor sich hingekaut hatte, sah er irritiert vom Teller auf, ließ seinen trüben Blick schweifen und fragte gelangweilt, wo denn Alberta sei. Philippine antwortete, sie habe einen Spaziergang zum Weiher gemacht und wundere sich, dass sie um diese Zeit noch nicht zurück sei.
Während sie es sagte, beobachtete sie aufmerksam die ältere Schwester. Diese wagte sich kaum zu rühren, schob apathisch das Essen in den Mund und sah dabei ängstlich um sich. Philippine blickte zur Mutter. Die hingegen zeigte keine Sorge, sie war die Ruhe selbst. Gelassen schöpfte sie vom Bohneneintopf und servierte es ihrer Lieblingstochter.
„Alberta ist fünfzehn, Frieda fast siebzehn. Beide sind erwachsen. Ich war jünger, als ich heiratete. Wovor fürchtet ihr euch? Dass dem Mädchen ein Bursche aus der Gegend nachgestellt hat und sie vielleicht dort unten verführt.“
„Könnte sein!“, brummte Karl. „Es ist spät und mir wäre es nicht recht, läge sie mit einem Kerl im Gras am Weiher.“
„Es sollte dir besser recht sein, damit sie weiß, was die Stunde geschlagen hat, wenn sie mal heiratet.“
Diesmal ließ sich Philippine vom Gerede der Mutter nicht beeindrucken. Sie misstraute ihr und machte sich ernsthaft Sorgen. In den Wäldern hausten Räuber, die nachts aus ihren Löchern krochen und ihr Unwesen trieben. Und im Moor konnte man verschwinden. Andererseits hatte Frieda gesagt, Alberta sei nicht alleine. Vielleicht war der schüchterne Nachbarsbursche mit ihr gegangen, der sie schon seit einiger Zeit aus der Ferne anhimmelte. Und doch!
„Alberta ist nie so lange weggeblieben! Es ist beunruhigend. Wir sollten nach ihr suchen!“, sagte sie sehr ernst. Lächelnd ging Lea um den Tisch, neigte sich zu ihrer Lieblingstochter und beschwichtigte sie:
„Mach dir bitte keine Sorgen, mein Kind! Du wirst sehen, morgen ist sie wieder bei uns.“
Bei diesen Worten erstarrte Frieda. Erstaunt nahm Philippine den namenlosen Schrecken in Friedas Gesicht wahr, der sich dort gespenstisch abzeichnete. Philippine hatte den Eindruck, aus der älteren Schwester entweiche jegliche Wärme und breite sich eisige Kälte in ihr aus. Ein Schauder ergriff die Jüngere.
*
Lea hatte Friedas Furcht bemerkt. Die Mutter wusste, dass Frieda herum schnüffelte, dass sie gerne ihre Nase in Dinge steckte, die sie nichts angingen. Der beste Weg, das hirnlose Geschöpf davon abzuhalten, Dummheiten auszuplaudern oder Gerüchte zu verbreiten, die ihrer morbiden Phantasie entspringen, ist, sie gefügig zu machen, dachte Lea zornmütig. Und so füllte sie die kommenden Tage mit Erlebnissen, die Frieda aufwühlen und Albertas Verschwinden verdrängen sollten.
Ihr erster Schritt war ein Besuch in der Dachkammer von Saint-Ouen. Während Philippine auf ihrer Stute durch die Wälder von Saint-Ouen streifte und nach Alberta rief, wurde Frieda dem Hufschmid vorgestellt. Gelangweilt taxierte Merlen das Mädchen und wiederholte, was er schon gesagt hatte.
„Sie reizt mich nicht.“
Lea schlug ihm ins Gesicht. Merlen zuckte und rieb sich die Wange.
„Halt’s Maul und glotze, statt zu blöken! Sieh dir an, was sie zu bieten hat!“, herrschte Lea ihn an. Dann begann sie, die Tochter auszuziehen. Langsam und genüsslich. Sie nahm ihr die Haube ab, schnürte das Kleid auf, enthakte die Korsage und streifte sie bis zur Hüfte, sodass Frieda mit blankem Busen dastand. Merlens Augen blitzten:
„Die Brüste sind appetitlich. Zum Anbeißen. Wenn nur das Gesicht nicht wäre!“
„Gimpel!“ Lea schlug ihm mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. „Was habe ich dich gelehrt? Nun, was denn? Antworte!“ Sie stieß ihn nach hinten. Er wehrte sich nicht, sah sie nur flammend an. Ihr zorniges Auftreten schien ihm zu gefallen.
„Ja, ja! Ist schon gut. Ich weiß es: Das Gesicht ist unwichtig.“
„Richtig, guter Junge. Nur das hier zählt!“ Sie riss Frieda die restlichen Kleider vom Leib. Merlen fielen die Augen aus dem dummen Kopf.
„Wahrlich, wahrlich, sie hat satte Schenkel!“, lallte er.
„Ganz zu schweigen von dem Nest dazwischen.“
Sie ergriff Merlens Hand und raunte: „Mach es satt und schlüpfrig mit deinen rauen Fingern.“
Als Frieda die Männerhand auf ihren Beinen spürte, wich sie ängstlich zurück. Ihre Reaktion missfiel der Mutter außerordentlich. Mit eisiger Stimme zischte sie die Tochter an:
„Und du wirst gehorchen, Kindchen! Wehe, du kommst dem lieben Merlen nicht entgegen. Ich schlage dich vor seinen Augen windelweich. Ich prügele deinen Hintern bis er glüht und ritzrot wird.“
„Ich ... ich ... will tun, was ... ihr von mir ... verlangt!“, stotterte das Mädchen und sein Körper versteifte sich, seine Haare stellten sich auf. Merlens Hand wanderte an Friedas Beinen hinauf und versuchte ihre Schenkel auseinander zu drängen. Sie klemmte sie fest zusammen.
„Was soll ich mit diesem Brett?“, schimpfte Merlen. „Die bringt keinen Sous ein.“
Wütend schubste ihn Lea beiseite. Sie gab Frieda zwei kräftige Ohrfeigen. „Und nun öffne dich, mein Kindchen. Öffne dein Türchen, sonst geht es dir schlecht. Wenn du tust, was Mutter sagt, wird es dir gut gehen. Sehr gut sogar!“
Frieda gehorchte. Furchtsam gab sie sich Merlens Hand hin. Seine groben Finger glitten über ihren Hals zu den Brüsten über den Bauch, wanderten über ihren Hintern zwischen ihre Schenkel. Indessen beugte sich Lea zu ihrem Ohr und zischte hinein:
„Es ist gut für dich zu wissen, wer deine Mutter wirklich ist!“ Leas Zunge bohrte sich in die Ohrmuschel. Das Mädchen erschauderte. „Sie ist keine Hure im üblichen Sinn. Sie ist ein Vollblutweib, das mit seinem Schoß denkt. Auch du wirst es lernen und du wirst erfahren, wie gut es dir dabei geht.“ Als sie das Wort Schoß aussprach, streichelt Merlens Hand Friedas Schamlippen. Es dauerte nicht lange, da entspannte sich das Mädchen. Langsam bewegte sich Merlens Finger in ihr. Sie ließ es geschehen, schien Gefallen daran zu finden. In ihrem Gesicht spiegelte sich keine Angst mehr. Sie wankte, fing an heftiger zu atmen. Als Merlen es bemerkte, zog er seinen Finger zurück und flüsterte:
„So gefällst du mir und so wirst du allen Kerlen gefallen! Komm! Leg dich neben uns. Schau zu, wie ich es mit deiner Mutter treibe. Dann siehst du, welchen Spaß wir haben. Ja, ja, Frieda. Noch haben wir kein Geld, aber wir haben Mordsspaß.“
Etwas ängstlich willigte Frieda ein. Auf schwachen Knien ging sie zum Bett und betrachtete mit wachsender Neugierde das wilde Spiel, das Merlen und Lea bis zur Trunkenheit spielten. Noch nicht ganz gesättigt ließ er von Lea ab und wandte sich Frieda zu.
„Komm, Vögelchen. Leg dich hin und mach’s wie deine Mutter.“
Frieda gehorchte. Jetzt vibrierte sie vor Erwartung auf diese erste geheimnisvolle Begegnung. Ihre Schenkel öffneten sich. Merlens Gesicht jedoch verzog sich zu einer Fratze der Lust, die Gier verbrannte ihn fast. Er war aufs äußerste gereizt und legte alle Behutsamkeit ab. Unter seinen Stößen schrie Frieda vor Schmerz auf und immer wieder wimmerte sie, er möge aufhören. Aber ihr Gewinsel erregte ihn umso mehr und Leas anspornende Ausrufe brachten ihn gänzlich um den Verstand.
Vergnügt sah die Hurenmutter zu. Die Schmerzen ihrer Tochter, deren verzerrtes, verzweifeltes Gesicht berauschten sie, all das kam ihr bekannt vor, sie hatte es vor langer Zeit gesehen. Im Spiegel der Angst. Damals war es ihr Gesicht. Damals hatte sie darunter gelitten. Heute empfand sie Lust.
*
Alberta tauchte nicht auf. Warum geht Mutter so leichtsinnig damit um?, fragte sich Philippine. Es ist doch ihr Kind?
„Sie wird bei irgendeinem Kerl sein!“, beruhigte Lea die Familie am dritten Abend nach Albertas Verschwinden.
„Das darf sie nicht, zum Teufel! Sie ist noch ein Kind!“
„Halt’s Maul Karl! Ich war sechzehn, als du wie ein Schwein über mich hergefallen bist. Hast du eine Sekunde darüber nachgedacht, wie jung ich damals war?“
Der Verhörvollstrecker brummte in seinen Bart. Er schob den Teller mit Suppe von sich und stand auf.
„Hab keinen Hunger. Irgendetwas verdirbt mir den Appetit.“
„Bevor ich morgen zum Unterricht unseres Pfarrers gehe, melde ich es dem königlichen Aufseher des Ortes Saint-Ouen. Er kann mit seinen Hunden die Gegend durchstreifen.“
„Vergebliche Liebesmüh, Philippine!“ Ein Messer in der Hand, um den Laib Brot zu schneiden, den Frieda aufgetragen hatte, stellte sich die Mutter provozierend am Kopf des Tisches auf und blickte ihre Tochter streng an. „Glaubst du im Ernst dieses Pack von Ausseher sorge sich um die entlaufene Tochter des Folterers? Sie werden dich davonjagen!“ Ihr scharfer Blick schoss von Philippine zur ältesten Tochter. Diese duckte sich und seufzte leise. „Was gibt es da zu seufzen?“, zischte Lea.
Mit einem Male herrschte eine bleierne Stille im Raum. Karl war zur Tür gegangen und hielt plötzlich inne. Langsam drehte er sich um. Zu langsam, als dass es mit seinem schwerfälligen Körper hätte zu tun haben können. Es war Drohung in seiner zeitlupenhaften Bewegung. Drohung, Zorn und Hass.
„Darf man nicht mehr seufzen, wenn die Tochter verschwunden ist, was?“ Er hob die Faust, rührte sich hingegen nicht von der Stelle. Sein verzerrtes Gesicht sah furchterregend aus. „Du elendes Weib hast keinen Funken Mitleid mit dem armen Ding. Schuldig solltest du dich fühlen, ein hässliches Geschöpf geboren zu haben. Aus deinem dreckigen Schoß ist es geschlüpft und ich wette meinen Schädel, der vielleicht nicht viel wert ist, dass es dein schlammiger Schoß so unansehnlich gemacht hat.“
„Schwätzer! Philippine ist dem gleichen Schoß entsprungen und ist schön wie der Morgen!“
„Aber sie hat einen Pferdefuß, dummes Weib. Dein Unterleib ist ein Sündenloch, aus dem keiner ungeschoren herauskommt und es ist besser für mich, deinen Teufesleib zu meiden.“
„Da tust du gut daran!“ Lea hatte noch immer das Messer in der Hand. Seine Schneide blitzte, ihre Hand spannte sich um den Griff. Geräuschvoll stand Philippine auf. Ihre Augen funkelten von Tränen und Zorn.
„Hört auf zu streiten! Habt ihr Alberta ganz vergessen? Es geht um meine Schwester und nicht um euch.“
„Du hast Recht!“ Karl lehnte sich gegen die Holzwand neben der Tür. Er wirkte krank, hatte eine grünliche Gesichtsfarbe und Schweiß auf der Stirn. Mit dem schmutzigen Ärmel seines Hemdes wischte er sich über die Augen.
„Hieß es nicht, sie sei nicht alleine gegangen? Wer war bei ihr?“ Ohne aufzusehen, wartete er auf Antwort. Philippine humpelte um den Tisch herum zu Friedas Platz. Diese hatte Blick und Kopf gesenkt und zitterte.
„Du hast doch jemand gesehen, Frieda. Warum willst du nicht sagen, wer es war?“ Philippine berührte ihre Schulter. Als habe sie sich verbrannt, zuckte Frieda vor der Hand zurück. Schüttelte sie ab wie ein ekliges Insekt.
„Ach! Du hast jemand gesehen, Frieda?“, fragte Lea. Ganz plötzlich hatte ihre Stimme einen besorgten, mitfühlenden Klang. „Schau mich an, mein Kind, wenn ich mit dir rede!“
Vorsichtig hob Frieda das Gesicht. Ihr Blick streifte die Schwester, den Vater und glitt schließlich zur Mutter. Dort blieb er hängen. Dort klebte er fest, als suche er Halt. Als suche er Hilfe und Antwort.
„Nun, antworte, mein Kind! Wen hast du gesehen?“
Philippine beobachtete gespannt den Blickwechsel von Mutter und Tochter. Was spielt sich in den beiden Köpfen ab, schien sie sich zu fragen. Erst jetzt sah auch Karl auf. Er hatte weder von Friedas nervösem Zucken noch vom Blickaustausch der beiden Frauen etwas bemerkt. Deshalb sagte er ungeduldig: „Los, los! Zier dich nicht so lange. Ich hab viel Arbeit und wenig Zeit, mich mit eurem Kram zu befassen. Mit wem ist sie losgezogen?“
„Nun mach schon den Mund auf! Mit wem ist sie losgezogen, zum Teufel!“, wiederholte Lea eindringlich und genauso ungeduldig wie ihr Mann, mit dem Unterschied, dass Karl sichtlich die Lust verlor, während Leas flammender Blick das Mädchen Frieda zu verbrennen drohte.
„Es war ... es war ...“, begann sie stockend.
„Wer?“ Philippine legte wieder ihre Hand auf die Schulter der Schwester. Wieder schüttelte diese sie erschrocken ab.
„Der Nachbarsjunge!“, schoss es plötzlich aus ihrem Mund. „Ja, der Nachbarsjunge. Sie gingen gemeinsam in den Wald hinein und seitdem hat sie keiner mehr gesehen!“, fuhr sie ungewöhnlich rasch fort. Ungläubig starrte Philippine auf ihre Schwester, die gehetzt zu sein schien, außer Atem, deren Herzschlag am Hals zu sehen war, so sehr pochte es.
„Und der Junge? Ist er bis heute auch nicht heimgekehrt?“
„Was weiß ich?“ Frieda war gereizt. „Hab ich vielleicht auch noch beobachtet, ob sie gemeinsam zurückgekommen sind? Ich kann ja nicht alles wissen. Lasst mich in Ruhe!“ Sie machte Anstalten aufzustehen, aber der Blick ihrer Mutter fesselte sie an den Stuhl. Besorgt sagte diese:
„Iss jetzt deine Suppe. Du siehst ja ganz grün aus, mein Kind!“
Den Bruchteil einer Sekunde flackerte Misstrauen in Karls Augen. Doch dann wandte er sich unwirsch ab. Vor sich hinnuschelnd stieß er die Tür auf. Ehe er hinausging, drehte er sich um und zischte: „Ach, leckt mich doch alle am Arsch!“
Philippine gab sich nicht so leicht zufrieden. Unter gesenkten Lidern wanderte ihr Blick von der Mutter zu Frieda. Irgendwas stimmt da nicht!, dachte sie. Aber ich werde schon dahinter kommen.
*
Erstaunlich schnell war die kleine Frieda geschäftsfähig. Schon nach zweiwöchigem Einreiten konnte sie gewinnbringend eingesetzt werden. Lea hatte das richtige Gespür für das arme, reizlose Geschöpf.
Außer ihrem Körper besaß sie nichts, aus dem sie Kapital schlagen konnte. Was jedoch entscheidend Friedas Entwicklung zur Hure beeinflusste, war die Hoffnung, durch ihren Körper endlich Anerkennung, ja sogar ein wenig Liebe zu bekommen. Genau das hatte Lea erkannt und Merlen angewiesen, Frieda Lust zu verschaffen, ihr das Gefühl zu geben, geliebt und begehrt zu werden. Ihr einzureden, sie könne mit ihrem Körper Männer verrückt machen, bis sie vor ihr katzbuckelten und ihr Reichtümer versprachen. Sobald Frieda an sich zweifelte, weil sie im Spiegel, den Lea für teures Geld erstanden hatte, zu lange auf ihr Muttermal, die platte Nase und den tiefen Haaransatz, der ihr etwas Finsteres verlieh, starrte, wischte Lea alle Unsicherheiten mit großartigen Worten hinweg: „Nicht alle Verführerinnen waren schön. Manche waren sogar potthässlich und konnten sich dennoch vor Liebhabern und Anwärtern nicht retten. Warum? Weil sie wussten, wie man Mannsbilder ankettet. Weil sie es verstanden, die Kerle zu Boden zu zwingen, sie gierig zu machen bis sie sabberten. Wir leben in einer Zeit, in der lüsterne Frauen rar sind. Mache es dir zunutze und die Kerle werden dich nicht nur begehren. Sie werden dich auch lieben.“
Friedas Herz schlug höher. Es war das, was sie suchte. Arme, in die sie sich schmiegen konnte. Hände, die sie liebevoll streichelten, ein Mund, der sie küsste und sagte: Du bist die Schönste. So war Merlen! Dass er im Auftrag ihrer Mutter handelte, wusste sie nicht und wollte sie auch nicht wissen. Merlen war jung, gut gebaut, hatte wuscheliges Haar und es erfüllte sie mit Glück, wenn er ihr ins Ohr raunte: „Frieda, du bist wunderbar. Du bist die Schönste, die Heißeste, ein Kleinod unter den Frauen. Mit dir werden wir reich.“
Und Frieda wurde zunehmend lüstern. Ihre Hemmungslosigkeit und Freude am ältesten Gewerbe der Welt sprach sich rasch herum. Sämtliche Hufschmiede der näheren und später weiteren Umgebung stellten sich in Merlens Dachkammer ein, wo Frieda die Männer mit Raffinessen empfing. Ihr Können und Einfallsreichtum lockten bald auch wohlhabende Mannsbilder an.
Für besondere Kunden wurde Frieda vor der Verabredung in einen Zuber getaucht und gründlich gewaschen. Dann überschminkte Lea den dunklen Fleck im Gesicht der Tochter mit weißem Puder, wellte ihr Haar, drapierte um ihren Körper die feinen Stoffe, aus denen sie später Philippines Kleider schneidern wollte. Allerdings geriet die Dachkammer mit der Zeit zum Stolperstein für die vornehmere Kundschaft. Das Mädchen erbringe erstaunliche Leistungen, schwärmten die Kunden, hingegen fehle dem erbärmlichen, engen Raum, in dem der Handel stattfinde, jeglicher Charme. Sie beschwerten sich über den teuren Preis und über die Gegenwart des Zuhälters, der vor der Kammer wachte und lauschte.
Es sei zu des Mädchens Sicherheit, beschwichtigte Lea, gleichzeitig sträubten sich ihr die Haare bei dem Gedanken, die gute Kundschaft könne den Preis herunter treiben oder gar eines Tages ganz weg bleiben. Unermüdlich grübelte sie nach einer Lösung. Eine kleine Wohnung zu mieten, widerstrebte ihr, da sie das erluderte Geld samt und sonders selbst einstreichen wollte. Und so kam ihr Philippines Nachricht, sie könne beim Pfaffen von Saint-Ouen täglich drei Stunden zusätzlich umsonst lernen, weil sie so begabt sei, wie gerufen. Zufrieden nahm Lea auch die Nachricht entgegen, der Gottesmann habe in Paris einen Facharzt gefunden, der Philippines Fuß untersuchen wolle. Es gäbe entsprechendes Schuhwerk, allerdings müsse es angepasst und dann angefertigt werden und das sei zeitaufwändig. Außerordentlich gelegen kam der Mutter Philippines Einsatz bei der Suche nach Alberta. Wie sie es vermutete, hatte der Aufseher von Saint-Ouen wenig Lust verspürt, seine Leute und Hunde in die Wälder zu schicken, um nach einer unbedeutenden Göre zu suchen. „Sie wird mit ihrem Freundchen zu den Räubern gestoßen sein und ein sittenloses Leben führen!“, hatte der Aufseher gesagt und Philippine fortgeschickt. Nun durchsuchte das Mädchen nach ihrem Unterricht beim Pfaffen allein zu Pferde Wälder und Wiesen, was bedeutete, dass das Haus des Folterers vom frühen Nachmittag an bis in die Abendstunden leerstand. Frieda konnte demnach ungestört Freier empfangen. Lea rieb sich die Hände. Alles klappte wie am Schnürchen.
Peinlich verfolgte sie die Arbeitszeit ihrer Tochter und wachte darüber, dass sie sich mit einem Kerl nicht länger als eine halbe Stunde aufhielt. Das war lange genug. Danach musste Frieda gewaschen werden, ruhen und sich umziehen. Mehr als drei Männer konnte sie nicht bedienen. Lust empfand Frieda nur beim Ersten, egal wie er aussah. Von der Mutter vorbereitet und gereizt, wartete sie mit schwellenden Brüsten und geschürztem Rock, unter dem ihre nackte Scham blitzte. War einer noch jung und sah ordentlich aus, entkleidete sie sich geübt vor seinen Augen, drapierte ihr Haar über Brüste und Bauch und öffnete ihre prächtigen Schenkel. Kein Mann sah ihr in dem Augenblick noch ins Gesicht.
*
Die Auskunft des Nachbarn hatte Philippine beunruhigt. Ja, in der Tat! Sein Sohn sei schon seit Tagen fort, aber gewiss nicht mit Alberta. Er wollte nach Lyon zu einem Onkel, um dort das Handwerk des Ebenisten zu erlernen. Schon lange habe er hier nur herumgehockt und über die Arbeit in der Ziegelfabrik geschimpft. Dabei müsse man doch froh sein, eine Arbeit zu haben, egal wie erschöpfend sie sei. Aber diese Jugend will hoch hinaus. Nein, nein. Mit Alberta sei er gewiss nicht losgezogen.
Was sollte er auch mit dem armseligen Mädchen anfangen? Es sei wahrhaftig nur ein Klotz am Bein. Seine Aussage hatte Philippine geschockt und mit trauriger Miene hatte sie den Nachbarn angesehen. Der schämte sich plötzlich, verzog mitleidig das Gesicht und fügte eilig an: „Na, ja. Mädchen ist Mädchen. Sie war ja freundlich. Immer anständig zu allen Nachbarn. Auch hilfsbereit. Und ist sie auch nicht so ansehnlich, so hat sie doch etwas unterm Rock, das auch meinen Jungen interessieren könnte. Trotzdem ...“ Ehe er seinen Satz beendete, wandte sich Philippine angewidert ab. Und die Worte, die er ihr beschwichtigend hinterher rief, konnten den Eindruck, den sie von der Gesinnung des Nachbarn gewonnen hatte, nicht mildern .
„Es tut mir leid, Philippine, dass ich dir nicht helfen kann. Mit Sicherheit weiß ich nicht, ob mein Junge in Lyon angekommen ist. Noch habe ich keine Nachricht - der Junge kann ja kaum die Feder richtig halten – aber ich vertraue ihm. Sobald ich Kunde von ihm habe, sollst du es wissen.“
Fast ein Monat war seit ihrem Verschwinden vergangen. Wie hatte Alberta in all der Zeit überlebt? Wie hat sie sich ernährt?
Philippine stellte sich immer wieder die gleichen Fragen und fand immer die gleichen Antworten: Sie lebt bei den Räubern oder ist mit dem Nachbarsjungen nach Lyon geflohen. Aber vielleicht ist sie auch tot? Warum findet man dann ihre Leiche nicht?