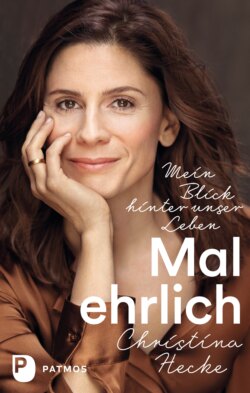Читать книгу Mal ehrlich - Christina Hecke - Страница 5
Kindertage:
Mädchen – joah.
Bübchen – boah!
ОглавлениеDen ersten Schritt habe ich – so befinde ich – also zunächst ganz gut gemeistert. Aber einmal begonnen zu gehen, hört es ja nicht auf. Jedem Schritt folgt ein nächster. Einmal eingeatmet, geht das beständig weiter. Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Und mit jedem Atemzug werden wir aufgefordert zu entscheiden, welche Frequenz uns leiten soll. Dur oder Moll. Coole Hits oder konsequente Wahrheit. Und darunter schlägt unser Herz. Beständig und im Takt der Qualität unseres Lebens. Unserer Entscheidungen. Des Einatmens, also dem Tanken von Qualität, und dem Ausatmen, also dementsprechenden Handeln. Damit gehen wir unsere Schritte. Das ist das beständige Workout unseres freien Willens. Grundsätzlich verwenden wir den Begriff Workout für eine auf ein Ziel ausgerichtete Maßnahme. Also: was ist das Ziel dieses Trainings? Vielmehr die Frage: Wohin gehen wir denn? Das ist eine ziemlich gute Frage …
»Wenn zwei Menschen an einem Punkt – nehmen wir den Alexanderplatz in Berlin – loslaufen. Und einer bis nach Potsdam und der andere bis nach Paris läuft. Wer ist weiter gekommen?« Wir würden sagen: »Naja, derjenige, der bis nach Paris gelaufen ist.« Korrekt. Das ist, in Kilometern ausgedrückt, richtig. Also in der Quantität. Aber selbst, wenn beide Personen einmal um den Globus rumlaufen – wo kommen sie denn an? …«Na, am Alex.« Dort, wo sie losgelaufen sind. Wenn sie glauben, dabei geradeaus gelaufen zu sein, ist das schon eine Illusion. Die Erde ist rund und dreht sich im Kreis. Wir bewegen uns im Kreis. Um den Globus herum, wenn Sie so wollen. Das Leben verläuft nicht linear. Es ist so simpel, und wir wollen es einfach nicht begreifen, weil das Wettbewerbsprinzip uns so fest am Wickel hat. Fakt ist: Wir gehen nirgends hin. Es ist so absurd, wie wir denken, dass es immer irgendwo hingeht. NO WAY. Wo wollen Sie denn auch hin? Wir kommen aus dem Diskurs Leben nicht raus. Weil wir aber in ein Flugzeug steigen können und dann an einen anderen Ort gelangen, glauben wir, wir wären raus aus dem Zusammenhang unseres Lebens. Befreit von den Problemen, die zu Hause stattfinden. Mit denen hängen wir aber zusammen, egal, wo wir uns aufhalten. Es ist eine Illusion, dass wir irgendwo hingehen, uns auf einer Geraden bewegen. Diese Illusion kennen wir nur, weil wir Geburt und Tod als Lebenslinie mit Anfangs- und Endpunkt denken statt als Kreislauf. Höher, schneller, besser – also Wettbewerb und Konkurrenz – alles, was sich darauf aufbaut, stößt irgendwann an ein Limit. Wie schnell soll ein Mensch noch laufen können? Wie hoch sollen Häuser, wie schnell sollen Autos noch werden? Es wird ein Limit geben. Aber solange das nicht erreicht ist, versuchen wir die Körper zu dominieren, alles aus ihnen rauszuquetschen, unsere Denkfähigkeit zu disziplinieren, um noch mehr erwirtschaften, noch mehr erfinden, noch mehr wissen zu können. Wir lieben Komplexität. Wir tun letztlich alles, um nicht akzeptieren zu müssen, dass wir uns im Kreis drehen. Dass es nur die Qualität zu vertiefen gilt, in der wir leben. Simplizität. Wir müssen nicht beständig Lösungen hinterherhecheln, die wir als Fixpunkte auf einer Geraden angenommen haben. Tiefer, weiser und gegen die Zentrifugalkraft dieses Leistungsprinzips, dass uns von unserem Bewusstsein im inneren Kern immer weiter hinaus in das Außen katapultiert, mit seiner Ausrichtung auf einen nimmer endenden Horizont des Höher & Schneller & Besser. Die Karotte Endlichkeit, die bedrohlich vor unserer Nase baumelt, wäre für immer passé. Aber das ist schon Schritt 48 vor Schritt 1. Denn die Dualität unseres Bewusstseins überhaupt erstmal anzunehmen, ist eine Hürde, vor der viele stehenbleiben. Ich höre in dem Zusammenhang oft den Satz: »Ja, schön, dass du das so sehen kannst. Ich kann das nicht.« Ich habe dann immer das Gefühl, es wäre ehrlicher von ihnen zu sagen »Ich will das nicht.« Denn an der herkömmlichen Sichtweise festzuhalten, schafft eine kurzfristige Befriedigung, weil es dem Spirit (oder Geist oder Ego) nützt. Weiterhin wirtschaftlich: weiterhin wettbewerbstauglich. Doch während alle die Ellenbogen ausfahren und auf Überholung im Außen drängen, atmet das Universum, dehnt sich ständig aus. Und offeriert uns damit ebenfalls beständig, in die Ausdehnung zu gehen. Nach innen. Vertiefend. Während wir versuchen festzuhalten, was geht! Mit dem kleinen Funken Hoffnung auf ein wenig Sicherheit … Weil wir unsere eigene Größe, und damit unsere Verantwortung, scheuen.
Und was wir eigentlich damit anstellen ist fatal: Wir geraten immer mehr in die Umlaufbahn unseres Selbst und damit auch immer tiefer rein in die Form, die Materie, und in die Reduktion auf das ausschließlich Menschliche. Geprägt von der Idee von Zeit. Von Anfangs- und Endpunkt. Ein philosophischer Weiser hat mal gesagt: Es ist ja die Erde, die sich dreht, und wir sind es, die wir uns an einem Punkt aufhalten. Und während sie sich dreht, sehen wir eben manchmal die Sonne und manchmal den Mond. Das nennen wir dann Tag und Nacht und glauben deshalb, dass es Zeit gibt. Aber genauer betrachtet ist das eine Illusion. Es ist eine Richtmöglichkeit, um im menschlichen Dasein Orientierung zu finden. Aber universell betrachtet gibt es keine Zeit. Es gibt nur Ausdehnung. Kreisläufe und Himmelsrichtungen. Und die Sterne. Und wir mittendrin.
Ich weiß – das mag jetzt für den einen oder die andere nach der ultimativen Spaßbremse klingen. Denn es nimmt dem Wettbewerb, der Identifikation mit dem Materiellen, dem Menschlichen -letztlich jeder Energie von Konkurrenz und Vergleich den Atem. Aber verstehen Sie die Leichtigkeit dahinter? Es lädt etwas ganz Neues oder besser Altes ein: Vertrauen. Wertschätzung für jeden Einzelnen fern von seiner Leistungsfähigkeit, dem ständigen Getrieben-Sein im Besser & Schneller des Leistungsprinzips. Sehen Sie das Ausmaß?! Den Sinn der wissenschaftlichen Forschung beispielsweise könnten wir auf diesem Fundament neu definieren! Es ginge nicht mehr darum, ob wir Preise für unsere Entdeckungen erhalten, berühmt werden oder viel Geld verdienen, sondern schlicht nur darum, ob und wie uns die entsprechende Errungenschaft als Gesamtem dient: ob sie uns gemeinsam voranbringt.
Schon während meiner ersten Lebenstage wird das Ausmaß der Reduktion auf das Menschliche zum Thema Forschung und wissenschaftlicher Erkenntnis für mich zu einer lustigen Erfahrung. Meine Eltern haben zunächst keinen Namen für mich! Nicht, weil sie einfallslos waren – sie hatten nur etwas anderes erwartet. Ein Stefan war geplant. Die moderne Medizin hatte nämlich ein Jungen prophezeit – und dann kam ein Mädchen. Baby Hecke steht also erstmal auf meinem Armbändchen. Alleine mein Geschlecht löst schon die erste Irritation aus. Nun: Ich bin eben ein Mädchen! Ich freue mich übrigens, dass ich später mit Christina neu betitelt werde. Mag ich, den Namen. Meinen Eltern wurde halt was anderes in Aussicht gestellt. Die Diagnostik hat sicher schon so manches Familienglück an dieser Stelle irritiert. Zu meiner Freude freuen sich die beiden über mich. Aber ist das nicht lustig? Da öffnet sich schon die nächste Kiste des menschlichen Beisammseins. Mädchen – joah. Bübchen – boah! Nur ein Klischee? Ich erlaube mir hier leise die Frage: Wie ist das denn im menschlichen Sinne mit der Wertegleichheit von Lebewesen? Energetisch sind wir eins. Fein. Aber wie sieht das Zusammenleben in der Praxis aus? Fakt ist: Wäre ich in einem anderen Kulturkreis geboren, hätte man mich vielleicht nur aus diesem einen Grund schon entsorgt, weil ich ein Mädchen bin. Diese Lernaufgabe habe ich mir offensichtlich für dieses Leben nicht ausgesucht. Aber ist es nicht spannend: Schon mit dem ersten Atemzug sind wir nicht mehr frei! Familie, Geschlecht, Herkunft, Bildungsgrad, Stand und politische Ausrichtung, kurz: wir werden beklebt mit hausgemachten Etiketten, die uns mit Rechten und Pflichten konfrontieren. Ob wir die schlussendlich annehmen, liegt bei uns, aber entziehen können wir uns ihnen zunächst nicht. Alleine die Tatsache, dass sich das Wort Geschlechterkampf in unserem Sprachrepertoire wiederfindet, ist doch traurig. Wie wäre es mit »Geschlechterinspiration«? Ich kann nur sagen, dass mir diese Zuschreibungen als kleines Mädchen völlig schleierhaft sind. Im Laufe meines jungen Lebens muss ich lernen, dass man mich kategorisiert mit Attributen, was typisch für ein Mädchen ist und was nicht. Mir werden tausend Schablonen vorgelegt, wie sich ein Mädchen oder eine Frau zu verhalten haben oder nicht. Dieses Repertoire gibt es auch für die Jungs. Logo. Da sind wir schon sehr einfallsreich. Erfahrungswerte der Großen werden zu Richtlinien für die Kleinen. Es ist die ständige Wiederholung von Glaubenssätzen, die wir nicht hinterfragen. Entschuldigen Sie, dass es mich hier gerade würgt. Aber die Regeln der Reduktion sind schon verdammt eng.
Beispielsweise gab es für mich früher nichts Spannenderes, als bei unserem Nachbarn, einem sehr lustigen, älteren Herrn, im Keller zu basteln. Oder Kaulquappen mit ihm zu züchten oder angeln zu gehen – eben die Welt zu entdecken. Alles Handwerkliche, Dinge zu reparieren oder zu bauen, hat mir große Freude gemacht. Mein größtes Erlebnis war, als ich als Sieben- oder Achtjährige an einem Weihnachtsabend alleine mit dem Werkzeug meines Vaters ein Radio gänzlich zerlegt und es anschließend wieder zusammengebaut habe. Und: es hat noch funktioniert! Obwohl ein paar Kleinteile übriggeblieben sind. Als ich das präsentiere, wird meine Freude schon mit: »An dir ist ein Junge verlorengegangen« kommentiert. Etikettiert. Sowas machen sonst nur Jungs. Was soll das? Ich werde an einer Norm gemessen. Ich bin aber keine Norm. Ich bin. Ich. Und so wie ich bin, bin ich wundervoll. Ein einzigartiger Winkel des Universums. Davon bin ich als Kind überzeugt. Damals kann ich das noch spüren und trabe auf den lieblosen Kommentar hin nur motzig davon. Mir schmeckt diese Bewertung nicht. Das kann für mich nur spürbar sein, weil ich in mir ein Wissen über die Wahrheit unseres Zusammenlebens trage, das mir sagt: »Ich bin nicht diese Etikette. So wie ich bin, bin ich prima.« Ich höre auf die Frequenz, die mir zufunkt: »Glaub nicht denen, vertraue dir selbst!«. Wie sonst hätte ich einen Referenzpunkt dafür, dass diese Beurteilung nichts Wahres ist? Die Andockstelle für die gemeinsame, universelle Wahrheit haben wir alle. Jeder, jede andere kann das genauso fühlen wie ich damals als Kind. Nur leben wir nicht danach. So hinterlässt jeder kleine Angriff auf diese Unbeschwertheit in mir eine kleine Wunde. Einen kleinen Knacks. Noch ist mir nicht klar, was das langfristig bedeuten wird …
Ich kann nur sagen: Ich liebe es, ein Mädchen zu sein. Ein Mädchen, das eben Radios auseinanderbaut, Puppen nicht mag und lieber auf Bäumen rumklettert. Und? Wieso ist diese Entdeckerfreude nicht der einzig relevante Parameter, unter dem ich mich bewegen darf? Erziehung orientiert sich oft gar nicht an den Qualitäten der Heranwachsenden selbst. Stattdessen stellen wir Regeln und Maßstäbe auf, um Messbarkeit zu ermöglichen. Wir geben oder fordern für alles ein Zeugnis oder einen Führerschein. Nur für die Erziehung eines Kindes nicht. Ob als Eltern oder Lehrer – welche Grundlage schaffen wir für unser Zusammensein, wenn wir einander immer nur an vorgegebenen Maßstäben abgleichen und vergleichen, statt das eigene Wesen und Potenzial wahrzunehmen? Auch das ist Teil des Spiels »Leistungsprinzip«. Da stecken wir drin bis zum Hals. Ab wann wird abgestillt, ab wann muss das Kind sprechen können, ab wann muss es laufen, rechnen, Flöte spielen können? Wir etablieren Richtwerte. Welche Titel die auch immer tragen. Für wen machen wir das, außer für unsere eigene Einordbarkeit, unsere Schablonenregale? Es dient letztlich nur unserer eigenen Sicherheit und damit dem Systemerhalt des Sicherheitsdenkens. Wir Erwachsenen meinen, wir müssten führen, einstufen können, urteilsfähig sein. Unseren Umgang mit den Dingen und den Menschen erklären können. Aber ich, gerade aus der Perspektive eines Kindes, kann ich sagen: »Verantwortung: super! Aber ich mag nicht bewertet werden! Ich will in keine Box gequetscht werden. Ich will mich ausdehnen! Ich fange doch gerade erst an zu blühen!« Vielleicht haben Sie das ja auch in irgendeiner Form erlebt. Bewertung. Ob gut oder schlecht. Sie prägt. Wir sind alle durch eine Erziehung gegangen und haben alle mehr oder minder unter den vorgelebten Schablonen und schulischen Strukturen gelitten oder sie fröhlich bedient. Beides mögliche Wahlen für oder gegen Eigenverantwortung. Aber statt diese Schablonen zu entlarven, geben wir sie fröhlich weiter an die nachfolgenden Generationen.
Wieso hinterfragen wir das nicht? Mochten Sie das als Kind all diesem »Richtig & Falsch« ausgesetzt zu sein? »Später werden wir uns gegen die Bewertungen von außen auf heroische Art und Weise zur Wehr setzen«, so denken wir als Kinder noch! So denke ich damals auch, als ich mit meiner Bastelfreude auf Jungenhaftigkeit reduziert werde. Aber schon die Reaktionen auf diese ersten Prägungen verstricken mich so tief, dass ich ab da glaube, mich »freischwimmen« zu müssen. Diese späteren, pubertären oder lebenslangen Rebellionen sind ein sich im Kreis drehendes Model. Es ist die Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion. Letztlich »verbessern« wir vielleicht unser Dasein aus unserer Sicht, aber das Fundament ist dann schon lange nicht mehr unsere wahre Kraft. Es wird die eines Kriegers oder einer Kriegerin sein. Es sind nämlich die kleinen Dinge, die stetig auf uns einwirken, deren Prägung wir annehmen. Mit jeder Entscheidung. Freier Wille. Für oder gegen die innere Wahrheit …
Als junges Mädchen mache ich noch andere Dinge, die nicht in die mir vorgelegte Schablone passen. Ich möchte beispielsweise die Haare kurz tragen. Bei meiner Einschulung später brüllt dann ein Mitschüler, als ich mich vorstelle: »Wie, das ist’n Mädchen?«. Auch dieser Junge: ein geprägtes Wesen. Nicht nur ein Mitschüler. Da zieht die gedankenverlorene Weitergabe von Wertungen und Schablonen seine Kreise. Ein wahrscheinlich ganz sensibler, feiner Junge ist schon so von Bildern geprägt, dass er mir volle Breitseite diesen Spruch verpasst. Und das scheppert ordentlich in mir. Wahrscheinlich nochmal mehr, weil ich mich mit dieser blöden Wie-sind-Jungs-und-wie-sind-Mädchen?-Etikettiererei eh schon rumschlagen muss. Mir wird das Gefühl vermittelt, mit mir sei was nicht in Ordnung. Ich sei in irgendeinem Punkt falsch. Kennen Sie das? Da hat jemand etwas Hässliches oder Wertendes über Sie gesagt, als Sie noch Kind waren – vielleicht sogar jemand, den Sie mochten. Womöglich nur in einem Nebensatz. Vielleicht einen Satz wie: »Lass das mal, du hast eh keine Ahnung. Ich mach das« oder: »Das kannst du nicht. Du bist ein Mädchen.« Und schon ist sie da, die Offerte der Entscheidung: Nehmen Sie das Paket »Wertlosigkeit« an, sinken ins Drama des Daseins und verhärten sich in Reaktionen – also übernehmen diesen Glaubenssatz und verbuddeln ihr Selbstvertrauen? Halten Sie also für den Rest des Lebens an einer Aussage fest, die eine Person Ihnen gegenüber getroffen hat, die alles, nur nicht wirklich Sie, also ihr wahres Wesen kennt und Sie mit einem nicht-wertschätzenden Blick angesprochen hat? Oder durchdringen Sie das Spiel, bleiben bei sich und in dem tiefen Vertrauen darauf, dass Sie spüren, dass das nicht stimmt – dass dieser dumme Spruch nicht zu Ihnen gehört. Dass er zu dem Ich-bezogenen Sender N°2 gehört, der Sie bewusst verletzen will, um Sie klein zu halten, damit Sie nicht ihre eigenen Schritte gehen. Damit Sender N°1 keine Option wird.
Apropos eigene Schritte. Dazu fällt mir ein von meinem Vater immer wieder gerne zitierter Moment unsere Familiengeschichte ein: Wir waren mal irgendwo auf einer Bergwanderung. In dem Wort liegt schon das Potenzial von Höhe verborgen. Familie Hecke läuft auf einen Gipfel zu, ich kleiner Knirps löse mich von der Truppe, renne zur äußersten Kante. »Deine Fußspitzen ragten über dem Abgrund«, sagt mein Vater. Und fährt fort: » … mir ist das Herz stehengeblieben. Es ging tausend Meter in die Tiefe. Du aber hast die Arme ausgestreckt und gerufen Schau mal, Papi, ich bin ein Vögelchen!« – Angstbefreit? Möglich. Grenzgängerisch? Definitv! Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf mein ganz eigenes Wettbewerbsprinzip, auf das ich mich später eingelassen habe. Vielleicht eine Rebellion gegen das Mädchen joah-Klischee. Es wird ein Wettbewerb mit mir selbst. Schaffe ich es allein? Wie weit kann ich gehen? Aber auch das, so werde ich später erkennen, ist nur das Ausmaß einer Kette von Reaktionen auf das, was mir bis dahin schon alles begegnet ist. Was ich wohl noch alles würde ausloten wollen auf dieser Reise …?
Als Kinder sind wir noch klein, was unmittelbar Versorgungsgefühle bei den Großen auslöst. Das ist auch gut so, denn wir können uns ja noch nicht alleine versorgen. So ist das Phänomen Beschützerinstinkt ein wunderbares Element der Grundausstattung unserer Spezies. Das haben wir einfach. Woher?, finde ich interessant zu fragen. Aus der Schule sicherlich nicht. Ich erinnere jedenfalls keine Unterrichtsstunde, in der »Babys versorgen und gernhaben« an der Tafel stand. Sie? Wir haben das einfach. Eine Selbstverständlichkeit. Beruhend auf dem eigentlich tiefen Gefühl der Verbundenheit. Woher sonst? Es ist uns gegeben. Und wie wir leider aus dem Beispiel der Kindstötung bei »falschem« Geschlecht in anderen Kulturen wissen, kann dieser Beschützerinstinkt auch ignoriert werden. In dem Fall, würde ich meinen, wurde er einfach nur überlagert von all dem Wissen, dem Angelernten, dem »Richtig & Falsch« der nicht hinterfragten Traditionen und Rituale. Ich bin sicher: Ablegen kann man das nicht. Aber ignorieren.
In diesem Zusammenhang klingt für mich eine vertiefende Frage an: Was machen wir mit dieser Fähigkeit, wenn wir sie annehmen? Wie verantwortungsbewusst üben wir sie aus? Wie gehen wir mit den Kindern um? Schauen wir uns zum Beispiel an, hören wir zu, was das Kind wirklich braucht, oder ist es mehr die eigene Freude am »Geliebtwerden« oder was immer die Motivation ist, wenn wir von Kinderaugen angestrahlt werden, denen wir gerade ein Geschenk gemacht haben?
Dazu die Praxis. Wir siedeln jäh in den Garten meiner Großeltern über. Ostern 1981. Vor einiger Zeit habe ich ein altes High8-Video zugespielt bekommen. Aufnahmen, die mein Großvater gemacht hat. Tonlos und in Sepia-gelb. Und verwackelt. Also kaum Netflix-tauglich. Aber das aufschlussreichste Geschenk, das mir je in die Hände gefallen ist. Es zeigt meine Familie und mich. Ich sitze da vor einer winzig kleinen Tanne, kaum 30 cm hoch – ich selbst habe übrigens auch ein kaum höheres Stockmaß – und erfreue mich sichtlich an diesem Gewächs. Sprechen und Laufen sind noch nicht meine Stärken. Ich genieße einfach. Nur ich und dieses junge, grüne Leben. In diese Idylle hinein greifen zwei lange Arme eines deutlich größeren Menschenwesens, werfen mich jubelnd in die Luft – mehrfach – bis ich mich schier überschlage. Durchlässigkeit ist offenbar ein Teil meiner Grundausstattung, die ich für dieses Leben gewählt habe, denn es wird sofort deutlich: Meinem Vergnügen dient das hier gerade nicht! Mit Sicherheit würde der »Werfer« aus dieser Geschichte Stein und Bein schwören, dass er aus Liebe gehandelt und mir weiß Gott nichts Böses wollte. Im Gegenteil. Er wollte mich erheitern. Aber ich frage jetzt mal: warum? Warum ist die Stille und die Seligkeit des Kindes, vertraut im Eins-Sein mit Natur und sich selbst, »erheiternsbedürftig« – oder möglicherweise schier nicht auszuhalten? Ja, wir sind in dieser Phase des Lebens kleine Menschen, die Schutz brauchen. Wir können noch nicht selbst einkaufen, kochen oder sonst was. Aber wir großen Menschen erlauben uns einfach, mit Macht, Entscheidungsgewalt und Respektlosigkeit über diese kleinen Menschen zu entscheiden und zu machen, was wir gerne hätten.
Es bleibt interessant. Denn was in dem Video weiter unter den Höhenflügen vier und fünf geschieht, ist für mich im Erwachsenenalter zu betrachten mehr als aufschlussreich. Offenbar lasse ich mich nämlich von der Freude des Werfenden so sehr ergreifen, dass ich anfange mitzumachen. Mitzulachen. Also mein ursprüngliches Gefühl zu überschreiben. Ich hätte ja auch losheulen können. Nein – ich lache mit. Ich lache übrigens heute noch, wenn richtig schlimme Dinge geschehen. Unfälle oder andere schockierende Ereignisse. Und dieses Video zeigt mir, dass viele Situationen ähnlicher Couleur dazu geführt haben, mich mehr und mehr hinten anzustellen, und das, was ich für richtig halte oder gerne gemacht hätte, zugunsten der Erheiterung meines Gegenübers einzutauschen. Zu kompensieren aus Sympathie für die anderen. Der Todesstoß für jeden klaren Blick. All diese kleinen Momente, diese Zwischentöne und bewussten oder unbewussten Entscheidungen waren Schritte weg von dem, was ich mit einem Gefühl von Allverbundenheit meine. Dem Gefühl der Existenz in einem Bewusstsein, dass ich für niemanden etwas tun oder sein muss. Auch für mich nicht. Dass mein Leben, also mein Handeln, keine Bürde oder Pflicht ist. Aber sowohl dem Erwachsenen, der sich offenbar nicht zu meiner Freude, sondern zu dessen eigenen Vergnügen erlaubt hat, mich durch die Luft zu schleudern, als auch mir, die es nach einiger Zeit mit dem ersehnten Widerhall des kindlichen Kieksens zurückgegeben hat, obliegt es, eine Entscheidung zu treffen: mit-zu-machen oder mit-sich-eins-zu-bleiben. Also mache ich etwas oder bin ich. Aus einem rein menschlichen Blickwinkel macht das Sinn: das Mitmachen. Das Adere-nicht-enttäuschen-Wollen. Dazugehören. Denn: Wer will nicht geliebt werden! Wer wird gerne zurückgewiesen?
Meine Kindergartenerfahrung schlägt eine weitere Kerbe ins Holz. Ein weiterer Warnschuss: »Reih dich ein!« Damals reihe ich mich aber noch nicht ein. Ich mache nicht mit, ich will ums Überleben nicht in den Kindergarten. Ich schreie, bis ich die Luft anhalte und umfalle. Man nennt das fachgerecht »frühkindliche Hysterie«. Zack: Label drauf. Denn warum ich nicht dahin will, ist kein Thema. Ich funktioniere nicht. Das reicht, um einen Gang zum Arzt und eine Diagnose zu rechtfertigen. Der Hinweis meiner Kinderärztin, dass ich, wenn das nicht aufhört, zu einem Kinderpsychologen muss, trifft meine Mutter hart. Das spüre ich. Sie will ja auch nicht unangenehm auffallen mit so einem Brüllkäfer. Und auch, wenn das eben mein Ausdruck ist, zu sagen: »Hört mich doch bitte!« (zugegeben laut – ich hoffte, auch wirksam … naja.), spüre ich und muss erkennen: Das ist nicht das geeignete Mittel. Denn Mamas Liebe will ich nicht verlieren. Ich gebe also auf und stelle das Gebrülle ein. Ich reihe mich ein. Ich muss erkennen, dass Mitlaufen ein Teil dessen ist, was das Menschsein auszumachen scheint. Dass mir die Nonnen im katholischen Kindergarten mit ihren dunklen Kutten Angst machen, dass die anderen Kinder mir Angst machen, dass dieses Lernen mit anderen außerhalb der Familie, mit denen ich nun umgehen muss, eine Aufgabe für mich ist – darüber reden wir nicht. Das da Energien spürbar werden, die mich einschüchtern sollen, auch nicht. Da mussten alle durch. Es wird nicht gesehen. Nicht, weil das keiner will. Diese Liebe würde ich meinen Eltern schon zuschreiben. Aber weil man das nicht hinterfragt, weil es Teil der Wiederholbarkeit ist, durch die wir uns eben gegenseitig durchschleusen. Man macht das eben so. Kindergarten, Schule, Uni, Ehe, Reihenhaus, Altersvorsorge, Sargdeckel. Auf dieses lineare System haben wir uns geeinigt. Das ist das Grundgefühl von Zugehörigkeit. Ein Leben, das mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Und dazwischen suchen wir uns ein kleines bisschen Glück, Liebe, Erfolg … Ist das nicht trostlos? Was geben wir da weiter an die kleinen Großen? Vielmehr …: Was nehmen wir ihnen weg? Weg mit dem Urvertrauen – her mit dem Sicherheitsdenken.
In diesem Netz des Dazugehörens und Mitmachens werde ich allerdings zunehmend unglücklich. Ich spüre einfach nach wie vor, dass daran irgendwas nicht stimmt. Das Foto meiner Einschulung spricht Bände. Es wird sichtbar: Ab jetzt möchte ich irgendwie gefallen. Ich sehe bezaubernd aus. Lächle brav. Aber der Ausdruck in meinen Augen spricht Bände. Er ist tief traurig. Was ich spätestens jetzt verstanden habe, ist: Es gibt eine äußere Fassade und einen inneren Kern. Das ist langsam, aber sicher nicht mehr Dasselbe. Das geht verloren mit jeder Wiederholung. Die Währung, mit der wir handeln, ist Zugehörigkeit. Zu was oder zu wem? Es ist eine Frage der Frequenz, auf die wir uns einschwingen. Gemeinsame Wahrheit oder Individualisten-Kabarett? Radiostation N°1 oder N°2? Die absolute Mehrheit tanzt Solo. Also auf zum Staatsballett der Solisten! Der vom großen Ganzen Getrennten. Gemeinsam einsam. Wie gut, dass Ballett nie meine Stärke sein wird …