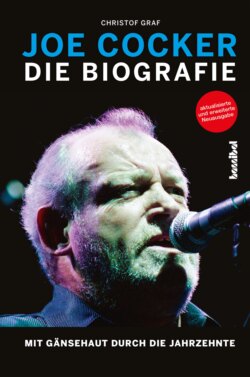Читать книгу Joe Cocker - Die Biografie - Christof Graf - Страница 7
ОглавлениеJoe Cocker wusste, was es heißt, wie ein Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Schon in den 70ern galt er als „der neue Star“ im Rockbusiness. Janis Joplin, Jimi Hendrix und Jim Morrison waren bald tot, Joe Cocker jedoch lebte. Aber ebenso wie die Mitglieder des berühmten „Club 27“ war auch er in Gefahr, zur tragischen Figur zu werden und zu sterben. Nach seiner durch den Woodstock-Auftritt steil aufsteigenden Karriere und einigen Hits, auf welche er mit einem ausschweifenden Leben ganz im Sinne der vielzitierten Mentalität „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ reagierte, beschrieben ihn die Medien schnell als hochgradig Gefährdeten. Sie machten ihn damit aber zu früh zum ausgebrannten Star, brachen zu früh den Stab über ihn. Denn es folgten Jahre voller Höhen und Tiefen, es gab Triumphe, aber auch Misserfolge. Und nach über fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft war Joe Cocker immer noch einer der erfolgreichsten und bekanntesten Sänger weltweit. Viele seiner insgesamt nunmehr offiziell 22 Studio- und drei Live-Alben erreichten Platin-Status, und er wurde mit zahllosen Awards wie dem Grammy, dem Golden Globe und dem Academy Award ausgezeichnet und erhielt zudem von der Queen den Order of the British Empire. Kurzum: John Robert „Joe“ Cocker, der am 20. Mai 1944 in der einstigen englischen Stahlmetropole Sheffield geboren wurde, galt 70 Jahre später als ein „Elder statesman des Rock’n’Roll“, als der weiße Soul-, Blues- und Rocksänger mit der schwärzesten Stimme, vor allem aber galt er als „Überlebender“. Was ihn zu all dem machte? Seine Stimme!
Seit Mitte der 90er-Jahre war Joe „the real voice“ Cocker von den großen Veranstaltungsorten dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Für eine „Stimme“ ist die Bühne der beste Ort, um sich auszuleben. Live zu spielen ist wahrscheinlich auch das, was Cocker am meisten genoss und auch immer schon genossen hatte. Auf seiner letzten Welttournee 2013 etwa spielte er vor ausverkauften Häusern rund um den Globus, sogar in Südamerika.
Eine ganze Generation wollte in Woodstock die Utopie von Liebe und Frieden in schiere Realität überführen, und mit der seelenvollen Interpretation des Beatles-Klassikers „With A Little Help From My Friends“ unterstrich Cocker, dass diese Vision von Liebe ohne brüderliche Solidarität nur unvollständig wäre.
Aber schon mit Beginn der siebziger Jahre war der Traum ausgeträumt. Trotz Hendrix’ symbolischer Intervention „Star Spangled Banner“ wurden in Vietnam weiterhin Menschen getötet, und am 18. September 1970 starb Hendrix schließlich. Janis Joplin und Jim Morrison folgten ihm am 4. Oktober 1970 bzw. am 3. Juli 1971 nach. Joe Cocker wurde währenddessen und im Rahmen seiner berühmt-berüchtigten „Mad Dogs & Englishmen“-Tournee in 56 Tagen durch 48 amerikanische Städte gescheucht; er kam von dieser Tour mit ganzen 862 Dollar und einem Nervenzusammenbruch zurück. Es grenzt fast an ein Wunder, dass der „Underdog“ damals nicht auch starb. Das verdankte er neben seinen Eltern (bei denen er – immer wieder einmal – kurzfristig untertauchen konnte) wohl auch seiner nie gebrochenen Liebe zum Leben und zur Musik.
Joe Cocker kehrte nach der „Mad Dogs“-Odyssee 1972 ins Showbusiness zurück, lernte aber die ganzen siebziger Jahre hindurch weiterhin vor allem die Tiefen dieses Geschäfts kennen. Erst im Laufe der nächsten Dekade und eben „with a little help from my friends“ reifte er schließlich zur Persönlichkeit, die einen hochexpressiven Artisten und einen endlich ausgeglichenen und befriedeten Privatmenschen in sich vereinte. In den letzten Jahren lebte er zurückgezogen mit seiner Frau Pamela in seiner Wahlheimat Kalifornien oder fand auf seiner Farm in Colorado seine innere Harmonie.
Zur kreativen Blütezeit der Rockmusik oft abgeschrieben oder gar totgesagt, war dieser immer wieder auferstandene Selfmademan vom Dienst also auch im neuen Jahrtausend weitaus lebendiger (und authentischer) als die zeitgenössische Rockmusik selbst.
Die Zeit der großen klassischen Komponisten und Rock-Autoren scheint im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zu Ende zu gehen. Kollaborateure und Weggefährten sterben. Johnny Cash am 12. September 2003 und Lou Reed am 27. Oktober 2013. John Lennon, dem Joe Cocker seine größten Coverversionen verdankte, verstarb schon am 8. Dezember 1980. Cockers größtes musikalisches Vorbild Ray Charles am 10. Juni 2004. Andere „friends along his way“ begleiteten Cocker hingegen in den Olymp der sogenannten „Elder statesmen“ des Rock. Eric Clapton wurde am 30. März 2014 69 Jahre alt, Mick Jagger am 26. Juli 71, Paul McCartney am 18. Juni 72, Bob Dylan am 24. Mai schon 73. Noch ehrwürdigere Ikonen wie Leonard Cohen, der Singer-Songwriter, aus dessen Repertoire Cocker gleich drei Songs veredelte und zu Hits machte, wurden 2014 gar 80 Jahre alt.
Joe Cocker indes durfte sich mehr denn je als ein Überlebender fühlen, der getreu der Maßgabe vorging: „It’s the singer, not the song.“ Und er war in der Tat einer der Größten unter den Interpreten. Der Grund dafür lag eben sicherlich in seiner einzigartigen Stimme. Selbst Cockers großes Vorbild Ray Charles zollte ihm dafür Bewunderung. Cocker galt als berühmteste weiße Bluesstimme, und die NEW YORK TIMES wählte ihn sogar einmal zum „besten männlichen Rocksänger“. Aber da war noch etwas, denn Joe Cocker war einer der ganz wenigen Popkünstler, die trotz ihres Erfolgs quer durch alle Generationen dezidiert nicht die Rolle des Seelentrösters ausfüllten. „Dafür liefert Cocker seinen Fans eine Ahnung von emotionalen Exzessen, die ihnen ihr eigenes Leben vorenthält“, analysierte Wolfgang Hobel schon Anfang 1990 treffend in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG.
Wer Joe Cocker hört, weiß im Nachhinein zwar auch nicht ganz genau, wie es nun um die geheimnisvollen Mächte bestellt ist, die unser Leben lenken. Aber dass diese existentiellen Fügungen existieren, davon legten Cockers Stimme und Werk ein glaubwürdiges Zeugnis ab.
In seiner langen Laufbahn hatte Joe Cocker immer wieder bewiesen, dass er es wie kaum ein anderer Musiker verstanden hatte, Songs namhafter Komponisten zu seinen eigenen zu machen. Er hatte über die Jahre zahlreiche Fremdtitel in sein Repertoire aufgenommen und diese so überzeugend in seinem absolut individuellen Stil interpretiert, dass man glauben konnte, sie seien extra für ihn verfasst worden. Viele Nummern, die ursprünglich für andere Sänger geschrieben worden waren, erlangten in seiner Bearbeitung den Status von Klassikern. So manches Lied wurde erst in seiner Fassung weltberühmt, bestes Beispiel wiederum Randy Newmans „You Can Leave Your Hat On“. Weltweit kommt wohl kaum ein Striptease ohne diese Musik im Hintergrund aus.
Über ihn hieß es: „Wenn er singt, zerreißt Cocker sein eigenes Herz und seine Seele mit der Dringlichkeit und Intensität eines van Gogh des Rock ’n’ Roll … Ein Song, der einmal von ihm gesungen worden ist, ist damit für immer gesungen worden.“ Über Jahrzehnte hinweg genoss die musikalische Legende aus Sheffield weltweit den Ruf eines hervorragenden Sängers, extravaganten Interpreten und passionierten Bühnenmusikers. Der englische Soulsänger eroberte die verschiedensten Genres, schuf eine große Anzahl von Klassikern, hielt aber an einer bestimmten Stilrichtung stets besonders fest: „Ich scheine mich nie sehr weit vom Blues zu entfernen“, verriet der Künstler. „Ich habe es versucht, aber wenn ich dem zuhöre, was andere Leute so singen … in meinem ganzen Leben könnte ich so was nicht singen. Ich denke, wenn du mal so um die Mitte dreißig bist, hast du deinen grundsätzlichen Stil festgelegt. Ich könnte einfach keine anderen Platten machen.“
Glücklicherweise war das genau der richtige Stil für den raspelnden, knurrenden Sänger, der immer aufs Neue in der Lage war, das noch zu übertreffen, wofür sein Publikum ihn so sehr schätzte.
Der in unvergesslichen Liveauftritten und Studioaufnahmen immer vorhandene Zauber war erstaunlich, aber nicht unerklärlich. „Songs wie ‚You Are So Beautiful‘ oder ‚With A Little Help From My Friends‘ könnte ich ewig singen“, bemerkte Cocker zu zwei Songs, die in jedes seiner Konzerte hineingehörten, und zu seiner Hingabe an den Gesang. „Gott weiß, wie oft ich sie schon gesungen habe. Es ist, als ob ich tausendmal das gleiche Bild malte. Man fragt sich immer: ‚Wie bekomme ich es diesmal richtig hin?‘ Und ich bekomme es jedes Mal richtig hin.“ Vielleicht weil er einfach etwas hatte, was andere nicht haben: eine Ausnahmestimme.
Aber was machte denn nun Cockers Stimme zur Ausnahme? Ihr Klang? Ihre Klangfarbe? Ihre Geschichte? Die Geschichten, die sie erzählte? In all dem liegt natürlich ein Körnchen Wahrheit. Klar ist jedenfalls: Was bleibt im Musikbusiness, sind die Ausnahmestimmen. Eine Stimme, die einem das Gefühl gibt, sich ihr nicht entziehen zu können, als hätte sie etwas Magisches. Aber vielleicht ist es auch nur das tragische Moment in ihr, das den Geschichten etwas gibt, was sie zu dem macht, was Menschen immer suchen: Authentizität.
Es geht also nicht nur um eine Stimme, die wie Joe Cocker klingt. Es geht um die, die Joe Cocker war und die nur deswegen seine war, weil sie seine Geschichten erklingen ließ. Eine Stimme, kalt und warm zugleich, eine Stimme voller Kraft und Emotionalität, eine Stimme, die weit über das hinausging, was die Tonleiter ausmacht, die hell und klar ebenso wie dunkel und weich war. Eine Stimme, die einen Sänger zum Shouter, zum Schreienden macht, der damit Klänge erzeugt, wie sie kein anderer nach ihm erklingen lassen kann.
Ja, es gibt sie natürlich, die faszinierenden Stimmen Elton Johns, Freddie Mercurys und auch die von Vertretern der jüngeren Generation wie Lady Gaga, Katie Perry, Leslie Clio oder Birdy. Aber es sind keine, die Geschichten wie die von Joe Cocker erklingen lassen. Und dabei waren es noch nicht einmal immer seine eigenen Lieder, die er da auf seine ureigene Art und Weise zu Gehör brachte. Oft waren es jene von Kollegen, von denen er meinte, sie würden gut zu seiner Stimme passen. Oft machte er solche Lieder von den Beatles, Bob Marley, Randy Newman, Leonard Cohen oder Bob Dylan in einem unnachahmlichen Veredelungsprozess zu noch größeren Hits, als sie das ohnehin schon waren.
Peter Maffay spricht in seinen „Gedanken eines Getriebenen“ den „9. Ton“ an. Ein solcher durchdrang auch Joe Cockers Tonleiter. Eine Tonleiter oder Skala ist in der Musik eine Reihe von der Tonhöhe nach geordneten Tönen, die durch Rahmentöne begrenzt wird, jenseits derer die Tonreihe in der Regel wiederholbar ist. Meistens hat eine Tonleiter den Umfang einer Oktave und folgt dabei in vielen Fällen einem heptatonischen Tonskalenaufbau. Wie eine Tonleiter aufgebaut ist, wird im Tonsystem festgelegt. Die gebräuchlichsten europäischen und außereuropäischen Tonleitern basieren auf fünf oder sieben Tönen innerhalb der Oktave, welche Tonstufen genannt werden. Weit verbreitet sind diatonische Tonleitern in Dur und Moll oder die Kirchenleitern. Tonleitern sind durch Tonabstände definiert. Die in der konkreten Tonleiter enthaltenen Töne bezeichnet man als leitereigen. In außereuropäischer Musik wie der klassischen arabischen oder indischen gibt es Tonsysteme und Tonleitern, die den Tonraum anders aufteilen. So bestehen Tonleitern, die mehr als sieben festgelegte Tonstufen enthalten, wie zum Beispiel Mugam, Maqam oder Raga. Ein Beispiel für eine der heute in Mitteleuropa am gebräuchlichsten Tonleitern: die Dur-Tonleiter. Sie besteht aus Tönen im Abstand: Ganzton – Ganzton – Halbton – Ganzton – Ganzton – Ganzton – Halbton. Man kann eine so definierte Tonleiter auf jedem beliebigen Ton beginnen. Durch Angabe eines konkreten Anfangstons (Grundtons) wird daraus eine Tonart wie C-Dur, D-Dur usw. Die leitereigenen Töne von C-Dur heißen auch Stammtöne und entsprechen den weißen Tasten auf einer Klaviatur. Paul McCartney, der mit Joe Cocker 2002 zusammen „All You Need Is Love“ für das 50. Thronjubiläum der Queen im Buckingham Palace-Garden sang, schrieb über das Zusammenspiel der Klaviertasten den Song „Ebony & Ivory“ aus dem Jahr 1982, den er damals zusammen mit Stevie Wonder intonierte.
Manche interpretieren den Song als gelebtes Ideal zwischen den Gegensätzen. In der Musik ist es Dur und Moll. Dur und Moll verdrängten im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Bezeichnungen Modus major und Modus minor (cantus durus und cantus mollis) für die Tongeschlechter der Kirchentonarten. Seitdem spricht man auch vom dur-moll-tonalen Tonsystem, kurz Dur-Moll-System. Der Höreindruck von Dur wird oft als „hell, klar“ (vgl. lat. durus = hart) beschrieben, wogegen Moll oft als „dunkel, weich“ (vgl. lat. mollis = weich) bezeichnet wird. Diese Charakterisierungen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere weitergehende Assoziationen wie z. B. Dur mit fröhlich oder Moll mit traurig können zwar im Einzelfall zutreffen, dürfen aber auf gar keinen Fall verallgemeinert werden, weil der musikalische Gesamteindruck noch von vielen anderen Komponenten abhängt.
Cocker, der Stimmkünstler, der Magier der Töne, wurde mit seinem Gesang nun zu einem Maler und Regisseur zugleich. Er projizierte Bilder auf eine Leinwand und lieferte gleichzeitig den Soundtrack dazu. Was bleibt, ist die Macht der Klänge. Klänge, die die Kraft haben, Erinnerungen zu wecken, Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Erinnerungen an Bilder, die man gerne wiedersieht, Erinnerungen, die man gerne auffrischt. Erinnerungen an die erste Liebe, an das erste Konzert, an erste Reisen in große Städte, in ferne Länder. Assoziationen von Freiheit, von gelebtem Leben und Gefühlen. Erinnerungen an Ereignisse wie Woodstock, den Mauerfall oder Liebesfilme wie „Ein Offizier und Gentleman“, oder eben „9 ½ Wochen“. Und wenn ein Künstler mit seiner Kunst Dekade für Dekade immer wieder neue Bilder zu schaffen weiß, wird er zum Ausnahmekünstler.
Joe Cocker hat gleich ein ganzes Bilderbuch gemalt: „With A Little Help From My Friends“ steht für die 60er-Jahre, „Mad Dogs & Englishmen“ und „Wasted Years“ stehen für die 70er-Jahre, „Up Where We Belong“, „You Can Leave Your Hat On“ und „Unchain My Heart“ für die 80er sowie „Night Calls“, „Sail Away“, „First We Take Manhattan“ und „She Believes in Me“ für die 90er, „Respect Yourself“, „Hard Knocks“ und „Fire It Up“ schließlich stellvertretend für den 30 Jahre anhaltenden kommerziellen Erfolg Joe Cockers auch im neuen Jahrtausend.
Und erfragt und erkundet man immer und immer wieder das Besondere an Cocker, dessen Leben, dessen Kunst und dessen Stimme, scheint es, als hätte Peter Maffay bei seinem Sinnieren über den „9. Ton“ einer Tonleiter recht, wenn er schreibt: „Der neunte Ton ist der gute Ton. Ohne ihn wären die Musiker eines Orchesters nicht in der Lage, harmonisch miteinander zu musizieren. Dieser 9. Ton steht für respektvolles Zusammenspiel … Er steht dafür, Dialoge zu entfachen, andere glücklich zu machen, sich zu öffnen, um andere zu berühren …“ Und: „Der neunte Ton ist eine nie endende Herausforderung.“ Vielleicht ist es das, was Cocker über die Jahre so erfolgreich machte, obwohl er nach steilem Bergaufstieg tief fiel, lange liegen blieb, oft dabei noch getreten wurde, und irgendwann doch wieder zu sich kam und bedacht die Dinge anging, sich schonte und ohne Groll und Hass jenen gegenüber, die ihn traten, wie ein Phönix aus der Asche in die Lüfte stieg und von da an nie wieder zurückschaute.
„Musik gehört zu den merkwürdigsten Phänomenen, die die Menschen jemals hervorgebracht haben“, sinnierte Cocker schon in den 70ern bei Gesprächen während der „Mad Dogs & Englishmen“-Tournee. „Essen, Trinken und Schlafen erfüllt einen evolutionären Nutzen, niemand aber braucht Musik und deren Klänge, Töne und Melodien. Und dennoch haben wir Hunger nach ihnen, bewegen wir uns nach ihnen, machen unsere Stimmungen davon abhängig und können uns kein Leben ohne sie vorstellen.“
Wenn man von der sogenannten zeitgenössischen Musik ausgeht, deren Vertreter Joe Cocker war, ging es bei seinen präferierten Musikstilen um die des Rock & Pop, genauer, vor allem um die des Blues und Souls. Viele Rockbands der 60er-Jahre, besonders in Großbritannien, nahmen den amerikanischen Blues als Basis für ihre Musik und reimportierten ihn während der sogenannten „British Invasion“ zurück in die USA. Auch dort wurde er wieder von zumeist weißen Rockmusikern aufgegriffen. Populäre Musiker und Bands wie The Doors, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Alvin Lee, Peter Green, The Rolling Stones und Rory Gallagher waren sowohl vom akustischen als auch vom elektrischen Blues beeinflusst und leiteten davon ihren eigenen Stil ab, den Bluesrock. Joe Cocker bedauerte immer, kein Instrument zu spielen, nicht gerne Songs zu schreiben, die Tonleiter nicht zu beherrschen … „Ich brauche eine Komposition eigentlich nur einmal zu singen, und schon fühle ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber in welcher Tonart sie liegt, weiß ich nicht. Für mich ist ein Song ein Medium, beim Singen vollziehe ich eine mentale Transformation. Aber eigentlich kann man das einem Außenstehenden gar nicht erklären.“ Und: „Viele halten mich bloß für einen Bluessänger. Ich bin ein sehr natürlicher Sänger, alles, was aus mir herauskommt, passiert spontan. Ich kann keine Noten lesen, und auch mit der Tonleiter habe ich mich eigentlich nie beschäftigt. Anfangs sang ich meine Songs ein oder zwei Tonlagen tiefer, ich wusste ja gar nicht, dass ich auch höher kommen konnte. Ich bin mein Leben lang ohne Lehrer ausgekommen. Manchmal stößt man aber auch an seine Grenzen. Als ich vor ein paar Jahren in London mit Eric Clapton auf der Bühne stand, fragte der Meister mich, in welcher Tonart der Song sei, den wir als Nächstes spielen wollten. Da musste ich leider passen.“
Diese Art von Antwort passte zu Joe Cocker. Ob in den 80ern, in den 90ern oder in den 2000ern, Cocker war in seinen Gesprächen stets offen und ehrlich gewesen. Meist sogar zu ehrlich und offen, und noch häufiger auch geradezu ungeschickt. Besonders in den 70ern und 80ern wurde er in Interviews gerne über Alkoholexzesse und Drogeneskapaden ausgefragt, die ihn wie einen naiven Menschen erscheinen ließen. Naiv war er aber nicht, eher gutmütig und gutgläubig. Letzteres wohl gerade zu Beginn seiner Karriere viel zu sehr. Mit zunehmender Erfahrung veränderte sich dann aber auch sein Gesprächsverhalten, manchmal sogar bis hin zur „Gesprächsunwilligkeit“. Cocker hatte gelernt, mit den Medien professionell umzugehen, ließ sich nicht mehr aushorchen und verwehrte auch schon mal Interview-Anfragen wie etwa beim St. Wendeler Open Air 1989. War es in den 90er-Jahren noch häufig möglich gewesen, kurzfristig und spontan Interviews oder Kurzgespräche während Konzertreisen oder bei Verleihungen von Awards zu erhalten, war es ab den 2000ern zunehmend schwieriger geworden. Die Auflagenhöhe entschied über die Gesprächsvermittlung. Massenmedien und Medienmultiplikatoren hatten Vorrang gegenüber Einzelinterviews unbedeutenderer Gesprächspartner. Roundtables wie etwa am 18. Oktober 1991 im Kölner Hyatt, bei dem Joe Cocker mehreren Journalisten, darunter auch Eric Rauch von „promoteam.de“, gleichzeitig im Rahmen kleiner Tischgespräche Rede und Antwort stand, waren gern geführte Interview-Arten. Pressekonferenzen wie etwa im Frühjahr 1996 in Berlin für die „Beck’s – Sail Away-Tournee“ oder 2004 wegen seiner Teilnahme an der „Nokia Nights of the Proms“-Tour ergänzten die Skala der Möglichkeiten für den Erhalt von O-Tönen Cockers.
Doch egal, unter welchen Umständen ich mit Joe Cocker sprechen konnte, zumindest ab den 90ern ergab sich für mich das Bild eines – endlich – bei sich angekommenen Mannes, der mit sich und seinem Leben im Reinen war. Manchmal wirkte er noch immer gehetzt, manchmal wortkarg, manchmal redselig, aber stets höflich. Sätze wie: „Den Blues nenne ich einen Schrei nach Identität. Es ist meine einzige Gnade, meine Rettung, dass ich ihn singen kann. Den wahren Blues werden die Menschen nie satt haben. Vielleicht liegt aber auch die ganz große Zeit für den Blues erst noch vor uns“, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Sätze wie diese, selbst wenn sie sich über die Jahre wiederholen und sich auch in Interviews mit Kollegen wiederfinden, machen diese Gespräche wertvoll. „Was mich stets faszinierte, war die Kraft seiner Klänge“, sagte Joe Cocker über den Blues, und mich wiederum faszinierte der Klang seiner Stimme, als er dergestalt über den Blues philosophierte.
Sein gesprochenes Wort war der Spiegel seines gesungenen Wortes. Was immer bleibt und was seine Wirkung ausmacht, ist Joe Cockers Stimme. Immer wieder drehte sich alles nicht um seine Performance, nicht um seine Songwriter-Qualitäten, sondern immer nur um seine Stimme, die es über ein halbes Jahrhundert geschafft hat, Menschen in ihren Bann zu ziehen, ihnen den Atem zu rauben und sie emotional abzuholen.
Cocker wirkte. Cockers Bestreben nach Vielfalt und nach Entwicklung erklärte seine fortwährende Relevanz für jede nachwachsende Generation von Musikliebhabern. Joe Cocker war eben einer der ganz großen Sänger unserer Zeit. Seine Stimme war pure Naturgewalt, kraftvoll, expressiv und mit Sicherheit die eigenwilligste im weiten Rund der populären Musik. Ob Balladen, Soul-Stomper, Blues-Urgesteine oder geradlinig strukturierte Popsongs, seine Gabe, Lieder anderer Interpreten in neue Dimensionen zu bringen, machte ihn zur dauerhaft strahlenden Lichtgestalt im niemals endenden Rockzirkus.
Aber Cockers Musik lässt sich nicht wirklich definieren oder etikettieren. Cockers Musik ist eher ein Konglomerat von Klängen, die sich mit nichts, was andere Künstler in diesen Genres tun, vergleichen lässt. „Es gibt einen Grund dafür, dass die Leute die Songs hören wollen, für die man bekannt ist. Sobald die ersten Akkorde von einem Song wie ‚You Can Leave Your Hat On‘ erklingen, wird den Leuten irgendwie anders. Es fasziniert mich, auf der Bühne zu stehen und das zu beobachten. Frieden und Liebe gehen dabei Hand in Hand mit Musik, das war immer meine Philosophie. Musik hat eine heilende Kraft. Die Leute kommen zu mir und bedanken sich für Lieder, die ihnen durch schwere Zeiten geholfen haben. Als ich die Songs aufnahm, hatte ich das nicht im Sinn. Von Musik und ihrer Wirkung geht immer etwas Geheimnisvolles aus. Vielleicht verstehen wir sie erst, wenn wir in sie eintauchen und begreifen, wie sie entsteht, und lernen, wozu sie im Stande ist.“
Nichts ist wirkmächtiger als Musik, das spürte man nicht nur ab der ersten Minute eines Joe-Cocker-Konzerts. Es dauerte keinen Song, ohne dass Cocker nicht bereits wie ein Schwerstarbeiter schwitzte. Zu Beginn der 80er, als sein Körper begann, ein wenig fülliger zu werden, waren spätestens nach drei Songs sein T-Shirt und Haar schweißdurchtränkt. Und sein Publikum? Es wartete geradezu sehnsüchtig darauf, dabei zuzusehen, wie sich Cocker durch diese Klangwelten schuftete, um seinen Fans einen Weg durch seine musikalische Welt zu ebnen. So war es früher, und so war es später. Nach dem ersten Song zog Cocker, mittlerweile altersbedingt noch etwas fülliger geworden, sein Sakko aus, als würde er sich langsam so richtig an die Arbeit machen. Ab dem ersten Ton begann er das Publikum in den Bann zu ziehen. „Er verzerrt und verzieht sein Gesicht in wilden Grimassen vor Anstrengung über dem Hin und Her seiner spastischen Bewegungen und amotorischen Schritte. Er rudert mit den Armen, steht wie im Sturz, reißt winzige Fingerbewegungen und Gesten an wie Streichhölzer, reißt sich an den Haaren, reißt die Augen weit auf, als würde er gerade aus einem fürchterlichen Schlaf in fremder Landschaft aufwachen: ein Diktator der Gefühle in einem Irrgarten unerlöster Leidenschaften“, schrieb darüber der KÖLNER STADTANZEIGER und beschrieb seinen Eindruck weiter mit den Worten: „… Ein Gequälter, wie ihn Hieronymus Bosch gemalt haben könnte: mit herausgestülpter Zunge zwischen den unregelmäßigen Zähnen und einer Stimme, die ihm auch aus den Augen herauszutreten scheint. Er sieht nicht gut aus, und keine seiner Bewegungen ist elegant. Alles an ihm dient nur der spannungsvollen Verletzlichkeit der Schönheit seiner Lieder. Er singt nicht mehr, er lässt sich singen, wird gesungen von einem Gesang aus der Vorzeit der Sprache, bevor sie in ihrer jetzigen Form erkaltete. Nach dem Auftritt sackt er ausgepumpt in sich zusammen, wie zurückgelassen von einem fürchterlichen Dämon. Er wankt zur Seite, in den Schatten der Bühne. Im Dunkel der Ecke umarmen ihn die Musiker seiner Band. ‚Verdammt, ich wusste gar nicht, dass die Halle so groß ist‘, keucht er, ‚ich hatte nur ein paar hundert Leute erwartet‘, bevor ihn das Gellen der Menge zur Zugabe schon wieder hinausruft, damit er ihnen auch seinen letzten Rest noch gibt. Seine gekräuselten grauen Haare kleben ihm längst als nasse glatte Strähnen an den Schläfen, im Nacken und auf der Stirn. Und nun reißt er sich noch einmal hoch da vorne, steht noch einmal wie ein Denkmal, steht dann wieder schräg wie im Fall da, zieht den Kopf ins Hemd und kneift sein linkes Auge zu, weil er sonst den letzten hohen Ton nicht mehr erreicht: ‚You Are So Beautiful To Me.‘ Er quetscht und kaut und beißt die Töne, schindet sie so, wie sie ihn schinden, und heult in einem Lied mehr Schmerz und Zärtlichkeit aus sich heraus, als manch anderer sein Lebtag nicht aus dem Leib herauskriegt …“
Die Beschreibung einer Momentaufnahme, die Cocker mit den Worten zusammenfasste: „Es ist das, was das Publikum von mir erwartet. Würde ich es nicht so machen, wäre es nicht das, weswegen mein Publikum immer wieder kommt. Es möchte mich sterben und auferstehen sehen.“ Vielleicht ist es das, was man als „Magie“ in Cockers Stimme und Musik bezeichnen kann. „Erst wer so in die Musik eintaucht, versteht Musik“, sagte Cocker. „Erst dann begreift man, wie sie entsteht und woher sie kommt, aus den Tiefen des Inneren, und erst dann ist man in der Lage zu lernen, was sie bewirken kann.“
Eine Stimme wie die von Joe Cocker bringt auf eine spezielle Art die Luft zum Schwingen, und unser Gehirn bewertet diese zu Klängen werdenden Vibrationen als unverkennbare Musik.
Cocker aber präsentierte sie auf einzigartige Weise, die einprägsamen Strukturen und Melodien, und das nur mit seiner Stimme. Er zerlegte die Tonfolgen nicht in undurchdringbare Fragmente, er kombinierte sie nicht immer wieder neu, er schichtete nicht Instrumente übereinander. Er ebnete dem Zuhörer den Weg der Töne vom Gehör ins Gehirn, anstatt ihn in ein Labyrinth zu locken. Cocker verwendete die Struktur eines einfachen Popsongs, bei dem die typische Melodieabfolge selten länger als 30 Sekunden dauert und der mit keinen komplexen Texten aufwartet. Cocker schwieg aber auch, legte Pausen ein und offenbarte dem Zuhörer eines Liedes die Tatsache, dass ein Klang in die Tiefen der Bedeutungslosigkeiten stürzen würde, wenn es nicht sein Gegenteil gäbe: die Stille. Der imaginäre Raum ohne Vibrationen, Wellen und Schwankungen, ohne Bewertung und Orientierung. Plötzlich wird Stille zum lautesten Element, weil unser Gehirn sich danach sehnt, etwas bewerten zu können, sich orientieren zu können. Stille wird plötzlich zum mächtigsten Element der Wirkung von Musik. Es ist die Stille kurz vor dem Schrei. Die Stille kurz vor dem Falsett, also der um eine Oktave hochgestellten männlichen Sprech- oder Gesangsstimme, bei der die Stimmbänder nicht vollständig, sondern nur an ihren Rändern schwingen, wodurch ein weicher und grundtöniger Klang zustande kommt.
Joe Cockers berühmtestes Falsett ist sein Schrei in „With A Little Help From My Friends“, kurz davor wird eine Pause zur Steigerung der Stille „intoniert“. Die meisten hören den Schrei schon, bevor ihn Cocker aus sich herausholt. Die meisten kennen ihn, erwarten ihn, bewerten ihn, wie sie ihn schon immer gekannt, erwartet und bewertet haben. Sie kennen seine und ihre Geschichte, und das macht ihn vertraut. Sie kennen seinen Gesang und seine Stimme.
Der ROLLING STONE wählte 2008 Joe Cocker immerhin auf Platz 97 der weltweit besten Sänger aller Zeiten. „Es gilt, dem Song eine eigene kleine Geschmacksnote und Geschichte zu verpassen“, erläuterte Cocker sein Credo. Nicht mehr und nicht weniger. Und mit seiner ganz und gar unverwechselbaren Stimme glückte ihm das immer wieder neu …