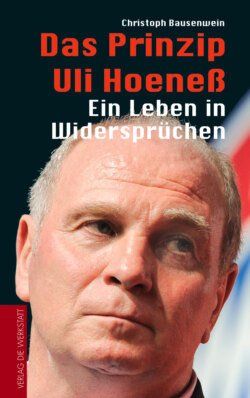Читать книгу Das Prinzip Uli Hoeneß - Christoph Bausenwein - Страница 7
ОглавлениеKAPITEL 1
Der ehrgeizige Aufsteiger
Uli Hoeneß und sein kurzer Weg auf den Gipfel
Im Sommer 1974 stand Uli Hoeneß auf dem Gipfelpunkt seiner Fußballkarriere: Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Europapokalsieger, Europameister und nun auch Weltmeister. »Ich habe ein paar Jahre hinter mir, Jahre wie im Rausch«, konnte er es selbst kaum fassen. »Ich konnte machen, was ich wollte, alles gelang mir. Das Glück verfolgte mich, und der Ball rollte mir nicht vom Fuß.« Nachdem er 1970 als Achtzehnjähriger aus seiner Heimatstadt Ulm zum FC Bayern nach München gekommen war, hatte er innerhalb von vier Jahren alles erreicht, wovon ein Fußballspieler nur träumen kann. Peter Bizer, der kurz nach dem WM-Triumph ein Buch über den jungen Himmelsstürmer veröffentlichte, sah in dessen Blitzkarriere die Konsequenz einer außergewöhnlichen Professionalität. »Der programmierte Weltmeister«, lautete der Titel, und damit wollte der Autor wohl ausdrücken, dass es sich hier nicht um einen zufällig entdeckten Straßenfußballer handelte, sondern um einen, der seine Karriere ganz gezielt vorangetrieben hatte und auf diesem Weg in sämtlichen Jugend-Auswahlmannschaften des DFB entsprechend gefördert worden war. Ob man einen Weltmeister programmieren kann, lässt sich wohl kaum schlüssig beweisen – fest steht jedoch, dass Uli Hoeneß schon von Kindesbeinen an ein festes Programm hatte.
»Ich bin ungeheuer, fast hoffnungslos ehrgeizig«, sagte der am 5. Januar 1952 als Sohn des Metzgermeisters Erwin Hoeneß und seiner Frau Paula in Ulm geborene Fußballstar immer wieder über sich selbst. Und: »Ich gehöre zu den Menschen, die absolut vermeiden wollen, ohne Ziel zu sein.« Das zeigte sich bereits im zarten Alter von sechs Jahren, als er zusammen mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder auf dem gleich gegenüber der elterlichen Metzgerei gelegenen Bolzplatz am Eselsberg kickte und dort von einigen »Spähern« des VfB Ulm entdeckt wurde. Voller Begeisterung über seine Fähigkeiten überredeten sie den Knirps, beim nächsten Schülerspiel das Trikot ihres Vereins zu tragen. So trat Uli denn an, mit falschem Pass, in einer Mannschaft, deren Spieler im Schnitt etwa vier Jahre älter waren als er. Ein Triumph wurde die Sache nicht, die anderen waren zu schlecht, und er war wegen seiner körperlichen Unterlegenheit ebenfalls nicht in der Lage, entscheidende Akzente zu setzen. »Wir verloren 2:12 und 1:8«, wusste er noch Jahre später das Desaster in genauen Zahlen auszudrücken. Andere hätte so ein Auftakt im organisierten Fußball womöglich deprimiert, nicht aber Uli Hoeneß. Er setzte alles daran, diese beiden deftigen Niederlagen schnellstmöglich wieder auszuwetzen, und tatsächlich gelang die Wiedergutmachung umgehend. »Im dritten Spiel ging es besser: ein Sieg, ich schoss mein erstes Tor«, berichtete er stolz vom ersten Schritt auf seinem Weg zum Erfolg.
Die Geschichte zeigt zwei wesentliche Aspekte im Charakter des Uli Hoeneß: das Vertrauen, sich mit Willens- und Kampfkraft auch gegen überlegene Gegner durchsetzen zu können, und die Fähigkeit, sich von Niederlagen nicht deprimieren zu lassen, sondern sie als Ansporn zu nehmen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Schon auf dem Bolzplatz hatte sich erwiesen, dass dieses junge Fußballtalent das Wort »verlieren« am liebsten gänzlich aus seinem Wortschatz gestrichen hätte. Wann immer sich die Kinder zum Kicken trafen, tat Uli alles, um den Sieg seines Teams möglichst schon im vorhinein sicherzustellen. Da kam es dann schon mal vor, dass er seinen kleinen Bruder Dieter nicht im eigenen Team mitspielen lassen wollte, weil er meinte, der Erfolg könnte dann gefährdet sein – oder er schickte ihn ins Tor, dorthin also, wo die Schwächsten beim Jungenspiel meist landen. »Dieter stand ganz klar im Schatten seines Bruders«, erzählte einer der Jungs, die damals dabei waren. Manchmal, wenn Uli seinen Bruder wegen eines haltbaren Gegentores wieder einmal zusammengeschissen hatte, flüchtete der unter Tränen vom Schauplatz des Geschehens. Beim VfB Ulm blieb die Rollenverteilung dann ganz ähnlich. Er habe »vorne die Tore geschossen«, so Uli, die der Dieter »hinten reingelassen hat«. Irgendwann hatte Dieter, der als Torwart durchaus erfolgreich war und sogar in Auswahlmannschaften berufen wurde, die Nase voll und wechselte in den Sturm.
Vorläufig blieb freilich Uli im Sturm des VfB der Platzhirsch. Noch als weltberühmter Fußballstar erzählte er gern eine Geschichte über einen sagenhaften Erfolg in seiner Jugendzeit, der für ihn beinahe noch mehr bedeutete als alle späteren Triumphe. In seiner Ulmer Pfarrgemeinde war er auf Wunsch seiner Eltern mit acht Jahren Ministrant und Mitglied der Jugendgruppe. Erwin und Paula Hoeneß achteten darauf, dass der Sohn schön brav alles mitmachte, auch jenes Zeltlager in der Nähe von Memmingen zu Pfingsten 1960. Uli war nur sehr widerwillig mitgefahren, da zur gleichen Zeit das Lokalderby seines VfB gegen den TSV Ulm 1846 angesetzt war. »Es ging um die Bezirksmeisterschaft«, erzählte er, und die zu versäumen, hätte ihn »todunglücklich« gemacht. Der Jugendleiter wollte ihn trotz allen Bittens aber nicht weglassen, und so blieb ihm nur eines: heimlich auszubüchsen. Er schwang sich auf sein Fahrrad, radelte von Memmingen nach Ulm – eine Strecke von 60 Kilometern – und kam beim Stand von 0:4 an. Schnell lieh er sich von einem Mitspieler Fußballschuhe. »In der Halbzeit wurde ich, noch verschwitzt und zittrig, eingetauscht.« Uli schoss vier Tore – und der VfB gewann am Ende mit 6:4. »Das war ein Sieg!«, schwärmte er noch als Fünfzigjähriger. Selbst seine Mutter war hernach so stolz auf ihn, dass sie ihm die heimliche Radtour nicht mehr übel nahm. »Im Gegenteil: Sie setzte mir meinen Lieblingskuchen vor, den ich mir bis heute noch nicht abgewöhnt habe: Erdbeerkuchen. Es war das einzige Mal bisher, dass ich ihn stehen ließ: Mit dem Löffel in der Hand schlief ich ein.«
Der Traum vom großen Fußball
Im Jahr 1965 verließ der dreizehnjährige Uli Hoeneß den VfB Ulm, bei dem er fast acht Jahre lang zusammen mit seinem Bruder Dieter gekickt hatte, und wechselte zum ambitionierteren Lokalrivalen TSG Ulm 1846. Am 9. Oktober desselben Jahres trat er erstmals vor großer Kulisse an: in einem Vorspiel zum Länderspiel Deutschland gegen Österreich. Uli spielte so gut, dass er anschließend für die Schülerauswahl Württembergs nominiert wurde. Es folgten die süddeutsche Auswahl und schließlich der DFB. Zielstrebig näherte er sich seinem Ziel, einmal ein berühmter Fußballprofi zu werden. Noch allerdings war es nur ein Traum. Ein Traum, den er im Sommer 1966 ganz besonders intensiv träumte. Auf Einladung eines Lehrers aus Nuneaton, den er kennen gelernt hatte, durfte er zur WM nach England fahren. Am 23. Juli sah er in Sheffield, beim 4:0 der deutschen Nationalelf gegen Uruguay, wie der Stern des späteren »Kaisers« Franz Beckenbauer aufging – und das Herz schlug ihm bis zum Hals im brennenden Wunsch, »einmal neben diesem gottbegnadeten Fußballer in einem Verein oder in der Nationalelf spielen zu können«.
Uli Hoeneß besuchte inzwischen das Schubart-Gymnasium in Ulm und erwies sich dort als sehr guter Schüler. Mutter Paula war stolz und zufrieden und hoffte, dass ihre Söhne über Abitur und Studium zu einem anerkannten Beruf und einem guten Auskommen gelangen würden. Uli hatte jedoch andere Pläne, er hatte sich den Fußball als Königsweg ausgesucht, um sich aus den kleinen Verhältnissen seines Elternhauses zu befreien. »Ich wollte nach oben, ganz klar«, bekannte er viele Jahre später als erfolgreicher Bayern-Manager in zahlreichen Interviews. »Ich wollte die soziale Leiter hochsteigen.« Schon dem Jugendlichen war klar: Er hatte Talent und im Vergleich zu den Gleichaltrigen auch eine bemerkenswerte physische Grundausstattung, aber er würde sich dennoch anstrengen müssen. Selbstkritisch gestand sich der Vierzehnjährige ein, dass er vor allem an Ausdauer und Schnelligkeit intensiv arbeiten musste. Und so ließ er sich von seinem Vater jeden Morgen um sechs Uhr wecken, um noch vor der Schule eine Stunde durch die Wälder Ulms zu rennen. Später baute der Gymnasiast das Programm noch aus. Er stand morgens um vier Uhr auf, erledigte seine Schularbeiten, eilte um sechs zum Trainingsplatz, drückte von acht bis eins die Schulbank und machte nachmittags wieder Dauerläufe. Mit achtzehn lief er die 100 Meter in elf Sekunden und wurde in Ulm Winterwaldlaufmeister über 2.000 Meter.
In dieser Zeit hatte Uli Hoeneß die Grundlage gelegt für die starke Physis, die ihn zum Weltmeister und »Jung-Siegfried« des deutschen Fußballs machen sollte. »Mir wird nachgesagt, ich sei der Mann mit der Pferdelunge«, wird der 22-jährige Hoeneß auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere äußern. »Worüber ich nicht immer so überglücklich war. Denn das klingt so nach: Der kriegt seine Gegenspieler nur durch seine schnellen Beine und durch Ausdauer klein.« Gleichwohl bekam er diesen Ruf nie ganz los. Noch in der Laudatio zum 50. Geburtstag des Bayern-Managers wird Franz Beckenbauer charmant mäkeln: »Wie er als Fußballer war? Na ja, er ist viel in den Wald gegangen, ein bisschen viel im Wald herumgelaufen. Es wäre vielleicht gescheiter gewesen, ein bisschen die Ballfertigkeit zu schulen.« Diese Kritik konnte, nach so vielen gemeinsam errungenen Erfolgen, nicht mehr böse rüberkommen. Einen wahren Kern enthielt sie dennoch. Das Pfund, das Uli Hoeneß als Fußballspieler in die Waagschale werfen konnte, war nicht eine ausgefeilte Technik, sondern er lebte in seiner gesamten Karriere vor allem von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und einer enormen Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Und dann hatte er noch eine weitere Stärke, die man auf keinem Trainingsplatz der Welt üben kann: Selbstbewusstsein und unbedingte Fixierung auf den Erfolg.
Feri Beseredi, Trainer der Jugend und später auch der 1. Mannschaft von Ulm 1846, ließ den jungen Hoeneß zunächst meist als Verteidiger spielen. Auf dieser Position, meinte er, könne er seine Stärken – Schnelligkeit, Robustheit, Kampfkraft – am besten zur Geltung bringen. Die taktische Order lautete, den Gegner im richtigen Moment mit plötzlichen Tempovorstößen in Bedrängnis zu bringen. Auf diese Weise entwickelte sich ein Reißertyp, der die gegnerischen Abwehrreihen durcheinanderwirbelte und später wegen seiner Schnelligkeit vor allem als Konterspieler gefürchtet werden sollte. Was ihm fehlte, war eine gewisse Disziplin in der Defensivarbeit. Der junge Offensivverteidiger, der seine Altersgenossen an Kraft und Größe übertraf, interpretierte seine Aufgabe oft wie ein Stürmer, und deswegen schrieb ihm Beseredi vor, immer wieder zur Trainerbank zu sehen und erst auf Anweisung nach vorne zu gehen. Mit sechzehn trainierte der frühreife Schüler bereits bei den Erwachsenen, als Siebzehnjähriger kickte er mit einer Sondergenehmigung für die erste Mannschaft. Beseredi: »Da war sofort ein neuer Wind in der Mannschaft, die Alten haben sich an ihm ein Beispiel genommen. Die standen oft schon unter der Dusche, da trainierte der Uli immer noch am Kopfballpendel.«
Zu diesem Zeitpunkt war das Talent aus Ulm schon längst beim DFB aufgefallen. Nach Lehrgängen in Frankfurt, Heilbronn und Hamburg war der DFB-Trainer Udo Lattek von dem Neuling so begeistert, dass er ihn gleich zum Kapitän der Schüler-Nationalmannschaft bestimmte: Der Junge habe nicht nur sportliches Talent, er sei zudem »schon eine richtige Persönlichkeit«. Wie zuvor Beseredi zeigte er sich begeistert, dass der Nachwuchsspieler trotz seiner jungen Jahre schon genau wusste, was er wollte. Im April 1967 gab es gegen die Auswahl Englands den ersten großen Auftritt für Uli Hoeneß, Schauplatz war das Berliner Olympiastadion. Solche Spiele waren damals noch eine Seltenheit – die Schüler-Nationalmannschaft spielte zu dieser Zeit nur ein- bis zweimal jährlich gegen britische Mannschaften – und fanden daher als Nachwuchsschau auch bei Journalisten eine gewisse Beachtung. Bei dem überragenden 6:0-Sieg des deutschen Teams wurde aus dem fünfzehnjährigen Schüler Hoeneß über Nacht ein bejubelter Nachwuchsstar. »Ein Haller im Taschenformat«, überschrieb die »Berliner Zeitung« ihren Spielbericht unter Bezugnahme auf den bekannten Nationalspieler aus Augsburg, der 1966 mit Deutschland im Wembley-Stadion Vize-Weltmeister geworden war. »Mit zwei wunderbaren Alleingängen brachte der Halbrechte Uli Hoeneß die deutsche Schüler-Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion auf die Bahn ihres 6:0-Sieges über England. In der 3. und in der 25. Minute spazierte der blonde Jüngling von Ulm 1846 vom Mittelfeld aus mit geschickten Körpertäuschungen durch die ganze englische Abwehr und ließ auch Torhüter Cuff keine Chance.« Eine Sportzeitung kommentierte: »In ein paar Jahren ist dieser Gymnasiast der Star eines Ligateams, wenn nicht der Nationalelf, oder wir werden nie wieder eine Voraussage wagen.« Tore in dieser Art, meist als Konter vorgetragen, sollte Hoeneß später noch öfter schießen; unwiderstehliche Sololäufe, kaltblütig abgeschlossen, wurden geradezu sein Markenzeichen.
Am 22. September 1968 gab der »Haller im Taschenformat« nach drei Schüler-Länderspielen sein Debüt in der Jugendnationalmannschaft, für die er insgesamt 17-mal antrat. Als sich das Jugendteam des DFB im Januar 1969 in einem israelischen Kibbuz auf die Qualifikation zur Europameisterschaft in der DDR vorbereitete, berichtete der Hobby-Journalist Hoeneß in der »Südwest-Presse« voller Stolz von den im Trainingslager herrschenden »Profibedingungen«. Beim EM-Turnier selbst durften sich die von Autogrammjägern und Spähern der Bundesligavereine umlagerten Spieler bereits wie Stars fühlen. Udo Lattek lasse die Anrufe interessierter Bundesligavereine abfangen, klärte Hoeneß die Leser seiner Heimatzeitung auf, zudem sei ein striktes »Redeverbot über Gelder und Gehälter« verhängt. Die Jugendspieler durften vom künftigen Ruhm träumen, der Erfolg indes blieb zunächst noch aus. Es setzte Niederlagen gegen Bulgarien und Frankreich, nur gegen Spanien gelang ein 2:1-Sieg, zu dem Hoeneß einen für ihn eher untypischen Kopfballtreffer beisteuerte. Das Turnier war kein Erfolg, doch das hinderte den Berichterstatter der »Südwest-Presse« nicht, in großen Tönen über das Ereignis zu schwadronieren. »In unserem letzten Spiel gegen Spanien«, schrieb Uli Hoeneß, »empfingen uns 20.000 Zuschauer mit großem Applaus – im Gegensatz zu unseren Funktionären. Als mir das 1:0 mit einem Kopfballtor gelang, schien das Stadion zu bersten. Nach unserem 2:1-Sieg erreichte die Begeisterung ihren Höhepunkt. Von einer jubelnden Menge wurden wir zur Kabine geschoben. Wildfremde Menschen umarmten mich, rissen mir zunächst die Spielführerbinde vom Arm und schließlich das Trikot vom Leibe. Auch im Umgang mit den Spielern aus der DDR machten wir nur gute Erfahrungen. Heimlich kamen sie auf unsere Zimmer und unterhielten sich mit uns über die Verhältnisse in der Bundesrepublik. Sie waren freundlich und verbargen ihre Sympathien für den Westen keineswegs, obwohl sie es eigentlich drüben recht gut haben. Wenn wir auch sportlich nicht wie erwartet abgeschnitten haben, so haben wir durch unseren Sport vielleicht mehr erreicht als so mancher Politiker zuvor.«
Der Status des Stars auf dem Rasen strahlte inzwischen bis ins Klassenzimmer aus. Am Schubart-Gymnasium in Ulm galt er als großer Held. Es kam sogar vor, dass der Unterricht unterbrochen wurde, wenn er vormittags für Deutschland spielte, damit die ganze Klasse sich das Spiel anschauen konnte, und wenn er eine Prüfung verpasste, wurden ihm großzügig Nachholtermine gewährt. Trotz seiner Sonderstellung war der Vorzeigeschüler durch seine Lebensgestaltung aber auch ein Außenseiter. »Training, Schule, Spiele, Training, Schule«, beschrieb Hoeneß seinen monotonen Stundenplan. »Dazu: kein Tropfen Alkohol, keine Zigaretten, keine verbummelte Nacht. Das ist mein Leben. Das Leben eines Profis.« Es war ein eintöniges, entbehrungsreiches Leben, das zuweilen Anlass zum Jammern gab. »Wenn meine Klassenkameraden mit ihren Freundinnen ins Kino oder zum Baden gingen und ich einsame Runden auf dem Fußballplatz drehte – da habe ich oft gedacht: Wofür? Ich habe nie das unbeschwerte, das sorglose Leben meiner gleichaltrigen Freunde gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, zum Beispiel Zeit zum Tanzen zu haben, für eine Diskothek, für ein Wochenende im Gebirge oder an der See.« Noch als erfolgreicher und gut verdienender Profi trauerte er der verlorenen Zeit der Unabhängigkeit und des In-den-Tag-hinein-Lebens nach. Das viele Geld sei zwar eine gewisse Entschädigung für all die auferlegten Reglementierungen, ob das aber all das ersetzen könne, was man versäumt hat, meinte er nachdenklich, »da bin ich mir nicht so sicher«.
Bayern-Spieler und Olympia-Amateur
Zu Beginn des Jahres 1970 fusionierten die Vereine SSV und 1846 zum SSV Ulm 1846, der nun den Aufstieg in die damalige Regionalliga Süd anstrebte. Uli Hoeneß war nicht abgeneigt, noch ein Jahr in Ulm zu bleiben, um sich ganz in Ruhe für das beste Angebot aus der Bundesliga zu entscheiden. Der DFB-Jugendnationalspieler, der inzwischen auch in der für die anstehenden Olympischen Spiele gebildeten Amateur-Nationalmannschaft auflief, war heiß begehrt. Im Hause Hoeneß ging es zu wie in einem Taubenschlag. Mehr als zehn Bundesligavereine – darunter Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin, der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg und 1860 München – hatten Vermittler ausgeschickt, um mit dem Nachwuchsstar und seinen Eltern zu verhandeln. Der Achtzehnjährige hatte bereits sehr genaue und konkrete Vorstellungen von seiner Zukunft. Den Vereinsvertretern erläuterte er, dass er Olympia-Amateur bleiben und nebenbei ein Anglistik-Studium betreiben wolle und dass er zur Sicherung seines Lebensunterhaltes im Verein gerne einen Job als kaufmännischer Angestellter hätte. Solche Ideen waren zu einer Zeit, als man Fußballer als dumpfe Proletarier wahrnahm, für die der Sport ihre einzige Aufstiegsmöglichkeit war, vollkommen ungewohnt. Der Gymnasiast aus Ulm gehörte einer Generation an, die im Fußball vor allem eine Karrieremöglichkeit sah, die man ganz bewusst planen konnte. Es war aber offensichtlich nicht so einfach, Hoeneß’ Vorstellungen und die der interessierten Vereine unter einen Hut zu bringen. Manche Unterhändler tauchten mehrmals bei der Familie Hoeneß in Ulm auf, aber eine Entscheidung wollte nicht fallen. Und dann ging alles plötzlich doch noch ganz schnell.
»Schon beim letzten Jugendländerspiel 1969 in Einbeck gegen Dänemark hatte mich unser damaliger Trainer Udo Lattek beiseite genommen und mir empfohlen, mich vorerst nirgends zu binden«, erläuterte Hoeneß sein zögerliches Verhalten. Kurz darauf rief der Bayern-Manager Robert Schwan im Hause Hoeneß an, erklärte, dass Udo Lattek als neuer Trainer der Münchner verpflichtet sei, und kündigte seinen Besuch für den nächsten Tag an. Schwan kam, und der Umworbene war sofort begeistert. »Er hielt keine langen Vorträge oder versprach mir das Blaue vom Himmel herunter. Er sagte nur: Die Chancen für mich stünden gut, da der FC Bayern einen Neuaufbau um die Stützen der Mannschaft – Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Roth und Hans-Georg Schwarzenbeck – im Sinn habe.« Das waren fünf große und berühmte Namen, Nationalspieler allesamt, die im Dress der »Roten« 1967 den Europacup der Pokalsieger und 1969 die Deutsche Meisterschaft errungen hatten. Die Erfüllung des großen Traums, den er bei der WM in England geträumt hatte – einmal neben einem Franz Beckenbauer auf dem Platz zu stehen –, war zum Greifen nah. Diese Stars also würden bald seine Mitspieler sein: der kurzbeinige Mittelstürmer Gerd Müller mit der eingebauten Torgarantie, dessen rasche Auffassungsgabe auf dem Platz im eigenartigen Kontrast stand zu seinem etwas trägen Gemüt; der katzengewandte Torwart Sepp Maier, der stets den Kasper spielte, aber in Wahrheit immer viel ernster war, als es schien; der ebenso bissige wie stämmige Mittelfeld-Rackerer »Bulle« Roth, vor dessen hartem Schuss jeder Gegner zitterte; der eckige Vorstopper »Katsche« Schwarzenbeck, der stets bescheiden bleibend die Drecksarbeit für den »Kaiser« Beckenbauer verrichtete; und schließlich Beckenbauer selbst, der mit seiner eleganten Interpretation des Liberos erfolgreich dem Vorurteil entgegenkickte, in Deutschland bestehe der Fußball nur aus Blut, Schweiß und Tränen. Uli Hoeneß brauchte nicht viel Imagination, um sich selbst, in der Rolle des im Sturm sprintenden Jung-Siegfried, in dieser Reihe zu sehen. Schwan meinte, dass man ihm einiges zutraue, warnte aber auch: »Durchbeißen müssen Sie sich selbst.«
Die klare Sprache des damals 48 Jahre alten Bayern-Managers imponierte Hoeneß. Schwan war im Vergleich zu den eher dilettantisch agierenden Männern in den Führungsgremien anderer Vereine ein absoluter Profi. Der frühere Gemüsehändler und Abteilungsleiter bei einer Versicherung war 1964 als ehrenamtlicher Spielausschuss-Vorsitzender zum FC Bayern gekommen. Zwei Jahre später hatte der stets gut gekleidete Pfeifenraucher aus dem ehrenamtlichen Posten ein Geschäft gemacht, war zum ersten hauptamtlichen Manager im deutschen Fußball und zugleich Beckenbauers persönlicher Betreuer geworden. Schwan schloss für seinen Schützling hochdotierte Werbeverträge ab und sorgte damit für den Aufstieg des »Kaisers« zum Weltstar und Fußball-Millionär, was sich durch lukrative Provisionen – Schwan wurde »Mister 20 Prozent« genannt – auch für ihn selbst durchaus lohnte. Kein Wunder also, dass sich der für sein Alter enorm professionelle Hoeneß von so einem Mann angezogen fühlte und den entscheidenden Tag fest in seinem Gedächtnis einspeicherte. »Es waren noch 48 Tage bis zum Mathe-Abitur. Ich bekam gerade eine Nachhilfestunde, als Robert Schwan kam. Er hat geduldig gewartet, bis die Stunde zu Ende war. Dann habe ich den Vertrag unterschrieben, obwohl eigentlich der Hamburger SV mein Lieblingsverein war.«
Die Ulmer kassierten eine Ablösesumme von 40.000 DM, Hoeneß, der damals als Schüler monatlich über 50 Mark Taschengeld verfügte, erhielt angeblich einen nagelneuen BMW 2002 und dazu einen dicken Scheck. Der Neu-Bayer bestritt indes stets, dass ihn irgendwelche Geschenke in seiner Entscheidung beeinflusst hätten. »Es passte in die Klischeevorstellung, dass ich die materiell verführerischsten Angebote sortiert und natürlich spontan beim FC Bayern zugegriffen habe. Aber der Schein trog. ›Weichgemacht‹ haben mich weder Barscheck noch Auto, sondern der Verhandlungsstil.« So wurde er also als Olympia-Amateur ein Angestellter in der Bayern-Geschäftsstelle. Dort war er, wie Bayern-Präsident Neudecker der Presse erläuterte, für die Frankiermaschine verantwortlich. Sein Gehalt betrug 2.000 DM brutto. »Bei anderen Klubs«, so Hoeneß, »hätte ich offen gestanden – und unversteuert unterm Ladentisch – mehr verdienen können. Aber in diesem Moment zählte es für mich nicht.« Es zählte nicht, weil er ehrgeizig – »ungeheuer, fast hoffnungslos ehrgeizig« – und überzeugt war, seine Karriere in dem jungen Bayern-Team um den Superstar Beckenbauer am besten vorantreiben zu können.
Eine Sportillustrierte, der dieser Arbeitsvertrag des Frankiermaschinen-Bedieners im Bayern-Trikot nicht ganz unberechtigt etwas zweifelhaft erschien, höhnte von einem Amateur »Honoris Cassa«. Den Kritisierten indes focht das nicht an. »Ich bin ein ebenso guter Amateur wie viele andere und ein besserer als die alpinen Skifahrer, denn ich mache für keine Firma Reklame«, rechtfertigte er sich. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in München war für ihn ein Herzenswunsch, und er war schon beinahe beleidigt, wenn die Aufrichtigkeit seiner olympischen Gesinnung in Zweifel gezogen wurde. »Ich habe mich entschieden, Amateur zu bleiben, weil ich ins Stadion einmarschieren will, weil ich im olympischen Dorf wohnen und dort berühmte Sportler kennen lernen will, die ich sonst nie mehr im Leben zu Gesicht bekommen werde. Das klingt etwas idealistisch, aber für mich ist das Grund genug.« Nicht ganz so idealistisch klangen die Hintergedanken, die er in einem Interview mit der »Welt am Sonntag« offenbarte. »Als ich mich verpflichtete, bis zur Olympiade Amateur zu bleiben, tat ich es spontan, weil mich die Kameradschaft in der Amateur-Nationalmannschaft für die Sache freut. Ich hoffe, dass mir mein Entschluss Popularität eingebracht hat und noch mehr einbringen wird. Ich hoffe, dass er sich nach den Spielen auch auszahlen wird.« Mit anderen Worten: Der »idealistische« Einsatz als Amateur sollte sich letztendlich doch in klingende Münze umsetzen, sollte am Ende wohl sogar noch lukrativer sein als der direkte Weg in den bezahlten Fußball.
Neben dem Fußball wollte Hoeneß studieren. Zunächst hatte er noch Betriebswirtschaft geplant, sich dann aber, als dort kein Platz frei war, für ein Lehramtsstudium in Anglistik und Geschichte entschieden. Ein studierender Fußballspieler war damals eine kleine Sensation. Noch vor Beginn der Saison 1970/71 brachte der »Kicker« eine Story über Hoeneß mit dem Titel »Studium als Stimulans«. Auf die Frage, ob es für den »aufgeweckten Blondschopf« nicht ein Handicap sei, dass er neben seiner harten Profiarbeit sein Studium absolvieren müsse, antwortete dieser: »Im Gegenteil, ich brauche geradezu mein Studium als Stimulans für den Fußball. Es wäre schrecklich für mich, wenn ich als ›Nur-Fußballprofi‹ leben müsste. Meine Leistung würde sogar darunter leiden.«
Uli Hoeneß war der Prototyp einer neuen Spielergeneration und der FC Bayern der Verein, der den neuen Zeitgeist und die gesellschaftliche Fortentwicklung des Fußballs am deutlichsten dokumentierte. Kein anderer Bundesligist konnte sich Anfang der siebziger Jahre auch nur annähernd so vieler Abiturienten rühmen wie der FC Bayern: Karl-Heinz »Charly« Mrosko, der spätere Rechtsanwalt, Rainer Zobel, Edgar Schneider, Jürgen Ey und natürlich Paul Breitner, der in München Pädagogik studierte, standen für einen sozialen Machtwechsel im deutschen Spitzenfußball. »Uli Hoeneß zählt zur neuen Generation des Fußballprofis«, schrieb der »Kicker« später, »obwohl er bis 1972 Amateur bleiben und erst dann Geld verdienen will.« Es sei nicht verwunderlich, so das Blatt weiter, dass »die jungen Intellektuellen« beim FC Bayern unter Trainer Udo Lattek zusammengefunden hätten, »der einst selbst das Abitur ablegte, ehe er Sport und Englisch studierte«. Hoeneß selbst zitierte die Zeitschrift mit dem Satz: »Die heutige Art, Fußball zu spielen, setzt eine gewisse Intelligenz voraus.« Die Ära der Analphabeten sei vorbei, erklärte er nachdrücklich, wer heute in der Bundesliga weiterkommen wolle, benötige Köpfchen. »Spieler, die nur rennen, kommen entweder nie über ein Mittelmaß hinaus oder verschwinden bald wieder in der Versenkung.«
Unruhe im Reich des »Kaisers«
Mit Mittelmaß wollte sich auch der neue Bayern-Trainer nicht aufhalten. Der bis dahin ziemlich unbekannte Udo Lattek hatte sein Engagement nicht zuletzt der Empfehlung Franz Beckenbauers zu verdanken, der ihn als Assistenten von Bundestrainer Helmut Schön kennen und schätzen gelernt hatte. »Er war freundlich, souverän, nicht anbiedernd«, so das Urteil Beckenbauers, »was bei Assistenten nicht selbstverständlich ist. Viele holen sich ihre Bestätigung durch eine verschwörerische Kumpelhaftigkeit, versuchen, sich durch Gefälligkeiten eine gewisse Wertschätzung zu erwerben. Lattek hatte nichts davon an sich, er war geradlinig, ehrlich, selbstbewusst. Als Fußballer entwickelt man – und ich weiß, es geht nicht nur mir so – ein Gespür für Siegertypen, die vieles dem Willen zum Erfolg unterordnen, manche sogar alles. Bei Udo Lattek hatte ich das Gefühl.« Der damals erst 35 Jahre alte Trainer war weniger als Übungsleiter gefragt denn als Motivator. Beckenbauer: »Wir Bayern waren damals eine Supertruppe, aber irgendwer musste sie schließlich bei Laune halten.«
Da Bayern-Präsident Neudecker mit Latteks Vorgänger, dem eigensinnigen Branco Zebec, schon seit geraumer Zeit nicht mehr gut konnte, war es nicht sonderlich erstaunlich, dass das Engagement des Neuen nach einer kleinen Misserfolgsserie des Alten früher als geplant begann. Zebec wurde am 13. März 1970 vorzeitig entlassen, nur einen Tag später gab Lattek sein Debüt. Aus den verbleibenden sieben Begegnungen holte der ehemalige Jugendtrainer des DFB elf von 14 möglichen Punkten und Platz zwei in der Gesamtabrechnung. Das war der Beginn der erfolgreichsten Ära in der Geschichte des FC Bayern München.
Die dringlichste Aufgabe des neuen Trainers vor der neuen Saison bestand darin, eine neue Stammformation zu bilden. Insbesondere galt es, für die beiden langjährigen Leistungsträger Rainer Ohlhauser und Werner Olk, die sich ins »Rentnerparadies« Schweiz verabschiedet hatten, tauglichen Ersatz zu finden, und Kandidaten dafür waren die beiden Jugendnationalspieler Uli Hoeneß und Paul Breitner. Der erste Eindruck von den beiden war überragend. »Überraschend, wie die Spieler, die im Vorjahr noch in der DFB-Jugendauswahl kickten, die Strapazen überstanden«, berichtete der »Kicker« aus dem Trainingslager der Bayern. »Hoeneß und Breitner hielten mit, als hätten sie schon immer unter Profibedingungen trainiert. Hoeneß, der wie sein Freund Paul Breitner körperlich voll da ist, entwickelt gewaltigen Ehrgeiz.« Und den Ehrgeizling zitierte die Fachzeitschrift mit den Worten: »Jetzt muss man sich einen Platz in der Mannschaft erkämpfen. Auf eventuelle Verletzungen zu warten, um dranzukommen, darauf verlasse ich mich nicht.« Voller Selbstbewusstsein erklärte er darüber hinaus, keine Vorbilder zu benötigen. »Jemanden zu kopieren heißt, die eigenen Vorzüge zu zerstören«, dozierte er etwas altklug. »Man sollte so spielen, wie es einem in die Beine gegeben ist.«
Der Neuling aus Ulm dachte nicht daran, sich zu verstecken. Er forderte seinen Platz und zeigte sich selbst nach einer mäßigen Leistung in einem Vorbereitungsspiel keineswegs bescheiden. »Ich musste die mir etwas ungewohnte Rolle des Rechtsaußen übernehmen, weil Erich Maas einen Dämpfer bekommen sollte«, begründete er seine schwache Vorstellung und machte sich damit gleichzeitig bei einem Mitspieler unbeliebt. Selbst vor den Größen in der Mannschaft zeigte er keinerlei Respekt. »Der Gerd hat ganz ordentlich gespielt«, meinte er einmal nach dem Abpfiff zur Leistung des »Bombers« Müller, und über die Arbeitsauffassung seines Kapitäns witzelte er: »Der Franz Beckenbauer ist schon ein Garant dafür, dass es im Training nicht zu hart zur Sache geht.« Solche kessen Sprüche des von der »Welt am Sonntag« als »Klassenbester des DFB« titulierten Nachwuchsstürmers störten bald den Frieden in der Mannschaft. »Besonders in der ersten Zeit bei Bayern München war sein übertriebenes Selbstbewusstsein recht unangenehm für seine Umgebung«, kommentierte Lattek das vorwitzige Verhalten seine Schützlings. »Damit kompensierte er seine Sorgen. Das kam in der Mannschaft gar nicht gut an.«
Ebenso wenig passte der Mannschaft zudem das enge Verhältnis des neuen Trainers zu seinem Schützling, den er ja bereits in der DFB-Jugendauswahl betreut hatte. Bissige Bemerkungen machten die Runde. Er sei der »Mann mit dem Linksblick«, hieß es zum Beispiel, weil er nach jeder Aktion über die linke Schulter verstohlen Richtung Trainerbank schiele, oder er wurde hinter vorgehaltener Hand als »Schoßkind« bespöttelt, das noch mit 50 Jahren einen Stammplatz sicher habe. Vor allem Franz Beckenbauer hatte so seine Probleme mit dem nassforschen Neuling, der sich weder unter- noch einordnen wollte. »Er glaubt, die Welt dreht sich um seinen Nabel«, bemerkte er einmal kopfschüttelnd. Als Hoeneß im Fernsehen durchblicken ließ, dass man seinen Wert bei den Bayern nicht zu schätzen wisse und es genügend andere interessante Vereine gebe, fuhr der »Kaiser« schließlich aus der Haut: Wenn er sich in diesem Alter so viel herausgenommen hätte, dann wäre man mit ihm Schlitten gefahren. Uli solle endlich mal zur Ruhe kommen. Oder verschwinden. Schließlich seien die Bayern auch ohne ihn Europapokalsieger geworden und Deutscher Meister.
Das Betriebsklima war also nicht das allerbeste, und Uli Hoeneß war nicht der Einzige, der bei seinen Mitspielern schlecht ankam: Paul Breitner gab sich ähnlich frech, ehrgeizig und selbstbewusst. Udo Lattek und Manager Schwan wollten schließlich nicht mehr länger zusehen und beriefen in der Sportschule Grünwald eine große Aussprache ein. Uli Hoeneß’ Bericht über die Zusammenkunft fiel sehr knapp aus: »Jeder sollte seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Danach war der Burgfrieden wiederhergestellt, wenn auch auf Kosten einiger Mannschaftskollegen, die zum Saisonende verkauft wurden.« Dieses erste Jahr bei den Bayern war die wohl kritischste Phase seiner Laufbahn. Seine Karriere hätte wohl niemals so steil nach oben führen können, wäre er damals bei den Bayern gescheitert. »Meine Lektion von damals«, resümierte er: »Ich habe es mir abgewöhnt, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.« Uli Hoeneß und Paul Breitner blieben auch nach dieser Aussprache ein spezielles Pärchen, doch ihr Verhältnis zu den etablierten Spielern um den Mannschaftskapitän Beckenbauer wurde nun allmählich freundschaftlicher.
Die Protektion durch Udo Lattek war für den jungen Nachwuchsspieler aus Ulm in seinen ersten Wochen bei den Bayern eine Last, zugleich aber auch die Lösung seiner Probleme. »Ohne Lattek«, sollte Uli Hoeneß später voller Dankbarkeit äußern, »wäre ich vor die Hunde gegangen.« Um dem Vorwurf der Begünstigung entgegenzuwirken, nahm ihn der ehemalige DFB-Jugendtrainer besonders hart ran. Er brüllte ihn so oft an wie keinen Zweiten, aber zugleich stellte er sich immer wieder schützend vor ihn. »Es gibt keinen Spieler, mit dem ich so unbarmherzig war«, resümierte Lattek. »Er hat von mir immer wieder eins auf den Deckel bekommen, aber ich habe ihn genauso gegen ungerechtfertigte Angriffe verteidigt.« Und obwohl Lattek mit Hoeneß’ Spielweise noch nicht rundum zufrieden war – insbesondere kritisierte er seine Neigung, sich vom Gegner zu leicht abdrängen zu lassen –, hielt er zu ihm und stellte ihn, gegen den Widerstand der Mannschaft, immer wieder auf. »Anderenfalls wäre er untergegangen«, begründete er seine Haltung. »Uli ist ein Glückskind des Fußballs, er war von jeher so verwöhnt, dass er einen Misserfolg nicht überwunden hätte.« Lattek wusste: Hinter der Maske des offensiv zur Schau getragenen Selbstbewusstseins steckte ein verletzlicher junger Mann.
Zu einer zweiten wichtigen Bezugsperson beim FC Bayern entwickelte sich im Lauf der Zeit Robert Schwan. Einerseits dämpfte der wegen seiner Arroganz gefürchtete Manager die Aufmüpfigkeit der jungen Wilden Hoeneß und Breitner immer wieder, etwa durch den bei Reisen zu Auswärtsspielen üblichen Routinebefehl: »Halt, die Koffer bleiben stehen. Die tragen der Hoeneß und der Breitner.« Andererseits hatte er für die beiden, die er nur als »die Wildschweine« oder »die Gürteltiere« bezeichnete, eine besonderere Wertschätzung, insbesondere für Uli Hoeneß. Dessen intellektuelle Qualitäten hatte Schwan rasch erkannt, und er spürte wohl, dass in dem jungen Mann mehr steckte als nur ein Fußballspieler. Der Student wurde ein bevorzugter Gesprächspartner des Managers, der ihn allmählich über alle Fragen des Fußballgeschäfts aufklärte.
Die ersten Titel und Erfolge
Hoeneß’ Verunsicherungsphase dauerte nicht lange. Noch im Laufe seiner ersten Saison fand er zu einer tollen Form, die viele Journalisten schwärmen ließ. Am 8. Februar 1971 kam er erstmals auf das Titelblatt des »Kicker«, die Schlagzeile lautete: »Bayerns bester Kauf: Der Aufstieg des Uli Hoeneß.« Am Ende der Saison hatte es der offensive Mittelfeldspieler auf 31 Einsätze und sechs Tore gebracht, die Bayern waren knapp hinter Borussia Mönchengladbach auf Rang zwei gelandet. Im DFB-Pokal gab es dann den ersten Titel für Uli Hoeneß: Beim Finale am 19. Juni 1971 besiegten die Bayern im Stuttgarter Neckarstadion den 1. FC Köln in der Verlängerung mit 2:1. Und am 3. November 1971 sorgte der »Jung-Siegfried« im Trikot des FC Bayern erstmals international für Aufsehen. Es war das Rückspiel im Achtelfinale des Europacups der Pokalsieger gegen den berühmten FC Liverpool. Auf der Insel hatte man dem Gegner ein respektables 0:0 abgetrotzt, und nun gab es im Stadion an der Grünwalder Straße ein fulminantes 3:1. Neben dem erneut in bekannter Manier treffsicheren Müller, der eine 2:0-Führung herausschoss, glänzte insbesondere der wieselflinke Hoeneß. Ein ums andere Mal entfleuchte er seinen Bewachern, und in der 57. Minute hämmerte er den Ball in vollem Lauf aus spitzem Winkel zum Endstand ins Netz.
Der Amateurnationalspieler, der bei den Profis spielte, debütierte noch vor Olympia in der »richtigen« Nationalmannschaft. Bei diesem 2:0 gegen Ungarn in Budapest am 29. März 1972 teilten sich die beiden Newcomer des FC Bayern München den Sieg: Hoeneß 1:0, Breitner 2:0. Beide waren dann auch beim berühmten 3:1 gegen England im Wembley-Stadion von London dabei, dem ersten Sieg einer deutschen Nationalmannschaft im Mutterland des Fußballs. Hoeneß, der mit seinen Bayern eben erst im Halbfinale des Pokalsieger-Cups gegen die Glasgow Rangers gescheitert war, hatte Glück, zu diesem Viertelfinal-Hinspiel der laufenden Europameisterschaft überhaupt berufen worden zu sein: Wegen zahlreicher Sperren infolge des Bundesligaskandals waren einige der etablierten Nationalspieler ausgefallen. Und Hoeneß, der an diesem denkwürdigen 29. April so kraftvoll und entschlossen wie nie zuvor spielte, erzielte im zweiten Länderspiel seiner Karriere auch gleich seinen zweiten Treffer. Es läuft die 26. Minute: Dem Engländer Bobby Moore, einem der Helden des Endspiels von 1966, misslingt ein Pass, der Offenbacher Siggi Held sichert sich den Ball, läuft quer durch die englische Hälfte und passt zu dem an der Strafraumgrenze lauernden Uli Hoeneß. Der zieht aus der Drehung ab, der Ball wird noch vom Rücken eines Verteidigers abgefälscht, Banks streckt sich vergeblich – Tor. »Ich war in einem Freudentaumel«, konnte der Torschütze sein Glück kaum begreifen, und der »Kicker« jubelte: »Der Münchner ist ein Diamant!«
Aufgrund seiner ausgezeichneten Leistung beim epochalen Sieg in Wembley hatte der junge Nationalspieler nun bei seinen Verhandlungen mit den Bayern allerbeste Karten. Im Poker um bessere Konditionen drohte er mit einem Verein, der, anders als die international geforderten Bayern, nur jeden Samstag antritt; dann hätte er nämlich Zeit für sein Studium. »Natürlich werde ich zuerst mit Herrn Neudecker sprechen, aber ich bin nach wie vor nach allen Seiten offen. Mich bindet viel an den FC Bayern, und wir haben einen Trainer, dem ich fast alles verdanke. Udo Lattek hat an mir festgehalten, als mich alle aus der Mannschaft haben wollten. Ohne ihn wäre ich nie nach Wembley gekommen.« Uli Hoeneß unterschrieb schließlich einen neuen Vertrag bei den Bayern, und er blieb auch in der Nationalmannschaft gesetzt. Dort lief es für ihn nun schlechter; sowohl beim 0:0 gegen die Engländer im Viertelfinal-Rückspiel wie beim 2:1 im Halbfinale gegen Belgien blieb er trotz gewohnt großen Laufpensums ohne echte Wirkung, oft kam er einen Schritt zu spät. Ähnlich war es auch beim 4:1 gegen die Sowjetunion, dem Freundschaftsspiel zur Einweihung des Olympiastadions in München. Beim 3:0 hatten Müller und er synchron ein Bein nach dem Ball gestreckt, der Torhüter Rudakow aus den Händen geflutscht war. Hoeneß riss die Arme empor und setzte zu einer Jubelrunde an, Sekunden später tauchte sein Name auf der Anzeigetafel auf. Wie dann die Zeitlupe verriet, hatte Müller den Ball zuletzt berührt; und während der »Bomber« nachträglich als Torschütze gelistet wurde, machte Hoeneß unrühmliche Schlagzeilen als »Toreklau«.
Am 18. Juni, im Europameisterschaftsfinale in Brüssel, war erneut die Sowjetunion der Gegner, und erneut hatte sie der groß auftrumpfenden DFB-Elf, in der Uli Hoeneß sich als unermüdlicher Kämpfer auszeichnete, kaum etwas entgegenzusetzen. Deutschland gewann in beeindruckendem Stil mit 3:0 und wurde Europameister. »Die gesamten letzten Monate waren Traummonate für mich als Trainer«, sagte ein überglücklicher Bundestrainer Helmut Schön. »Mit solchen Spielern zu arbeiten, das macht einfach glücklich.«
Nur zehn Tage nach dem EM-Triumph des Teams, das als beste deutsche Nationalelf aller Zeiten in die Geschichte einging, gewann Uli Hoeneß seinen zweiten Vereinstitel. Nach dem 33. Spieltag der Saison 1971/72 führten die Bayern die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Schalkern an, die am letzten Spieltag, gleichsam zu einem Finale, noch nach München mussten. Es war das erste Bayern-Spiel im Olympiastadion, das mit 80.000 Zuschauern ausverkauft war und dem Verein die erste Millioneneinnahme seiner Geschichte bescherte. Die »Roten« spielten grandios auf und schlugen die »Königsblauen« mit 5:1. Hoeneß’ Treffer zum 4:1 war das Tor Nr. 100 der Bayern in dieser überragenden Saison, in der sie insgesamt 101 Tore schossen und Schalke zwar nur um drei Punkte, aber um 22 Tore übertrafen. Das Sturm-Tandem Gerd Müller (40 Tore) und Uli Hoeneß (13 Tore) hatte mit 53 Toren einen Rekord aufgestellt, der erst 2008/09 von dem Wolfsburger Duo Grafite/Dzeko um einen Treffer überboten werden sollte.
Keine Medaille, aber eine schöne Zeit
Die Triumphe bei der Europameisterschaft und in der Bundesliga waren Uli Hoeneß, der ja nach wie vor als Amateur firmierte, noch nicht genug. Nun wollte er auch noch mit der Amateur-Nationalmannschaft, für die er als Siebzehnjähriger debütiert hatte, bei den Olympischen Spielen in München nach »Gold« greifen. Trainer Jupp Derwall hatte für den Bayern-Star eine Führungsrolle vorgesehen, doch das olympische Fußballturnier lief dann sowohl für Uli Hoeneß wie für das deutsche Team äußerst enttäuschend. Schon ein Vorbereitungsspiel in Flensburg gegen Schweden, das mit 1:5 verloren ging, ließ Böses erahnen. Der Nationalspieler, zuvor noch jubelnd begrüßt, wurde mit Pfiffen verabschiedet. Im August war die Derwall-Elf bei Olympia zunächst erfolgreich, allerdings ohne wesentliche Mithilfe des im Bayern-Trikot so erfolgreichen Stürmers. 13 Tore gab es in der Vorrunde gegen namenlose Gegner wie Malaysia, Marokko und die USA, doch keines ging auf das Konto von Uli Hoeneß, der zudem nach einem indisponierten und undisziplinierten Auftritt im ersten Spiel vorübergehend auf die Bank verbannt worden war. In der Zwischenrunde musste das Team alle Medaillenträume begraben. Einem 1:1 gegen Mexiko und einem 1:4 gegen Ungarn folgte, im ersten Aufeinandertreffen zweier deutscher Mannschaften überhaupt, ein 2:3 gegen die DDR, den späteren Gewinner der Bronzemedaille. Gegen die Ostdeutschen – deren Team übrigens weitgehend identisch war mit jenem, das zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft für Furore sorgen sollte – schoss Uli Hoeneß sein einziges Tor im gesamten Turnier. Mit fünf Toren wesentlich besser hatte sein Sturmkollege Ottmar Hitzfeld abgeschnitten, ein beim FC Basel kickender Vertragsamateur, von dem man viel weniger erwartet hatte.
Der Kleinverdiener Hitzfeld hatte den neureichen Hoeneß während des Turniers fast ungläubig bestaunt: »Er ist mit dem Porsche rumgefahren, während wir im Mannschaftsbus saßen.« Porschefahren sei nicht unbedingt leistungsfördernd, meinten denn auch einige Kommentatoren wie Gerhard Seehase, der in der »Welt« zu dem Urteil kam, in Hoeneß’ schwachen Leistungen komme das Problem eines zum »Star« erhobenen Spielers zum Ausdruck, der an seinen eigenen Erwartungen scheitert. Der Gescholtene selbst, der nun nach 22 Spielen seine Karriere in der Amateur-Nationalmannschaft beendete, wollte freilich nicht der Alleinschuldige sein. Er kritisierte das mangelhafte Zusammenspiel und machte den hohen und letztlich unerfüllbaren Erwartungsdruck, der auf ihm gelastet habe, als Ursache für die enttäuschenden Leistungen aus.
Weder Prämien noch Ruhm hatte es bei den Olympischen Spielen gegeben – und doch sollte sich Uli Hoeneß in späteren Jahren immer wieder gerne an diese Wochen zurückerinnern. »Ich habe als aktiver Olympiateilnehmer 1972 bis zum Attentat eine der schönsten Zeiten meines Lebens verbracht, im Dorf. Diese Ungezwungenheit, diese Fröhlichkeit. Diese Dinge muss man erlebt haben, um die Begeisterung für Olympia im Herzen zu tragen.« Uli Hoeneß war einer, der sich für die olympische Idee aufrichtig begeistern konnte. Aber natürlich blieb er darüber immer ein kühl kalkulierender Profi. Das heißt: Ein solcher musste der bisherige »Olympia-Amateur« in der Wirklichkeit des Fußballerlebens erst noch werden. Vor dem olympischen Fußballturnier hatte er »Garantien« von den Bayern für den nach den Spielen anvisierten Profivertrag verlangt, und um seine Forderungen zu unterstreichen, hatte er mit vielen Klubs Sondierungsgespräche geführt. Am 6. Oktober war er offensichtlich zufrieden mit dem Bayern-Angebot und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim amtierenden Deutschen Meister. Hinzu kam, dass in München die Aussichten auf Ruhm und Prämien durch die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister äußerst vielversprechend waren.
Am 15. November gelang Uli Hoeneß beim souveränen 5:1 der »richtigen« Nationalmannschaft gegen die Schweiz eine Art Comeback. Seine Aufstellung war nach den schwachen Vorstellungen in der Olympia-Auswahl nicht unumstritten, und so war er überglücklich, bei diesem Länderspiel im Düsseldorfer Rheinstadion endlich wieder mit einer guten Leistung überzeugen zu können. Das Nachspiel war dann weniger gut für ihn. Es war ein tolles Spiel gewesen, alle waren in Feierlaune, keiner wollte gleich ins Bett, selbst der Bundestrainer genehmigte sich einen Schluck – und Uli Hoeneß samt einigen Nationalmannschaftskollegen unternahm einen Ausflug in die berüchtigte Düsseldorfer Altstadt. Morgens um vier soll er quietschfidel und in weiblicher Begleitung in einer Diskothek gesichtet worden sein. Als der FC Bayern drei Tage später gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:3 verlor und dabei vor allem die Nationalspieler eigenartig müde wirkten, forschte Udo Lattek nach – dann tobte er und kündigte an, die Spieler künftig früher ins Bett zu schicken.
Trotz früherem Zapfenstreich wiederholten die Bayern in der Saison 1972/73 souverän ihren Triumph des Vorjahres – zu dem Uli Hoeneß 17 Treffer beisteuerte –, beendeten die Spielzeit dann aber mit einem erneuten Eklat. Die Veröffentlichung von Fotos der nackten Spieler, die sich ausgelassen im Entmüdungsbecken tummelten, provozierte Empörung bei den Vereinsoberen und schließlich Paul Breitners epochale Frage: »Kann denn in diesem Scheißverein niemand gescheit feiern?« Aber der Mangel an gescheitem Feiern war in dieser Saison nicht das einzige Problem gewesen. Schlimmer war noch, dass man international nicht gewinnen, ja nicht einmal gescheit – also wenigstens knapp – hatte verlieren können. Nach 13 Toren gegen den »Niemand« Omonia Nikosia war im Europapokal bereits im Viertelfinale das »Aus« gekommen: Am 7. März 1973 waren völlig chancenlose Bayern in Amsterdam gegen Johan Cruyffs Ajax mit 0:4 untergegangen; es war ein fürchterliches Debakel, das auch ein nutzloser 2:1-Sieg im Rückspiel nicht mehr hatte abmildern können.
In der Saison 1973/74 kamen die Bayern nun auch noch in der Bundesliga ins Trudeln. Am 20. Oktober, dem zwölften Spieltag, führten die Münchner in Kaiserslautern zur Halbzeit scheinbar sicher mit 3:1 – dann aber folgte in der zweiten Spielhälfte eine noch nie erlebte kalte Dusche. Am Ende mussten bedröppelte Meisterspieler ein kaum zu fassendes 4:7 mit nach Hause nehmen. Beckenbauer machte dafür unter anderem Uli Hoeneß verantwortlich, der an diesem Tag nicht viel zustande gebracht hatte. Der Gescholtene selbst erläuterte später: »Ja, wir haben schon mal abgehoben. Herrje, wir waren damals noch blutjung und hatten doch schon fast alles erreicht, was sich ein Fußballer erträumen kann.«
Aber man fing sich wieder. Die Wiedergutmachung folgte mit einem tollen 4:3 gegen Borussia Mönchengladbach, und Uli Hoeneß setzte sowohl in diesem Spiel (ein Tor) wie überhaupt in dieser Saison noch einige Glanzpunkte. Wieder wurden die Bayern Meister, diesmal nur hauchdünn mit einem Punkt Vorsprung vor den Gladbacher Borussen, und wieder machte Uli Hoeneß alle Spiele mit und erzielte mit 18 Treffern einen persönlichen Torrekord. Das letzte Saisonspiel fand am 18. Mai in Mönchengladbach statt und endete mit einem grauenhaft klingenden Ergebnis – 0:5. Doch keiner ärgerte sich. Erstens änderte es am Ausgang der Spielzeit nichts mehr, und zweitens war es verzeihlich. Denn die eigentliche Geschichte dieser Saison hatten die Bayern nur einen (!) Tag zuvor in Brüssel geschrieben.
Wirbel im Europapokal
»Von seinen 8.400 Einwohnern waren 9.300 gekommen, um ihre Mannschaft siegen zu sehen«, hatte eine südschwedische Zeitung ihren Bericht über ein denkwürdiges Europapokalspiel am 3. Oktober 1973 eingeleitet. Es war die 1. Runde des Landesmeister-Cups, als die Bayern mit einem komfortablen 3:1-Sieg aus dem Hinspiel im Rücken gegen den Klub aus der kleinen schwedischen Stadt Atvidaberg antraten. Zwar hatten sie sich vor heimischem Publikum nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber es sollte, dachten die Stars, keine große Mühe machen, die Sache gemütlich nach Hause zu schaukeln. Doch dann lagen sie schon nach acht Minuten mit 0:1 hinten, nach einer Viertelstunde mit 0:2. In der Halbzeitpause verließ Wilhelm Neudecker die Tribüne, um in der Kabine seine Mannschaft zu beschwören, sich bitte nicht zu blamieren, und lobte zur Untermauerung seines Flehens eine Zusatzprämie von 2.000 DM für das Weiterkommen aus. Doch es wollte nicht besser werden, in der 72. Minute erzielte der Schütze des ersten Tors, Conny Torstensson, einen weiteren Treffer.
Die Feierabendprofis aus der Provinz hatten das Star-Ensemble aus München am Rande des Abgrunds – und in dem wäre es wohl gelandet, wäre da nicht ein Retter gewesen: Kurz nach dem Wiederanpfiff stellte Uli Hoeneß mit einem Abstauber den Anschluss her und erzwang so die Verlängerung. Seinen nächsten Treffer erzielte er eine Dreiviertelstunde später, im Elfmeterschießen. Auch der war wichtig, denn Bernd Gersdorff hatte beim zweiten Strafstoß der Bayern zu hoch gezielt. Nachdem Hoeneß den Ball sicher verwandelt hatte, wehrte Sepp Maier einen Schuss der Schweden ab; dann traf Beckenbauer, und als der fünfte Schütze der Schweden vorbeischoss, waren die Bayern noch einmal knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. »Noch so ein Spiel halten meine Nerven nicht aus«, stöhnte Trainer Udo Lattek im Moment des Sieges. Und Präsident Neudecker befahl seinem Manager Robert Schwan: »Den mit den roten Schuhen möchte ich haben.« Der mit den roten Schuhen war der beste Mann des Gegners, der zweifache Torschütze Conny Torstensson.
Im Achtelfinale hieß der Gegner Dynamo Dresden, und auch der machte den Bayern das Leben schwer. Als die Dynamos am 24. Oktober im Olympiastadion zur Halbzeit mit 3:2 in Führung lagen, ging erneut die Angst vor einer Blamage um. Am Ende gab es ein knappes und erst spät sichergestelltes 4:3 für die Münchner. Man war noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, doch komfortabel war die Situation vor dem Rückspiel in Dresden nicht, denn Dynamo hätte bereits ein 1:0-Sieg zum Weiterkommen gereicht.
Äußerst peinlich war der Eklat, den der strikt antikommunistische Präsident Neudecker vor der Begegnung am 7. November in Dresden mit der Anordnung hervorgerufen hatte, vor dem Spiel nicht im bereits angemieteten Hotel Newa zu übernachten: »Wir fahren nur bis Hof, bleiben dort bis zum Spieltag und reisen erst dann nach Dresden weiter!« Als offizielle Begründung nannte der Bayern-Boss: »Der Höhenunterschied zwischen München und Dresden könnte leistungshemmend sein, und vielleicht reichen zwei Tage nicht aus, um sich zu akklimatisieren.« Die knapp 400 Meter Höhenunterschied waren es natürlich nicht, die Neudecker Sorgen machten. Der Präsident, der eigener Aussage nach der CSU vor allem deswegen beigetreten war, damit er seinen FC Bayern nicht eines Tages »als Dynamo Bayern München unter Führung eines kommunistischen Politruks« erleben müsse, nahm die zahllosen Gerüchte äußerst ernst, die man sich im Westen über die Verhältnisse in der DDR zuraunte. Es kursierten wahre Horrorgeschichten über Stasi-Spitzel, Vergiftungsversuche und ähnliches. Neudeckers Entschluss traf vor allem die 3.000 Fans in Dresden, die stundenlang vor dem Hotel gefroren hatten, um die Fußballstars aus dem Westen begrüßen zu können.
In den Jahren, die seitdem vergangen sind, musste sich der FC Bayern manche Klage über sein Verhalten in diesem November 1973 anhören. Heute weiß man, dass die Befürchtungen der Bayern keineswegs völlig haltlos waren. Zwar hatte niemand das Essen der Gäste mit leistungshemmenden Mitteln vergiftet, doch in der Nacht vor dem angenommenen Eintreffen der Bayern hatte man das gesamte Personal im Hotel Newa gegen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ausgetauscht, und der »Salon Puschkin«, in dem die Mannschaft sechs Stunden vor dem Spiel ihre Abschlussbesprechung abhielt, war mit Wanzen gespickt. Latteks Ansprache wurde Wort für Wort in der Zentrale der Dresdener Stasi mitgeschrieben. Der Schreiber überreichte die Notizen einem Boten, der sich mit einem MZ-Motorrad auf den Weg zur Mannschaftssitzung der Dynamos machte. Dort übergab er den Zettel dem Trainer Walter Fritzsch, und der trug seinen Spielern den Inhalt vor: »Wir kommen jetzt zur Aufstellung der Bayern … .«
Fritzsch wusste also genau, was seine Elf in dem mit 36.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllten Rudolf-Harbig-Stadion erwartete. Aber er muss vergessen haben, seinen Verteidiger Eduard Geyer vor Uli Hoeneß zu warnen. In der Erwartung, dass sich die Dresdener Abwehr voll auf Gerd Müller konzentrieren würde, hatte Lattek den schnellen Hoeneß auf Höhe der Mittellinie in Lauerposition postiert. Für Hoeneß’ Gegenspieler Eduard Geyer, der später als letzter Auswahltrainer der DDR in die Sportgeschichte eingehen sollte und 1997 den Drittligisten Energie Cottbus ins DFB-Pokal-Finale und später in die 1. Bundesliga führte, wurde der Abend zum Albtraum. Keine zwölf Minuten waren vergangen, da war der blonde Schwabenpfeil dem schwerfälligen Geyer schon viermal enteilt. Beim ersten Mal verunglückte sein Pass auf Müller noch, beim zweiten Mal foulte Dresdens Torwart Claus Boden den Bayern-Stürmer, ohne dass ein Elfmeterpfiff erfolgt wäre. Beim dritten Mal war Hoeneß dann erfolgreich: Er täuschte Boden und schoss zur Bayern-Führung ein. Der vierte Streich war ebenfalls erfolgreich, wobei ihm diesmal ein wenig das Glück zur Seite stand: Nachdem er den Dynamo-Keeper angeschossen hatte, landete der Abpraller an seinem Kinn und fand von dort den Weg ins Tor.
Das Spiel war aber noch nicht gelaufen. Wenige Minuten vor der Pause gelang Dynamo der Anschlusstreffer, sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff der Ausgleich. Und als in der 56. Minute auch noch das 3:2 folgte, stand nun aufgrund der größeren Zahl auswärts erzielter Treffer plötzlich Dresden im Viertelfinale. Doch die Freude währte nur zwei Minuten: In der 58. Minute besorgte Gerd Müller den Ausgleich zum 3:3-Endstand.
Im Viertel- und Halbfinale hatten es die Bayern abermals mit Mannschaften aus dem Ostblock zu tun, doch so knapp wie gegen Dresden wurde es nicht mehr. Gegen den bulgarischen Meister ZSKA Sofia (4:1, 1:2) und den ungarischen Titelträger Ujpest Dosza Budapest (1:1, 3:0) reichten zwei klare Heimsiege zum Weiterkommen. Auffälligster Spieler in diesen Partien war nicht jener, von dem die »Abendzeitung« schrieb, dass er sich vor Spielen aus Aberglauben nicht rasiert und immer als Letzter auf den Rasen läuft – nämlich Uli Hoeneß –, sondern der Mann mit den roten Schuhen, der Präsident Neudecker in Atvidaberg so begeistert hatte: der erstmals für die Bayern im Europapokal angetretene Conny Torstensson. Mit vier Toren und einer Torvorlage erwies sich der Schwede in diesen Spielen als gefährlichster Bayern-Stürmer, und Uli Hoeneß war offensichtlich derart neidisch auf seinen neuen Kollegen, dass er fortan – so jedenfalls behauptete es Torstensson – kein persönliches Wort mehr mit ihm sprach. Doch es wartete noch das Finale, und in dem sollte, nach einem langen Anlauf, Uli Hoeneß seinen größten Auftritt haben.
Der Triumph von Brüssel
Vor dem Endspiel gegen Atlético Madrid, das für den 15. Mai 1974 in Brüssel angesetzt war, galt der FC Bayern als Favorit. Der spanische Meister hatte die türkische Meistermannschaft Galatasaray Istanbul nur knapp geschlagen und war dann sowohl gegen Dynamo Bukarest als auch gegen Roter Stern Belgrad wirklich überzeugende Leistungen schuldig geblieben. Erst beim 2:0-Heimsieg gegen Celtic Glasgow im Halbfinale hatten die Spanier ihre Klasse andeuten können. »Wir werden siegen«, verkündete daher Trainer Lorenzo vor dem Endspiel im Vertrauen auf die ansteigende Form seines Teams: »Gerade jetzt hat sich meine Mannschaft heißgespielt und lechzt nach einem neuen Opfer.« Der Verlauf des Spiels schien ihm Recht zu geben. Zwar hatten die Bayern anfangs gute Chancen, doch dann fanden die Spanier immer besser ins Spiel. Der 34 Jahre alte Adelardo legte Hoeneß an die Kette, Eusebio ließ Gerd Müller keinen Raum, Mittelstürmer Garate prüfte auf der anderen Seite des Spielfelds Sepp Maier immer wieder mit kraftvollen Schüssen. Die Bayern spielten seltsam schwach, »katastrophal«, wie Hoeneß hernach zugeben sollte, und Fernsehkommentator Oskar Klose rätselte, warum »diese jungen Burschen nicht ihr Letztes geben, um Atlético Madrid, das doch durchaus zu schlagen ist, zu besiegen«.
Obwohl ein Müller-Tor wegen angeblichen Fouls nicht anerkannt wurde, war das 0:0 nach der regulären Spielzeit aufgrund der zahlreichen Chancen der Spanier für die Münchner recht glücklich. Auch die Verlängerung schien keine Entscheidung zu bringen. Von den 30 Minuten waren bereits 24 vergangen, da verschuldete Hansen einen Freistoß. Der 36-jährige Mittelfeldspieler Luis, als treffsicherer Freistoßschütze bekannt, trat an, drehte den Ball über die sechsköpfige Mauer hinweg und dann an Maier vorbei ins kurze Toreck. Alles schien jetzt verloren. Doch dann, in der letzten Spielminute, als den Spaniern schon der finale Jubelschrei in den Kehlen steckte, kam der Moment, als »Katsche« Schwarzenbeck im Mittelfeld den Ball trieb und niemanden fand, zu dem er ihn abgeben konnte. »Wenn du im Spiel einmal über die Mittellinie läufst, darfst du nie aufs Tor schießen«, hatten ihn seine Mitspieler stets ermahnt, denn »Katsches« Schussversuche waren in der Regel grauenvoll. Aber in seiner Verzweiflung zog er diesmal, aus 30 Metern, einfach ab – und der Ball war drin. Das 1:1 kam so überraschend, dass alle für einen Moment voller Verblüffung erstarrten – dann pfiff der Schiedsrichter, und die durch eine Art Wunder erlösten Bayern fielen sich freudestrahlend in die Arme.
Da Endspiele damals noch nicht durch Elfmeterschießen entschieden wurden, musste der Sieger in einem Wiederholungsspiel ermittelt werden. Das sollte nur zwei Tage später erneut im Heysel-Stadion zu Brüssel stattfinden. So hatte man 48 Stunden, um die Wunden zu lecken und sich Gedanken zu machen über die Fehler, die man im ersten Spiel begangen hatte. Der 22 Jahre junge Uli Hoeneß, in der Presse zuvor als »der schnellste lebende Stürmer Europas« gefeiert, gehörte zu den Bayern-Spielern, von denen die Beobachter am meisten enttäuscht waren; sein behäbiger Gegenspieler, der 34 Jahre alte Rodriguez Adelardo, hatte ihm während des gesamten Spiels kaum einen Stich gelassen. Als Susi Hoeneß am Morgen nach dem Spiel ihren Mann im Hotel »Le Grand Veneur« besuchte, sah sie sofort, dass er total deprimiert war. »Wir sagten nur ›Grüß Gott‹ zueinander und setzten uns dann auf eine Wiese. Es war ein herrlicher Sonnentag. Ich glaube, wir saßen drei Stunden wortlos da und guckten nur in die Gegend. Ich spürte, dass es besser war, meinen Mund zu halten. Irgendwie hat ihm das gut getan. Als wir uns trennten, war er ganz guter Stimmung.« Wie seine Mitspieler war auch Uli Hoeneß völlig kaputt, aber er wusste, dass die überalterten Atlético-Kicker sich vermutlich noch schwerer erholen würden als die junge Bayern-Mannschaft. Und außerdem hatte er für das Wiederholungsspiel einen Plan gefasst: »Wir müssen das Mittelfeld schneller überbrücken als am Mittwoch, damit die Spanier keine Gelegenheit haben, sich mit acht Mann zurückzuziehen. Wir Sturmspieler müssen mehr tun.« Trainer Lattek goss den Plan in den taktischen Auftrag an Müller, sich immer wieder aus der Sturmmitte zurückfallen zu lassen, dadurch seine Gegenspieler mitzuziehen und somit für die schnellen Vorstöße von Hoeneß mehr Platz zu schaffen. Mehr tun – das hieß also für Hoeneß, seine alte Rolle als voranpreschender »Jung-Siegfried« neu aufzulegen. Er interpretierte sie diesmal so bravourös wie nie zuvor.
Schon nach einer Viertelstunde hat Hoeneß, der seinen Bewachern mit Vollgas davongezogen war, die Chance zur Führung auf dem Fuß: Gefühlvoll, aber mit etwas zu starkem Druck lupft er den Ball über den Balken. Auch Müller hat gleich darauf Pech, als sein Kopfball am Pfosten landet. Dann die 28. Minute. Breitner angelt sich kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball, dreht sich einmal um die eigene Achse und drischt die Kugel nach vorne, dorthin, wo sein Spezi Uli wartet. Während der Ball fliegt – 40, vielleicht 50 Meter weit – sprinten Hoeneß und sein Bewacher los. Der Spanier Adelardo, der im ersten Spiel noch so souverän war, hechelt ohne Chance hinterher und muss hilflos zusehen, wie der blonde Turbo-Siegfried den mehrmals auftupfenden Ball annimmt, ihn dann mit konstant hohem Tempo in den Strafraum treibt und schließlich dem herausstürzenden Reina kaltblütig durch die Beine schiebt – 1:0.
In der Pause herrscht in der Bayern-Kabine Zuversicht. Nach dem Wiederanpfiff ist erstmal Müller-Zeit: Vom linken Flügel flankt Kapellmann mit rechts auf den sprintenden »Bomber«, der den Ball im Sprung annimmt und dann verwandelt; das dritte Tor erzielt er mit Verstand und Gefühl per Lob über den zu weit herausgeeilten Reina – ein Weltklassetreffer. In der 82. Minute dann die Kür von Uli Hoeneß: Breitner befördert den Ball per Scherenschlag aus dem Strafraum, Müller leitet mit dem Kopf weiter zu einem Spanier, und der vertändelt den Ball, als Hoeneß dazwischenspritzt. Reporter Oskar Klose ist wie elektrisiert: »Hoeneß! Hoeneß!! Hoeneß!!! Ein Mann noch, einer ist bei ihm, an dem muss er noch vorüber, der zweite kommt … jetzt legen sie ihn um! … Nein, er macht sie alle fertig!« Ein atemberaubender Querfeldeinlauf über das Feld, bei dem Hoeneß am Ende auch noch den herausgeeilten Reina narrt und den Ball schließlich scharf unter die Latte zieht. Beide Hoeneß-Tore waren gleichsam noch verschönerte Kopien der Treffer von Dresden, mit Kraft und Raffinesse vorgetragene Sololäufe, bei denen die Gegner zu Statisten eines Heldenauftritts schrumpften.
4:0 – eine solche Darbietung in einem solch wichtigen Spiel hatte es bis dahin noch von keiner deutschen Vereinsmannschaft gegeben. Der FC Bayern feierte seinen ersten Sieg im Europapokal der Landesmeister und den trotz aller späteren Erfolge wohl glücklichsten Tag seiner Geschichte. »An diesem Abend war ich richtig stolz auf ihn. Das ist doch schon etwas, der Europapokal«, resümierte Susi Hoeneß, die beim fulminanten 1:0-Treffer ihres Mannes auf der Tribüne vor Begeisterung geschrien hatte wie eine Verrückte. Und ihr Gatte Uli berichtete hernach von dem »Gefühl, das Rad des Lebens anhalten und eine Zeitlang auf derselben Stelle verweilen zu wollen«. Im »Kicker« wurde er gar mit dem größten aller damaligen Stars, mit Johan Cruyff, verglichen. Wenig später referierte der Hochgelobte, dass er vor dem Spiel nie zu träumen gewagt hätte, nach Dresden noch einmal zwei so wichtige und stilistisch so ähnliche Tore zu schießen. »Nämlich Tore im direkten Duell mit dem Torwart. Man sagt mir nach, dass ich in diesen Situationen einen kühlen Kopf und ein waches Auge hätte. Das muss wohl stimmen.«
Als ein Mann, der immer in der Gegenwart lebte und stets tatkräftig nach vorne blickte, entwickelte er wenig Neigung, sich sentimentaler oder analysierender Nachbetrachtung hinzugeben. Uli Hoeneß beschäftigte sich denn auch nur selten mit seinen vergangenen Erfolgen als Fußballspieler. Nur im Fall dieses Spiels sollte er sich ab und an eine Ausnahme genehmigen: Wenn er Lust darauf hatte, sich die wohligste Gänsehaut, die er in seiner Karriere hat erleben dürfen, noch einmal hervorzuzaubern, legte er die Videokassette mit dem Triumph von Brüssel 1974 in den Rekorder.
Der schwierige Weg zum Weltmeistertitel
Der Europapokalsieg der Bayern war gleichsam der Auftakt eines für ganz Fußball-Deutschland herausragenden Jahres. Als Saisonhöhepunkt stand die erste in Deutschland ausgetragene Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Nach dem letzten Test vor der WM am 1. Mai in Hamburg, einem 2:0 gegen Schweden, war Uli Hoeneß in der Presse mit der Schlagzeile gefeiert worden: »Der neue Netzer heißt Hoeneß.« Dieser Vergleich war wohl genauso unpassend wie der frühere mit Haller oder der spätere mit Cruyff, denn es handelte sich um jeweils ganz eigene Typen, deren Spielweisen kaum sinnvoll miteinander verglichen werden konnten. Unglücklich war der Vergleich darüber hinaus deswegen, weil der langmähnige Gladbacher in Hamburg selbst auf dem Platz gestanden hatte. Netzer wurde denn auch nie ein Freund von Hoeneß. Er, der selbst immer den Individualisten herausgekehrt hatte, mokierte sich vor allem über die Egomanie des jungen Bayern-Stürmers. Kurz vor der WM beschimpfte er Hoeneß in der »SZ« als »Banditen«, der wohl glaube, alleine Weltmeister werden zu können.
Viele erwarteten, dass Hoeneß zum großen Star der WM werden könnte, unter ihnen der als »Fußballprofessor« gerühmte Dettmar Cramer, der frühere Assistent von Helmut Schön und jetzige FIFA-Trainer. »Das war sehr unglücklich«, sollte der Gelobte nach der WM äußern, es habe ihm sehr geschadet, derart »von außen hochgejubelt« worden zu sein. Vor dem Anpfiff des Turniers war er freilich noch nicht so klug gewesen und hatte sich nicht gegen solche Vorschusslorbeeren gewehrt. Er war absolut von sich überzeugt und entschlossen, die Erwartungen zu erfüllen. Konditionell, da waren sich alle Beobachter einig, würde er keinerlei Probleme bekommen. Bei einem Belastungstest vor dem Spiel gegen Chile erzielte er mit einer Pulsfrequenz von über 190 den Spitzenwert im deutschen Team. »Er ist der Typ des Zehnkämpfers und hält jegliche Belastung aus«, meinte Mannschaftsarzt Heinrich Hess.
Aber das war die Theorie; die Praxis war das andere. Am 14. Juni, dem Tag des Auftaktspieles gegen Chile, herrschte in Berlin eine drückende Schwüle. Vorher, bei der Vorbereitung in der schleswig-holsteinischen Sportschule Malente, hatte es immer kühle Ostsee-Witterung gegeben. »Uli Hoeneß, der ohnehin gegen Klimawechsel sehr anfällig ist, schleppte sich vor dem Spiel herum, als hätte er am Vormittag das Europapokal-Finale gegen Madrid gespielt«, erzählte sein Freund Paul Breitner später. Die Deutschen konnten froh sein, dass Breitner schon in der 17. Minute das 1:0 erzielte – denn danach passierte nicht mehr viel. Kapitän Beckenbauer suchte sich hinterher vor allem Uli Hoeneß als Sündenbock für das schlechte Spiel heraus: »Wir standen vorne mit vier Angriffspitzen herum und nahmen uns gegenseitig den Platz weg. ›Du bist hier nicht Spitze, du bist Mittelfeldspieler, du musst zurück.‹ Das habe ich während des Spiels Uli Hoeneß zugerufen. Aber es änderte sich nichts. So ein Lob, wie es Dettmar Cramer verteilte, kann eben nicht jeder vertragen.«
Im zweiten Spiel gegen den Außenseiter Australien in Hamburg wurde es nicht viel besser – nicht bei der Mannschaft und auch nicht bei Uli Hoeneß. Zunächst sah alles noch gut aus, das deutsche Team spielte druckvoll und ging durch Tore von Overath, Cullmann und Müller mühelos mit 3:0 in Führung. Nach einer Stunde aber war es mit der Herrlichkeit vorbei. Die Männer von Helmut Schön wirkten plötzlich wie gelähmt, kaum etwas gelang mehr, besonders Uli Hoeneß nicht, der schon in der ersten Halbzeit eine Riesenchance kläglich versiebt hatte. Die Stimmung im Stadion kippte, es gab gellende Pfiffe und Anfeuerungsrufe für den Außenseiter aus Australien. Bei der etwas hilflosen Suche nach Erklärungen für seine schwache Leistung sprach Uli Hoeneß von einem psychischen »Webfehler«, der sich bei ihm in Spielen gegen solche Außenseiter immer wieder bemerkbar mache. »Spiele gegen Mannschaften, die zum Sieg nicht das allerletzte Quäntchen Kraft und Konzentration verlangen, sind nicht mein Fall.«
Immerhin war die bundesdeutsche Elf mit 4:0 Punkten und 4:0 Toren bereits sicher für die zweite Finalrunde qualifiziert. Im letzten Spiel gegen die Auswahl der DDR ging es dann lediglich noch um den Gruppensieg. Die Stars aus dem Westen hätten in diesem ersten offiziellen deutsch-deutschen Länderspiel eigentlich befreit aufspielen können. Doch statt selbstbewusst aufzutrumpfen, verfielen sie in Überheblichkeit und überließen das Kämpfen ihren Gegnern. Elf Minuten vor dem Abpfiff gelang Jürgen Sparwasser mit dem Treffer zum 1:0 die riesige Sensation: Westdeutschlands Superstars waren von biederen DDR-Amateuren düpiert worden.
»Nach der ersten Finalrunde dieser Weltmeisterschaft blieb es niemandem verborgen: Wir, der große Favorit im eigenen Land, waren am Boden zerstört«, resümierte ein zerknirschter Uli Hoeneß. »Intern zerstritten; von außen wurden manche Reibereien noch geschürt. Alle anderen Mannschaften wurden uns als leuchtende Beispiele unter die Nase gerieben; man schrieb uns als Versager fast ab.« Nach heftiger Presse-Kritik an Helmut Schön avancierte nun Kapitän Franz Beckenbauer als eine Art Neben-Bundestrainer zu dem Mann, der die wichtigen Entscheidungen forcierte. Man verabschiedete sich von der Idee, jenen Angriffsfußball, mit dem die westdeutsche Auswahl vor zwei Jahren triumphal zum Europameistertitel geeilt war, fortsetzen zu wollen. Dies hatte auch Personalentscheidungen zur Folge: Zum einen wurde die Frage nach dem Mittelfeld-Regisseur nun endgültig zugunsten des fleißigen Kölners Wolfgang Overath entschieden, sodass der Kurzeinsatz des defensivfaulen Günter Netzer gegen die DDR der letzte und einzige WM-Auftritt seiner Karriere blieb; und zum anderen wurde Uli Hoeneß, der im Spiel gegen die DDR seinen Defensivpart zum wiederholten Mal recht nachlässig interpretiert hatte, eine Denkpause verordnet. Beckenbauer, beschwerte er sich beleidigt, habe ihm die ganze Schuld an der Niederlage gegen die DDR aufgebürdet. »Als er sagte, einige hätten nicht genug gekämpft, hat er mich gemeint.« Tatsächlich hatte sich Hoeneß wegen einer schon kurz nach Spielbeginn erlittenen Oberschenkelprellung recht schwerfällig über den Platz geschleppt. »Ich hätte mich austauschen lassen müssen«, bereute er hinterher seine Entscheidung, sich durchzubeißen.
Drei Spiele, drei enttäuschende Auftritte, und dann auch noch auf die Bank verbannt – diese WM war bislang wahrlich nicht das Turnier des Uli Hoeneß. Schöns Assistenztrainer Jupp Derwall erinnerte sich an die Olympischen Spiele, wo der Bayern-Stürmer in ähnlicher Weise versagt hatte. »Es ist mir unerklärlich, wie ein so intelligenter Junge die ihm aufgetragene taktische Order im Spiel missachten kann. Anstatt seine Aufgabe zu erfüllen – und das muss bei einem Mittelfeldspieler auch heißen, den direkten Gegner zu decken –, kurvte er vorne in der Landschaft herum. Noch erstaunlicher ist, dass dies Uli Hoeneß bei der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal passierte. Er gehört einfach zu den Spielern, die ihre Intelligenz nicht auf das Spielfeld übertragen können.«
Vor dem Auftaktspiel der zweiten Finalrunde gegen Jugoslawien im Düsseldorfer Stadion wirkte der Bankdrücker Hoeneß zwar äußerlich gelassen, in ihm aber kochte die Wut des in seinem Ehrgeiz Gekränkten. Hoeneß sah, wie Paul Breitner die Bundesrepublik mit seinem 1:0 in der 39. Minute auf die Siegerstraße brachte, und war hoch motiviert, als er nach einer Stunde von Bundestrainer Schön das Zeichen bekam, sich für die Einwechslung bereit zu machen. Als er für den Gladbacher Dauerläufer »Hacki« Wimmer aufs Feld kam, rannte er wie um sein Leben und hatte mit seinem unbändigen Kampfgeist entscheidenden Anteil an der Sicherstellung des Sieges. In der 77. Minute startete er unwiderstehlich bis zur Torauslinie durch und passte den Ball von dort zu Gerd Müller zurück, der zum vielumjubelten 2:0 verwandelte. Bundestrainer Helmut Schön freute sich über das Wiedererstarken seines Stürmers ganz besonders, denn es bestätigte seinen pädagogischen Plan: Die Verbannung auf die Bank war eine ganz bewusst eingesetzte Erziehungsmaßnahme, um dem schwächelnden Hoeneß einen Motivationsschub zu verpassen.
Am Sonntag, den 30. Juni, kehrte im Spiel gegen die starken Schweden schließlich auch die Euphorie auf die Ränge zurück. Es regnete in Strömen, aber trotzdem war die Stimmung toll, die Mannschaft ließ sich davon anstecken und kämpfte aufopferungsvoll – wenn auch zunächst vergeblich. Obwohl es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ging, zeigte sich im Stadion niemand verzagt, und auch drinnen in der Kabine, wo die Spieler die durchnässten Trikots und Hosen wechselten, war nichts von Selbstaufgabe zu spüren. »Wir waren alle davon überzeugt«, so Uli Hoeneß, »dass wir die Schweden noch packen.« Gleich nach Wiederanpfiff schossen Overath und Bonhof eine 2:1-Führung heraus, dann konnten die Schweden zum 2:2 ausgleichen, nach einer kurzen Phase der Verunsicherung erzielte Grabowski das 3:2. Hoeneß war an allen drei Treffern als Vorbereiter beteiligt, den Schlusspunkt setzte er schließlich selbst, als der Schiedsrichter in der 89. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte: Anlauf – Antäuschen – Torwart Hellström links – Ball rechts – 4:2. Es war kein Sieg mit der Brechstange wie gegen Jugoslawien, sondern ein auch mit spielerischen Mitteln erzielter Erfolg, der ein wenig an den Elan der Europameister-Elf von 1972 erinnerte. Und Uli Hoeneß hatte diesmal sogar in der Defensive überzeugen können, insbesondere in den Duellen mit seinem Vereinskollegen und Konkurrenten Conny Torstensson.
Im WM-Quartier Sportschule Kaiserau herrschte endlich wieder gute Stimmung. Am Abend gaben die Stimmungskanonen der Truppe, die beiden Assistenten Derwall und Widmayer, Fußballlieder zum besten. »Und wir sangen fleißig mit«, berichtete Uli Hoeneß. »Ich erinnerte mich an meine Jugendzeit in Ulm, als wir nach jedem Sieg im Vereinsheim glücklich zusammensaßen und das Hochgefühl gemeinsam auskosteten.« Den Weg ins Finale versperrten jetzt nur noch die starken Polen. Im deutschen Lager war man zuversichtlich: Aufgrund des besseren Torverhältnisses würde ein Unentschieden genügen für den ersten Platz in der zweiten Finalrunde und damit für den Einzug ins Endspiel. Nur: Wie sollte man überhaupt spielen? Starker Regen hatte den Rasen in Frankfurt in einen See verwandelt, der Terminplan ließ aber keine Verschiebung des Spiels zu. Man versuchte, die Wassermassen mit Walzen zu beseitigen, doch als das Spiel mit 30-minütiger Verspätung angepfiffen wurde, konnte von regulären Verhältnissen immer noch keine Rede sein.
So kam es zur »Wasserschlacht von Frankfurt«, in der die Polen enorm stark aufspielten, aber immer wieder von einem unüberwindbaren Sepp Maier am Torerfolg gehindert wurden. Dann die 53. Minute: Elfmeter für Deutschland. Uli Hoeneß trat an. »Den Augenblick werde ich wohl nicht mehr aus meiner Erinnerung streichen können«, war er hinterher untröstlich. »Den Augenblick, als ich gegen Polen Anlauf zum Elfmeter nahm. Und dann, als mir der Schuss verunglückte, ein Schuss, bei dem Torhüter Tomaszewski auch keine Probleme gehabt hätte, wenn er statt seiner Arme eine Mütze zu Hilfe genommen hätte.« Der gescheiterte Elfmeterschütze war am Boden zerstört, wurde aber von den anderen gleich wieder aufgemuntert. Beckenbauer lief herbei und rief: »Uli, das macht nichts, das kann jedem von uns passieren. Jetzt erst recht, reiß dich zusammen!« Und Uli riss sich zusammen. »Wie auf Kommando rannte ich los, ich gab mich aus bis zur Erschöpfung. Für die gesamte Mannschaft war mein Versager eine Art Fanal, keineswegs lähmte er uns. Gegenspieler Maszczyk schimpfte einige Sätze auf Polnisch, als ich ihm einmal den Ellbogen in den Leib stieß. Mir war alles egal, ich wollte meinen Fehler wieder gutmachen.« In der 76. Minute beendete schließlich Gerd Müller mit seinem Tor zum entscheidenden 1:0 den Nervenkitzel.
Auf dem höchsten Fußballgipfel
Am 7. Juli 1974 wartete im Münchner Olympiastadion ein schier unüberwindbar scheinender Gegner auf die Elf des DFB. Während des Turniers waren die Holländer um den genialen Spielmacher Johan Cruyff beinahe zu Fußballgöttern aufgestiegen. Außer bei einem 0:0 gegen Schweden hatten sie bei allen Auftritten geglänzt und mit ihrem »totalen Fußball«, bei dem jeder Spieler auf jeder Position auftauchen konnte, sämtliche Gegner in Grund und Boden gespielt. Die Deutschen waren nicht viel mehr als ein bemitleideter Außenseiter, zumal die Bayern – also der Kern der Nationalmannschaft – im Europapokalspiel des Vorjahrs gegen Cruyffs Ajax Amsterdam mit 0:4 untergegangen waren: Kurz, so Hoeneß, »wir galten als Mannschaft, für die Holland einfach eine Nummer zu groß sein musste«.
Der Bayern-Stürmer selbst hatte noch dazu das Problem, dass er sich mit einer fiebrigen Erkältung herumschlagen musste. In der Befürchtung, nicht aufgestellt zu werden, hielt er sein Handicap geheim und besorgte sich unter der Hand Medikamente zur Selbstbehandlung. Vielleicht hatte es ein wenig mit seiner mangelnden Fitness zu tun, dass er etwas unkonzentriert war und gleich in der ersten Minute des Spiels mit einer unglücklichen Aktion ins Zentrum des Geschehens rückte. Nach ein paar kurzen Ballstafetten der Holländer trat Johan Cruyff zu einem Solo an, kam an seinem Bewacher Berti Vogts vorbei, strebte der Strafraumgrenze zu – und fiel über das ausgestrecke Bein von Uli Hoeneß. »Ich könnte es beschwören«, meinte der: »Der ›Tatort‹ war nicht im Strafraum. Schwarzenbeck, der Taylors Pfiff gehört hatte, und Franz Beckenbauer riefen fast im Chor: ›Mauer machen.‹ Sie glaubten ebenso wie ich, der Pfiff konnte nur einen Freistoß bedeuten. Doch als ich Herrn Taylor mit ausgestrecktem Arm Richtung Elfmeterpunkt marschieren sah, war ich vor Schreck fast erstarrt. Das durfte und konnte doch nicht wahr sein! Es war leider wahr! Erst als Neeskens Name als Torschütze oben auf der elektronischen Anzeigetafel erschien, wurde ich wieder wach: Im WM-Finale nach 60 Sekunden mit 0:1 im Rückstand! Ohne dass einer von uns den Ball berührt hatte. Waren die Holländer wirklich solche Teufelskerle?«
Die Deutschen fanden mit ihrer altbewährten Tugend, der Kampfkraft, allmählich immer besser ins Spiel. Berti Vogts legte Johan Cruyff an die Leine, und Paul Breitner verkürzte nach einem ebenfalls fragwürdigen Elfmeter, verursacht durch einen Hauch von Foul an Bernd Hölzenbein, in der 25. Minute auf 1:1. Eigentlich war Gerd Müller als Elfmeterschütze bestimmt, doch plötzlich war Breitner losgerannt und hatte den Ball ins Netz gedonnert. »Es war sein drittes, lebenswichtiges Tor des Turniers«, kommentierte Uli Hoeneß voller Anerkennung, »und das als Verteidiger!« Müller steuerte seinen Treffer in der 43. Minute bei, als er eine Bonhof-Flanke von rechts kurz stoppte und nach rascher Drehung auf typische Müller-Art – und mit etwas Glück – zur 2:1-Führung verwandelte. In der zweiten Halbzeit folgte ein Sturmlauf der Holländer, bei dem die deutsche Nationalelf mit unbändiger Willenskraft und einem überragenden Sepp Maier im Tor glücklich dagegen hielt. Uli Hoeneß rackerte und spurtete unentwegt und sorgte mit Konterattacken, bei denen zweimal nicht viel zum entscheidenden 3:1 gefehlt hätte, für Entlastung. Endlich hatte er die Leistung gebracht, kommentierte der »Kicker«, die seine Anhänger schon in den vergangenen Spielen von ihm erwartet hatten. Und am Ende vibrierte das Zeltdach des Olympiastadions unter dem Jubelschrei von 80.000 Zuschauern: Weltmeister! Der Jubel schwoll zum Orkan an, als Kapitän Beckenbauer die von FIFA-Präsident Sir Stanley Rous überreichte WM-Trophäe in die Höhe stemmte, und als sich die Spieler nach der offiziellen Zeremonie auf die Ehrenrunde machten, wollte der begeisterte Beifall noch immer kein Ende nehmen.
Es folgte das feucht-fröhliche Nachspiel. Hoeneß: »In der Kabine stand Sekt parat, kistenweise. Davon war bald nichts mehr übrig. Leicht selig fuhren wir zum offiziellen Bankett ins Hilton-Hotel. Ebenfalls beim Bankett: die Holländer. Wenn auch, verständlicherweise, mit ernsteren Gesichtern. Einige drückten uns, leicht verschämt, die Hand. Andere besahen sich unsere überschäumende Freude etwas nachdenklich aus einer Ecke. Langsam tauten auch sie auf, die sich im Finale als großartige Mannschaft präsentiert hatten.« Die Offiziellen des DFB, die den Frauen der Spieler die Teilnahme am Bankett untersagt hatten, tauten allerdings nicht auf. Und so wurde Uli Hoeneß’ Frau Susi, die trotz des Verbotes am Tisch der Weltmeister Platz genommen hatte, zum Ausgangspunkt eines heftigen Streits. DFB-Funktionär Deckert erschien am Tisch und bestand darauf, dass Frauen den Saal zu verlassen hätten. Laut Franz Beckenbauer entspann sich daraufhin folgender Dialog:
Uli Hoeneß (auf einige ältere Damen mit Perücken hinweisend, die an der Funktionärstafel dinierten): »Aber da sind ja auch andere Frauen.«
Deckert (die Hände flach auf den Tisch legend, wütend): »Das sind die Damen der Offiziellen, das ist etwas ganz anderes. Hier herrscht noch Zucht und Ordnung. Maßen Sie sich nicht Rechte an, die Ihnen nicht zustehen.«
Uli Hoeneß: »Halten Sie doch die Luft an.«
Damit stand Uli Hoeneß auf und verließ mit seiner Frau den Saal, Beckenbauer folgte ihm. »Mit seiner geschlossenen Gesellschaft hatte sich der DFB selbst an den Pranger gestellt«, resümierte Beckenbauer. »Gerd Müller erklärte noch in der gleichen Nacht seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Andere schlossen sich an.«
Der Vorfall zeigte, dass mit den Weltmeistern von 1974 eine neue Generation von Spielern herangewachsen war. Sie hatte sich weit entfernt von der Generation der Arbeiterkinder, die meist nur für einen angestammten Verein gegen das Leder traten und sich davon einen bescheidenen Ruhm als »local hero« sowie gewisse berufliche Privilegien versprachen. Jetzt waren es Profis, die im Zuge einer kontinuierlich ansteigenden Kommerzialisierung des Spiels ihren Wert einzuschätzen wussten, denen bewusst war, dass sie die Zuschauer in die Stadien und vor den Fernseher lockten, die Kasse klingeln ließen und die Bühne für die Funktionäre bereiteten. Fußball war nicht mehr nur in trauter Vereinstümelei betriebener Sport, sondern Teil der Unterhaltungsindustrie. Die höhere mediale Beachtung hatte die Helden des Rasens in einen Rang ähnlich den Stars der Popmusik erhoben, und dementsprechend hatte sich auch ihr Verhalten geändert.
Dieses neue Selbstbewusstsein hatte aber nicht nur mit dem gestiegenen Ansehen und Einkommen der Sportler zu tun. Über allem lag ein Hauch von »’68«. Das dokumentierte sich in den langen Haaren und dem lässigen Auftritt, im Aufbegehren gegen verknöcherte Autoritäten, das selbst den überzeugten CSU-Wählern unter den Profis nicht fremd war, sowie in einem anderen Verständnis über die Rolle der Frauen. Der Eklat im Hilton war also keineswegs nur ein zufälliges Ereignis, sondern Ausdruck eines Zeitenwandels, der aus Fußballspielern selbstbewusste Stars gemacht hatte – Stars, die in vorher noch nicht dagewesener Weise von jungen Leuten umjubelt wurden, so etwa durch die Schüler, die an ihrer Lehranstalt in Ulm ein Transparent mit dem Namen »Uli-Hoeneß-Gymnasium« entrollten.
Ein angeschlagener Weltmeister
Im Jahr 1974 standen die Bayern auf dem Höhepunkt ihrer Macht: Deutscher Meister, Europapokalsieger und – Weltmeister, denn bei der WM hatten ja mit Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Müller und Hoeneß sechs Bayern zur Stammformation gezählt. Zum Bundesliga-Auftakt gegen Offenbach im Frankfurter Waldstadion machte Karl-Heinz Rummenigge sein erstes Spiel und erlebte gleich den Beginn der ersten großen Bayern-Krise: Die Männer um Beckenbauer und Müller schossen kein einziges Tor, die Gegner deren sechs. Bayern begann die Saison als Tabellenletzter. Danach wurde es nicht allzu viel besser. Offenkundig waren viele Spieler nach den großen Triumphen satt. Außerdem gingen den Bayern die Kräfte aus, denn die Auswechselbank war schmal und qualitativ nicht gut besetzt. Dazu war die Stimmung im Verein alles andere als harmonisch. Die vergangenen Erfolge hatten die Mannschaft nicht zusammengeschweißt, im Gegenteil: Überall wucherten Neid und Missgunst und trieben tiefe Risse in das Mannschaftsgefüge.
Die Bayern waren kein Team mehr, sondern mutierten zu einem Ensemble aufeinander eifersüchtiger Stars, in dem jeder seine Pfründe verteidigte. Als die Weltmeister drei Wochen vor dem Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison ins Training einstiegen, war die Stimmung aufs Äußerste gespannt. Deutlicher Ausdruck der allgemeinen Gereiztheit war Uli Hoeneß’ Reaktion auf das Gerücht, die Bayern wollten den bei der WM groß herausgekommenen Polen Gadocha verpflichten: »Wir können nicht noch einen Star in der Mannschaft vertragen.« Franz Beckenbauer sah in einem ganz bestimmten Star, nämlich in Uli Hoeneß, den Quell des Unfriedens. »Bei Hoeneß hatte sich wohl die Idee festgesetzt, ich würde ihm seine Karriere nicht gönnen, ihn nicht zu groß werden lassen wollen beim FC Bayern und in der Nationalelf. Er fand einen Verbündeten in Udo Lattek.« Der Kapitän verdächtigte den Trainer, er bevorzuge Abiturienten und Studenten. »Hoeneß, Breitner und Lattek bildeten eine verschwörerische Allianz. Eine spöttische Bemerkung beim Essen, eine kleine Bösartigkeit beim Training, die Luft hatte plötzlich einen giftigen Geruch.« Dazu hatte sich ein »Damenkränzchen« gebildet mit einer Susi (Hoeneß) und zwei Hildegards (Breitner und Lattek). »Udo Latteks Frau führte Regie«, behauptete Beckenbauer. »In diesem Kreis wurde dann besprochen, wie ungerecht es doch bei den Bayern zuginge, alles drehe sich nur um Beckenbauer, Müller und Maier. Wie viel mehr Geld die drei verdienen würden, viel mehr als ihre Männer. Und dann erst dieser Robert Schwan, ein Tyrann und Diktator, der nur im Sinn hätte, sich und Beckenbauer die Taschen zu füllen.«
Zum schlechten Betriebsklima gesellten sich unübersehbare Verschleißerscheinungen. Die Vielfachbelastung der letzten Jahre – Meisterschaft, DFB-Pokal, europäische Wettbewerbe sowie die Turniere der Nationalmannschaft inklusive Qualifikationsspiele – hatten nicht nur beim »Kaiser« ihren Tribut gefordert. Als Beckenbauer über nicht enden wollende Schmerzen in der Leistengegend klagte, wiegelte Lattek ab und sprach von einem Muskelkater, der sicher rasch wieder vergehe. »Ich hörte den Spott heraus«, kommentierte der in seiner Autorität angegriffene Bayern-Kapitän, »ich sah die Blicke, die er mit Uli Hoeneß und Paul Breitner wechselte. Ich wusste: Es gibt Ärger. Ich fühlte mich wie in einem Rudel von Wölfen. Ich stellte mir vor, dass es dort so sein müsste: Die Jungen sind es leid, die Führung des Leittiers zu akzeptieren, auch wenn es für alle nur ein Vorteil war, die Erfahrung, die Stärke des Alten, die den Erfolg bei der Jagd garantierten.«
Paul Breitner verabschiedete sich nach Madrid und prophezeite dem Klub eine schwere Zukunft. »Die Bayern sind satt.« Im Dezember 1974 musste der immer ratloser wirkende und mit Alkoholeskapaden auffällig gewordene Udo Lattek seinen Hut nehmen. Franz Beckenbauer, so der Bayern-Spieler Rainer Zobel, sei »nicht unmaßgeblich am Abschuss von Lattek beteiligt« gewesen. Sein Nachfolger Dettmar Cramer, zuvor Nationaltrainer der USA, war mit seiner professoralen Art ein gänzlich anderer Typ als der joviale und medienerfahrene Lattek. Er kam anfangs in München nicht sehr gut an. »Am Ende haben wir alle das Abitur, aber keine Punkte«, klagte ein verwirrter Wilhelm Neudecker, ehemaliger Maurerlehrling und aktueller Bayern-Präsident. Das mit dem Abitur klappte nicht, die Furcht vor zu wenigen Punkten hingegen war nicht unberechtigt. In der Rückrunde näherten sich die Bayern zwischenzeitlich sogar der Abstiegszone, am Ende wurden sie immerhin noch Zehnter, mit 26 Punkten Rückstand auf den Meister Borussia Mönchengladbach. Erfolgreich blieb die Cramer-Truppe allerdings im Europapokal. »Wir konnten uns nur noch bei Europapokalspielen zusammenreißen«, resümierte Uli Hoeneß die Situation. »Zwei Spiele, alle vier bis sechs Wochen – dazu reichte die Konzentration aus.« National ein Flop, europäisch top – so lautete das Motto der Bayern dieser Jahre.
An einem feuchten 23. Oktober 1974 trafen die Münchner im Achtelfinale des Landesmeister-Cups auf den 1. FC Magdeburg. Beim Hinspiel im Olympiastadion führte der Gast aus der DDR zur Pause mit 2:0, dann drehten die Bayern das Spiel durch zwei Treffer von Gerd Müller und ein Eigentor noch um. Zum Rückspiel nach Magdeburg reiste der FC Bayern mit eigenen Lebensmitteln und eigenem Koch an. Um zu erklären, was er gegen die ostdeutsche Küche habe, redete sich der paranoische Präsident Neudecker diesmal mit »Furcht vor Typhus« heraus. Das war natürlich eine Argumentation, die in der DDR erst recht als Provokation empfunden werden musste. Dem undiplomatischen Vorspiel folgte ein abgeklärter Auftritt im Stadion. Hoeneß leitete einen Freistoß von Beckenbauer per Kopf zu Zobel weiter, der flankte präzise auf Müller – Kopfball und Tor. Das war in der 22. Minute. Dem zweiten Bayern-Treffer eine halbe Stunde später ging wieder einer der unwiderstehlichen Hoeneß’schen Sololäufe voraus: Er umspielte zwei Gegner, ließ mit Glück auch noch den dritten stehen und flankte präzise auf Müller. Sparwasser verkürzte noch, aber das Spiel war entschieden.
Weiter ging es am Abend des 5. März 1975 gegen den sowjetischen Meister Ararat Erewan. Uli Hoeneß hatte vier Tage vorher im Ligaspiel gegen Wuppertal eine tiefe Risswunde an der Achillessehne davongetragen und beschwor den Klubarzt Dr. Tasnady, ihn mit allen Mitteln für dieses wichtige Spiel fit zu machen. »Das ist nach dem Ausscheiden aus dem Pokal und dem Abrutschen in den Bundesligakeller unsere letzte Chance«, begründete er sein Verhalten, »ich kann meinen Verein nicht im Stich lassen.« Noch am Vormittag hatte er starke Schmerzen. Trotzdem absolvierte er ein Lauftraining, am Nachmittag bekam er einen neuen Verband und das »Okay« des Arztes, dass er sich als Einwechselspieler bereithalten dürfe.
Uli Hoeneß kommt in der zweiten Halbzeit für Dürnberger aufs Feld, bewegt sich zunächst noch zögerlich, spielt dann aber immer besser mit. In der 77. Minute erreicht ihn ein Pass von Torstensson, und plötzlich ist von einer verletzungsbedingten Behinderung nichts mehr zu sehen. Hoeneß wirbelt wie ein Irrwisch durch die Reihen des Gegners und schießt auf das Tor. Der starke Ararat-Torwart Abramjan, der zuvor ein halbes Dutzend hervorragender Paraden gezeigt hatte, ist machtlos – der Ball schlägt unmittelbar neben dem rechten Pfosten ein. Der Torschütze jubelt so ausgelassen wie selten zuvor. »Das schönste Tor meiner Laufbahn!«, wird er später glückstrahlend erzählen.
Da Torstensson kurz darauf noch auf 2:0 erhöhte, fiel die 0:1-Niederlage im Rückspiel nicht ins Gewicht. Im Halbfinale mussten die Bayern bei der Association Sportive aus Saint Etienne antreten. Die Verhältnisse in der Bergarbeiterstadt im Südosten Frankreichs waren schwierig – an diesem 9. April war es winterlich kalt und der Rasen mit Schnee bedeckt –, die Franzosen angriffslustig, aber mit Kampfkraft und einem unüberwindbaren Sepp Maier ertrotzte man sich ein 0:0. Uli Hoeneß riss sich bei diesem Spiel den Meniskus an, aber da ihn die Verletzung nicht stark behinderte, beachtete er sie nicht weiter und stand zum Rückspiel zwei Wochen später wieder bereit. Bereits in der 2. Minute leistete er die Vorarbeit zu einem Klassetor von Beckenbauer, ein Solo von Bernd Dürnberger sorgte für das 2:0. Man hatte gewonnen, man war erneut im Finale – und doch waren die 74.000 Zuschauer im Olympiastadion mit ihrer Elf hörbar unzufrieden. Zu schönen Siegen war diese Mannschaft kaum mehr in der Lage. Selbst im Finale nicht.
Das Endspiel am 28. Mai 1975 in Paris sollte als das bis dahin hässlichste in die Geschichte des Europapokals eingehen. Die Hauptschuld trug dabei nicht einmal das unattraktive Ballgeschiebe des FC Bayern, sondern vor allem der brutale Gegner: Leeds United. Im Prinzenpark von Paris erwiesen sich die Engländer, die schon im Halbfinale gegen den FC Barcelona unangenehm aufgefallen waren, als knüppelharte Tretertruppe. Eines der Opfer war der bereits seit dem Spiel in St. Etienne angeschlagene Uli Hoeneß, und so wurde diese Partie zum Anfang des Endes seiner Karriere. Schon kurz nach dem Anpfiff trat Terry Yorath den am Boden liegenden Björn Andersson gegen das Knie. Der Schwede musste ausgewechselt werden und fiel anschließend fast eine ganze Saison aus. Uli Hoeneß wurde gleich dreimal böse gefoult, bis auch er noch vor dem Halbzeitpfiff vom Feld hinkte. Durch einen Tritt seines Gegenspielers Frank Gray hatte er sich eine Quetschung des Meniskus im rechten Knie zugezogen, und trotz zweimaliger Operation – eine am Innenmeniskus und acht Wochen später eine am Außenmeniskus – sollte er nie wieder vollständig genesen. Aber das konnte an diesem Abend natürlich noch niemand ahnen. Das Spiel selbst endete durch Tore von Franz »Bulle« Roth und Gerd Müller mit 2:0 für die Bayern, die damit ihren Titel im Europapokal der Meister verteidigt hatten.
Uli Hoeneß’ Verletzungspause dauerte vom 32. Spieltag der Saison 1974/75 bis zum 16. Spieltag der folgenden Saison. Am 6. Dezember 1975 kam er in der 71. Minute beim Spiel in Berlin gegen Hertha BSC für Franz Roth. Die Bayern lagen mit 1:2 zurück, und auch Hoeneß konnte daran nichts mehr ändern. Beim nächsten Spiel in Braunschweig (1:1) spielte er von Beginn an und wurde erst kurz vor Schluss ausgewechselt, danach kam er immer besser in Schwung und machte bis zum Saisonende alle Spiele mit. Am 20. März, beim 4:0 gegen Mönchengladbach, schien der Rückkehrer wieder ganz der alte zu sein: Er schoss zwei Tore und bekam vom Fachblatt »Kicker« für seine hervorragende Leistung die Note 1. Zum Abschluss der Bundesligasaison, an deren Ende die Bayern immerhin auf dem dritten Rang einliefen, hatte Uli Hoeneß 17 Spiele bestritten und vier Tore erzielt. Im Europapokal machte er ab den im März beginnenden Viertelfinals sämtliche Spiele der Bayern mit. Der Weg führte über Benfica Lissabon (0:0 und 5:1 mit Vorlage Hoeneß auf das 4:1 von Müller) und Real Madrid (1:1 und 2:0) ins Finale am 12. Mai nach Glasgow. Zu überwinden war dort der Halbfinalgegner vom Vorjahr, St. Etienne. Die Bayern hatten zunächst Pech – nach zwei Minuten erzielte Müller einen Treffer, der wegen Abseits nicht gegeben wurde – und dann Glück bei zwei Lattentreffern der Franzosen. Nachdem »Bulle« Roth in der 57. Minute nach einem kurz angetippten Freistoß von Beckenbauer das 1:0 erzielt hatte, dominierten die Bayern das Spiel. »Ich war noch in keinem Finale so wenig beschäftigt«, erklärte Torwart Sepp Maier, und Uli Hoeneß fügte an: »Ich machte mir überhaupt keine Sorgen, bis Rocheteau kurz vor Ende eingewechselt wurde.« Aber auch Rocheteau, der Star der Franzosen, konnte nichts mehr am Ergebnis ändern – und die Bayern durften als besondere Auszeichnung für den dritten Titelgewinn den Pokal, den sie nach dem Spiel erhielten, als dauerhaften Besitz mit nach Hause nehmen.
Ein Ball im Nachthimmel von Belgrad
Bei der Endrunde zur Europameisterschaft 1976, die am 22. Mai 1976 mit dem Viertelfinale gegen Spanien im Olympiastadion begann, waren nur noch vier Bayern im DFB-Team dabei: Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck und eben Uli Hoeneß, der wegen seiner Verletzungen ein Jahr lang in der Nationalmannschaft hatte pausieren müssen. Nach einigen starken Darbietungen in der Bundesliga holte der Bundestrainer nun den mit 24 Jahren immer noch sehr jungen Bayern-Spieler in die Nationalelf zurück. Das lange Tief hatte bei dem ehemaligen Himmelsstürmer, dem bis zum WM-Gewinn 1974 alles zugeflogen war, eine deutlich spürbare charakterliche Veränderung bewirkt. »Er ist reifer geworden«, bemerkte Bundestrainer Helmut Schön, »er hat über sich nachgedacht.«
Uli Hoeneß’ Rückkehr stand unter einem guten Stern: Er spielte gut und erzielte den ersten von zwei deutschen Treffern zum letztendlichen 2:0-Sieg gegen die Spanier. Aber es sollte das letzte von insgesamt fünf Länderspieltoren des Uli Hoeneß bleiben. Nach einem schwer erkämpften 4:2 gegen Jugoslawien, das der neue Stürmerstar Dieter Müller durch zwei Treffer in der Verlängerung entschied, wartete im Endspiel von Belgrad die Tschechoslowakei. Dort stand es nach einem dramatischen Spiel und Hölzenbeins Ausgleich in letzter Minute nach der regulären Spielzeit 2:2. Als auch die torlose Verlängerung keine Entscheidung gebracht hatte, kam es zum Elfmeterschießen – und zu einem traumatischen Erlebnis für Uli Hoeneß.
Einmal war der ansonsten matte Bayern-Stürmer im Spiel an seinem Bewacher Koloman Gögh vorbeigezogen, hatte den Ball dann aber an den Pfosten gesetzt. »Aus drei Metern hatte ich abgedrückt, dumpf war der Knall. Hätte ich nur getroffen!«, stöhnte er hinterher. »Das wäre der Sieg gewesen – es wäre nie zu diesem verdammten Elfmeterschießen gekommen.« Nach dem Abpfiff der Verlängerung lagen die Spieler erschöpft im Mittelkreis, tranken Wasser und kühlten sich mit feuchten Schwämmen und Eiswürfeln. Helmut Schöns Assistent Jupp Derwall sprach auf der Suche nach den Elfmeterschützen nacheinander jeden einzelnen Spieler an. Drei hatte er schnell gefunden: Flohe, Bonhof und Bongartz. Der Rest wollte nicht. Beckenbauer wollte nicht, und der völlig platte Hoeneß wollte auch nicht. Da meldete sich plötzlich der Torwart, Sepp Maier: »Dann schieß halt ich.« Nun war Beckenbauer ganz erschrocken und erbarmte sich: »Bevor der schießt, dann lieber ich.« Fehlte noch einer. Derwall sagte in Richtung Hoeneß: »Dann muss eben der junge Dieter Müller schießen.« Jetzt erbarmte sich endlich auch Hoeneß und willigte ein.
Masny, Nehoda, Ondrus und Jurkemik hatten für die Tschechoslowaken getroffen, Bonhof, Flohe und Bongartz für die Deutschen, als sich Uli Hoeneß mit weichen Knien auf den Weg zum Elfmeterpunkt machte. Die Entfernung zum Tor wurde in seinem Kopf lang und länger. »Ich war so weggetreten, wie es sonst nur im Konzertsaal passieren kann. Ich merkte nicht, dass da überhaupt Leute drin waren, im Stadion. Einsam spazierte ich auf den weißen Punkt, rings um mich Sahara. ›Ins rechte Eck kannst du nicht schießen‹, dachte ich, denn dann müsste ich mit der Innenseite schieben. Das erfordert Konzentration, die nicht mehr da ist. ›Also donnerst du den Ball mit dem Innenspann ins linke Eck. So hart, dass notfalls der Torwart mit dem Ball ins Tor fliegt.‹ Ich wanderte immer noch …« Dann der Moment der Wahrheit: »Ich legte den Ball irgendwo auf den Punkt – wie in Trance. Ich lief an, ich schoss, ohne auf den Torwart zu blicken. Ich schaute dem Ball nach, sah ihn immer höher steigen. Wie eine Weltraumrakete von Cape Kennedy sauste er in Richtung Wolken. Unerreichbar. Da kam kein Torwart mehr ran, niemand konnte ihn halten, so hoch flog der. Nur im Tor war er nicht gelandet, dieser Ball.« Den Schlusspunkt des Spiels setzte Panenka, der Sepp Maier listig verlud und dann den Ball in die Mitte des Tores schob. Hoeneß hatte den Rest des Dramas wie betäubt verfolgt. »Ich bin froh, dass du den verschossen hast«, sagte Beckenbauer zu ihm, um ein tröstliches Wort bemüht. »Ich wäre nach dir gekommen, und wer weiß, ob ich dann nicht derjenige gewesen wäre.« Doch Uli Hoeneß war untröstlich. Dieser verschossene Elfmeter war eine Sache für die Geschichtsbücher. Dort wird er ewig stehen.
Mit dem Ball im Nachthimmel von Belgrad begann der Abgang des Fußballspielers Uli Hoeneß. Sein 35. und letztes Länderspiel bestritt er im November desselben Jahres bei der freundschaftlichen Revanche gegen die Tschechoslowaken, die in Hannover glückte (2:0). Kurz darauf holte er mit dem Weltpokal seinen letzten internationalen Titel im Trikot des FC Bayern (2:0 und 0:0 gegen den Südamerika-Meister Cruzeiro Belo Horizonte). In der Hinrunde der Bundesligasaison 1976/77 gelangen ihm immerhin acht Tore und vier Torvorlagen, doch es war offensichtlich, dass der angeschlagene ehemalige Weltklassestürmer sein altes Niveau einfach nicht mehr erreichen konnte. Präsident Neudecker erklärte bei der Jahreshauptversammlung der Bayern: »Wir brauchen keine Märtyrer.« In der Rückrunde wurde es nicht mehr besser. Im Februar 1977 entdeckte Professor Klümper in Freiburg ein markstückgroßes Loch in der rechten Leiste – Uli Hoeneß spielte trotzdem weiter bis zum 12. März, da Gerd Müller sich im Krankenstand befand. Parallel zu seinem anhaltenden Verletzungsdrama setzte sich, begleitet vom Unmut der eigenen Fans, der Niedergang der einstigen Erfolgself fort. Es gab Pfiffe für Hoeneß, der nicht mehr so konnte, wie er wollte, und für die Mannschaft, die nicht mehr zu siegen vermochte: »Aus« im DFB-Pokal, »Aus« im Europapokal, und in der Bundesligasaison 1977/78 folgte mit Rang zwölf die schlechteste Platzierung seit dem Aufstieg 1965.
Vor der WM 1978 tat der angeschlagene Uli Hoeneß alles, um sich noch einmal für die Nationalmannschaft ins Gespräch zu bringen. Er rief regelmäßig Bundestrainer Helmut Schön an, laut einem Artikel im »Fußballmagazin« ging er sogar so weit, von Journalisten nach einigermaßen gelungenen Spielen hervorragende Noten geradezu zu fordern. Wer ihn seiner Meinung nach zu schlecht beurteilt hatte, den soll er demnach per Telefon gestellt haben: »So schlecht, wie du mich gemacht hast, habe ich am Samstag bestimmt nicht gespielt. Ihr solltet euch mal ein Beispiel an den Kollegen in anderen Städten nehmen. Die schreiben ihre Spieler richtig in die Nationalmannschaft rein.«
Obwohl er bei 30 Saisoneinsätzen immerhin zu respektablen elf Toren gekommen war, wurde es nichts mehr mit einem Comeback im DFB-Trikot. Und seine Karriere neigte sich nun auch bei den Bayern ihrem Ende zu.